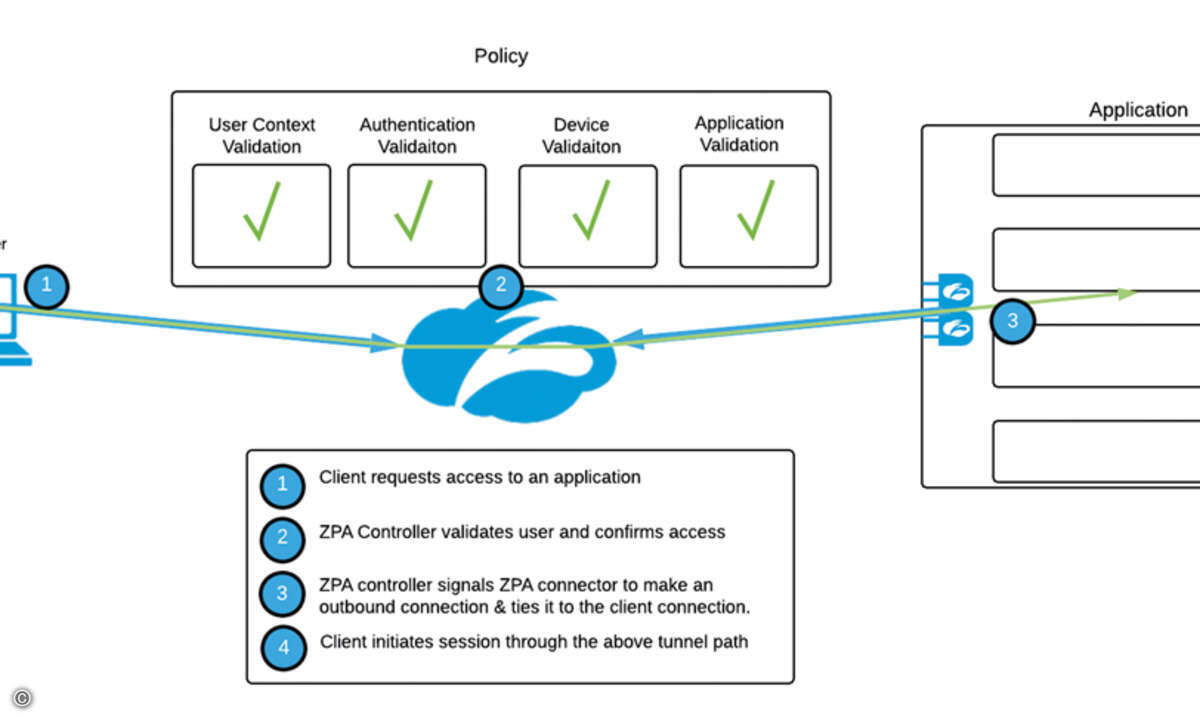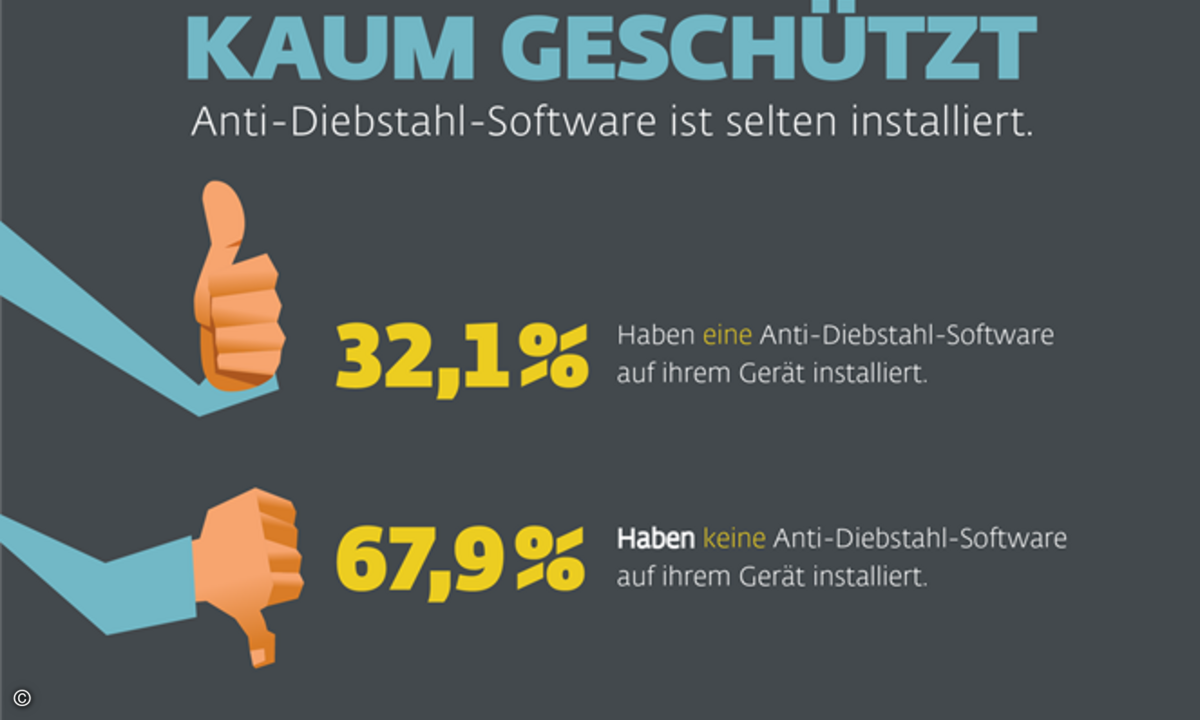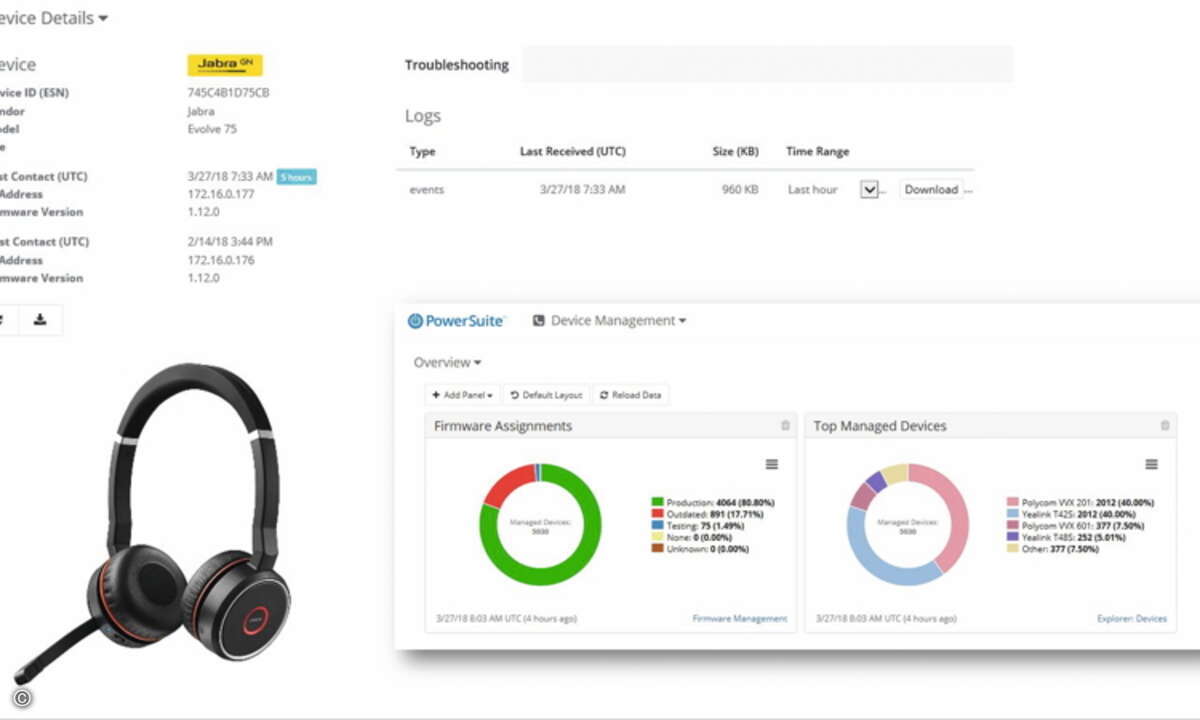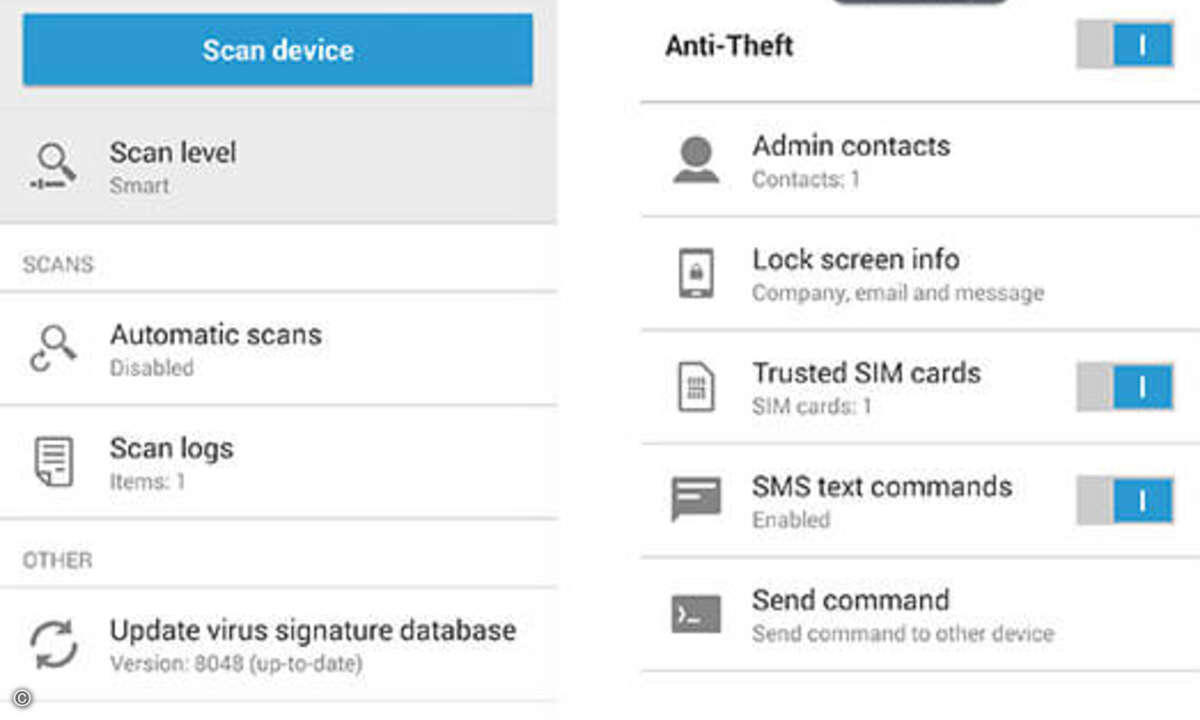Der Anwender im Mittelpunkt
Der Anwender im Mittelpunkt. Häufig scheitern Ansätze, die deutsche Verwaltung zu elektronisieren, an fehlender Nutzerorientierung. Der Anwender muss in den Mittelpunkt rücken, fordert eine aktuelle Studie.
Der Anwender im Mittelpunkt
In einer aktuellen Studie (E-Government 2006. Von der technikgetriebenen zur nutzergetriebenen Verwaltungsreform) befassen sich Pascal Johanssen und Peter Herz vom Berliner IEB (Institute of Electronic Business) ausführlich damit, warum Deutschland bei E-Government nur im Mittelfeld rangiert. Der wichtigste Grund: Der Anwender stehe selten im Fokus des Interesses, vielmehr sei das Hauptziel der Verwaltung in gewohnter hoheitlicher Manier noch immer, interne Abläufe zu optimieren ? egal ob die neuen Prozesse dem Bürger passen oder nicht.
In anderen Ländern dagegen herrsche ein eher partnerschaftliches, an kooperativen oder Netzwerkidealen ausgerichtetes Staatsverständnis. Dadurch richteten sich Anwendungen eher an den Interessen von Nutzern aus. Deshalb seien diese Länder im E-Government erfolgreicher. »Eine Verwaltungsreform kann nicht ohne ihre Nutzer und nur durch Technik weiterentwickelt werden, zumal
sie eine höhere technische Kompetenz ihrer Benutzer erfordert«, schreiben die Autoren klipp und klar. Sie fordern nichts weniger als eine nutzergetriebene Verwaltungsreform.
Dazu bedürfe es eines offensiven Kommunikationsstils der Verwaltungen, die E-Government nach außen als wichtiges Vorhaben darstellen müssen, Befragungen, in denen die Wünsche der Nutzer erfasst werden, ein ausführliches Controlling sowie Integration und Vernetzung zwischen einzelnen Akteuren und Angeboten. An all diesem fehle es in Deutschland, so die Untersuchung.
Nutzung ist nicht Akzeptanz
Die Autoren unterscheiden sinnvollerweise zwischen Adoption und Akzeptanz: Die Nutzung einer Anwendung, ihre Adoption, kann der Staat schlicht durch Verordnung erzwingen ? ihre Akzeptanz allerdings nicht. Die Studie nennt vier Optimierungsansätze, die Akzeptanz wahrscheinlicher machen: optimale Technikgestaltung durch Standardisierung, kostenlose Signaturen und einfache Software, schnellere Verfahren, Entlastung bei den Gebühren, zumindest aber kein finanzieller Mehraufwand durch E-Government und letztlich die Verpflichtung der Anwender, die aber von diesen durchaus als Zwang empfunden wird und beim Anwender entsprechende Unlust und Gegenreaktionen auslösen kann.
Misserfolg ELSTER
Was es bedeutet, wenn E-Government-Anwendungen den Nutzern mehr oder weniger aufgezwungen werden, zeige ELSTER, die elektronische Steuererklärung. Sie ist für bestimmte Erklärungen, zum Beispiel Umsatzsteuervoranmeldungen, inzwischen verpflichtend. Beim Start von ELSTER im Februar 2005 brachen permanent die Server zusammen, weil es zu wenige Serveradressen gab, die Finanzamtsrechner verweigerten zum Teil die Datenannahme und die Nutzer wussten nicht, ob ihre Daten angekommen waren. Zu all dem Ungemach bekamen sie deshalb noch Mahnungen oder Säumnisgebühren. Das führte dazu, dass Unternehmen gerichtliche Verfügungen erwirkten, damit sie ihre Erklärungen vorläufig weiter auf Papier einrechen konnten und zahlreiche teure Nachbesserungen nötig waren.
Um solche Misserfolge zu vermeiden, empfiehlt die Studie den Verwaltungen Nutzwertanalysen, wie sie Unternehmen vornehmen, um genau festzustellen, welche Anwendergruppen welche Lösungen brauchen und nutzen würden. Daran fehle es häufig, vielmehr würden digitale Angebote am Bedarf der verschiedenen Anwender vorbei produziert.
Gefragte Online-Formulare
So wollen Unternehmen nach Erhebungen des IEB mehrheitlich (68,1 Prozent) gern Formulare aus dem Internet herunterladen. Knapp die Hälfte der vom IEB in Berlin befragten Unternehmen schätzt Stadtinformationssysteme und automatisierte Zugriffe auf amtliche Verzeichnisse. Das Institut folgert aus seinen Untersuchungsergebnissen, dass Angebote besser kommuniziert werden müssen und neue Angebote an den Bedürfnissen der Wirtschaft sowie einzelner Branchen ausgerichtet sein sollen. Eine wichtige Nutzergruppe sind in diesem Zusammenhang sogenannte Intermediäre wie Rechtsanwälte, Steuerberater oder Lohnbüros, an die gerade Mittelständler Verwaltungsaufgaben mit Behördenkontakt delegieren.
Als Beispiel für ein neues, kooperativ und kommunikativ gestaltetes E-Government-Angebot stellt die Untersuchung schließlich das in Entwicklung befindliche Kollaborationsportal E-Lawyer vor. Daran arbeiten derzeit das IEB und T-Systems. Die Idee zu dem Portal ist auf dem Hintergrund einer zunehmenden Elektronifizierung von Justizhandeln zu sehen. Die Plattform soll Akteuren im Justizbereich wie Rechtsanwälten oder Notaren einen vereinheitlichten Zugang zu diversen Diensten eröffnen: einem elektronischen Grundbuch, einem Formularservice, automatisierten Registern, Auskünften aus dem Melderegister etc.. Für alle Services wird es die elektronische Signatur und E-Payment-Funktionen geben. Primär wird die Plattform Dienste Berliner Behörden einbeziehen, möglich
soll es aber auch sein, Bundesbehörden wie das Patentamt zu integrieren. g