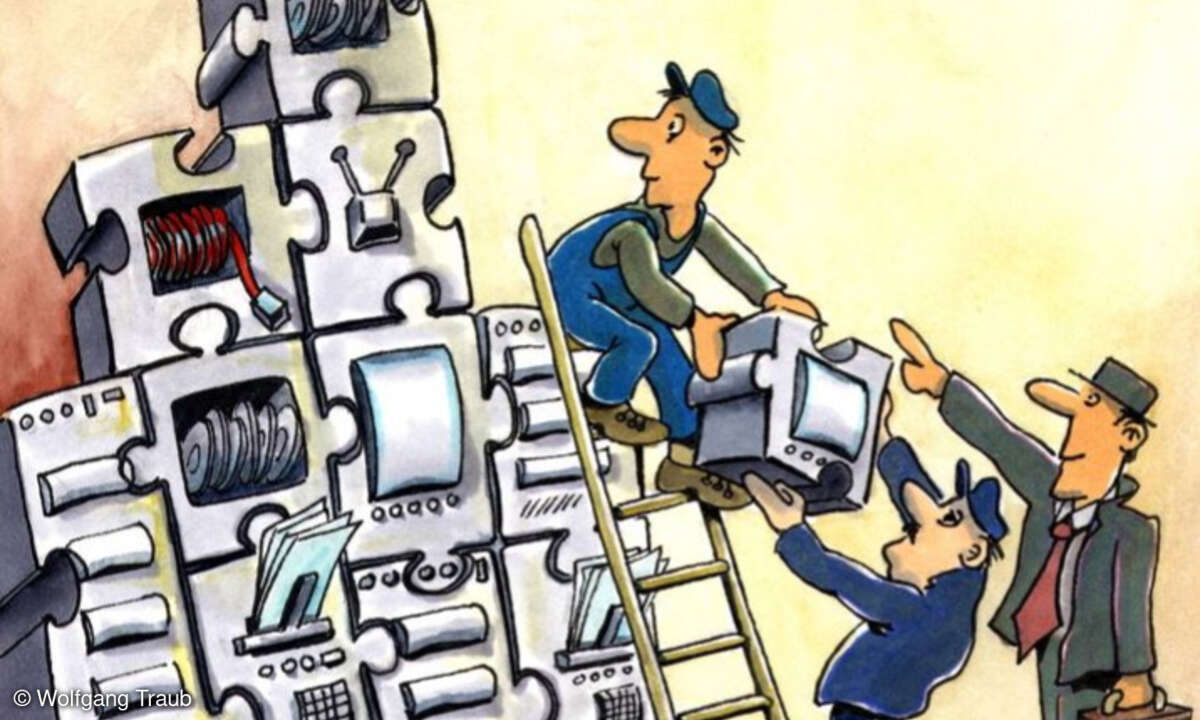Ein Profi mit Hut
Mit einer Vielzahl von Erweiterungen schreitet die neueste Version von Redhat-Enterprise-Linux zielstrebig auf Data-Centers zu – aber Lizenzierungs- und Supportfragen könnten eine Adaption behindern.

Die Anfang 2002 freigegebene erste Enterprise-Version von Redhat-Linux (RHEL) wurde von unabhängigen Softwareanbietern, Hardwareherstellern und Unternehmenskunden gut aufgenommen. Viele Software- und Hardwareanbieter haben in der Zwischenzeit ihre Komponenten für RHEL zertifiziert – eine für jedermann lohnende Situation, besonders aber für Kunden, die dringend Support der Enterprise-Klasse benötigen. Die aktuelle Version, Redhat-Enterprise-Linux 3.0, liefert nun wichtige Updates, die helfen werden, eine noch breiter gestreute Adaption zu erreichen. RHEL enthält rund 350 Verbesserungen, darunter POSIX-complaint-Threads im Kernel, Unterstützung zusätzlicher Hardwarearchitekturen und verschiedene Betriebssystem-Fixes.
RHEL ist als Workstation(WS)-, Edge-Server(ES)- und Advanced-Server(AS)-Version verfügbar – Network Computing testete alle drei Varianten in ihren Real-World Labs. Die WS-Version zielt natürlich auf eine Arbeitsstations-Installationsbasis, lässt sich aber auch in einem High-Performance-Computing(HPC)-Cluster einsetzen, eine korrekte Konfiguration vorausgesetzt. Die ES-Version, entworfen für kleine bis mittlere Server, ist für Netzwerk-, Datei-, Druck-, Mail-, Web- und benutzerdefinierte Geschäftsapplikationen geeignet. Die AS-Variante unterstützt die größte Anzahl von Prozessoren und den größten Speicher; sie zielt auf Mission-Critical- und hoch verfügbare Installationen. Alle drei Versionen enthalten native POSIX-complaint Threading-Libraries (NPTL), was die Chancen von Linux verbessert, gegen große Unix-Installationen zu bestehen, wo die Softwareanforderungen diktieren, dass Tausende von Threads von Betriebssystem verwaltet werden.
Steckbrief
Redhat Enterprise Linux 3.0
Hersteller: Redhat
Charakteristik: Betriebssystem
Kurzbeschreibung: RHEL ist ein Linux-Betriebssystem beziehungsweise -Netzwerkbetriebssystem, das alle gängigen (und ein paar nicht ganz so gängige) Hardwareplattformen unterstützt, viele Features besitzt, via RHN gut zu verwalten ist und in drei Versionen für verschiedene Einsatzgebiete (Desktop, Edge-Netzwerkdienste, Server) verkauft wird.
Web: www.redhat.com
Preis: WS-Version ab 179 Dollar, ES-Version ab 349 Dollar, AS-Version ab 1499 Dollar
Die NPTL-Opensource-Entwicklung wurde von Redhat angeführt. Bis zu dieser Initiative, deren Ergebnisse inzwischen in verschiedene Linux-Core-Komponenten implementiert sind, fanden Threading-Pakete einfach nicht ihren Weg in diese benötigten Teile von Linux. Damit hatte das Betriebssystem Schwierigkeiten, auf Tausende simultaner Threads zu skalieren, und auf Java basierende Applikationen, die auf Threading-Support angewiesen sind, waren nahezu nicht zu implementieren. NPTL war erstmals in der 2.5-Entwicklung des Linux-Kernels verfügbar.
Unsere Tests legten offen, dass RHEL 3.0 auch besseres Speichermanagement offeriert, wozu robustere Treiber gehören. Wir fanden beispielsweise Unterstützung für Serial-ATA (S-ATA) – es ist zu erwarten, dass diese schnelleren Festplattentreiber üblicher werden sowie Hardwarehersteller S-ATA-Geräte besser integrieren. RHEL enthält keine Treiber für iSCSI-Platten, weil der Treiber den ratifizierten Spezifikationen nicht entspricht. Red-Hat sagt, dass möglicherweise ein Update zu 3.0 erscheinen wird, das diese Unterstützung enthält.
Erfreut stellten wir fest, dass das von Sistina Software geschriebene Logical-Volume-Management seinen Weg in RHEL gefunden hat. Das ist ein großes Plus für Unternehmen, die logische Volumes benötigen. RHEL bietet ferner Software-RAID für höhere Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit, falls die Hardware nicht selbst RAID-Konfigurationen unterstützt.
Lizenzierung und Registrierung
Aber die Sache hat einen Haken (den gibt es ja immer): Das Kaufmodell von Redhat basiert auf der RHEL-Version pro Server, pro Architektur, pro Support-Level pro Jahr und ist damit in größeren Organisationen nur schwer zu verwalten. Da es kaum vorstellbar ist, dass Kunden RHEL auf allen Knoten gleichzeitig installieren werden, statt ihre Umgebungen allmählich über die Jahre hinweg den Anforderungen ihres Geschäfts anzupassen, könnte es so enden, dass jeden Monat RHEL-Lizenzen und Supportverträge zu erneuern sind. Der Hersteller muss diese Supportlast verringern, indem er jährliche Supportverträge anbietet, die sich – basierend auf Serverklassifikationen – erneuern lassen. Außerdem sollten Einkäufe, die etwa zur Jahresmitte erfolgen, gemeinsam mit existierenden Supportverträgen des Kunden terminiert werden.
Eine Basis, drei Wege
Wir installierten alle drei Versionen von RHEL 3.0 vom selben Basismedium. Redhat verwendet »Personality Technology«, um die Installation als WS-, ES- oder AS-Installation durchzuführen – nur die Installations-Boot-CDs sind unterschiedlich. Der Hersteller sagt, dass diese Technik ihm erlaubt, angepasste RHEL-Distributionen für große Desktop-Rollouts oder Behörden zu erzeugen. Redhat offeriert für alle drei Versionen technischen Support auf verschiedenen Stufen, und die Distributionen unterstützen wichtige Independent-Software-Vendor-Applikationen, beispielsweise Oracle oder IBMs Websphere. Enthalten sind Desktop-Applikationen wie Mozilla und Openoffice sowie unverzichtbare Komponenten wie Apache, Samba und NFS.
Nach der Installation der drei Versionen testeten wir die Managementfunktionen der Redhat-Network-(RHN-)Satellite- und Proxy-Server. Die Installation war auf unterstützter x86-Hardware schnell und einfach durchzuführen. Alle in den Testsystemen eingesetzten Geräte, darunter verschiedene Netzwerk- und Soundkarten, wurden automatisch installiert und konfiguriert. Benutzer, die ältere Versionen von Redhat-Linux einsetzen, werden sich mit dem Installer wie zu Hause fühlen. Der Installer basiert natürlich auf Redhats ehrwürdiger Anaconda-Installer-Schnittstelle.
Die WS-Version ist für Desktop-Clients am besten geeignet, weil sie Hardware mit maximal zwei Prozessoren unterstützt. Das Betriebssystem läuft auf 32-Bit-x86-Hardware ebenso wie auf 64-Bit-Hardware, einschließlich Intel Itanium und AMD-64. Natürlich ist die WS-Version auch die billigste Variante, angefangen bei 179 Dollar pro Kopie, ohne Support. Im Preis enthalten ist das RHN-Update-Modul für ein Jahr. Technischer Support, eingeschränkt auf zwölf Stunden an fünf Wochentagen (12/5), ist ab 299 Dollar pro Arbeitsstation erhältlich.
Redhat-Premium-Support (24/7) ist leider nur für die AS-Version verfügbar. Redhat zielt mit diesem Release zwar auf den Desktop/Client-Markt oder auf einen Einsatz als Teil einer technischen Computing-Farm, aber die WS-Version kann auch als preiswerter Web- oder Dateiserver fungieren, weil sie Apache und Samba enthält und bis zu 8 GByte Arbeitsspeicher unterstützt.
Die ES-Version zielt auf Edge-Netzwerkdienste, beispielsweise DNS, DHCP, Web sowie File und Print. Sie läuft nur auf x86-32-Bit-Architektur mit einem Speicher-Footprint von weniger als 8 GByte. Im Gegensatz zur WS- ließ die ES-Version von Redhat unterstützte Pakete installieren, darunter DNS-, DHCP-, FTP- und LDAP-Server sowie Firewall-Dienste.
Für die ES- gibt es wie für die WS-Version nur Standard-Support. Basis-Editionen, also solche, die nur Update-Support und keinen technischen Support umfassen, beginnen bei 349 Dollar, während Standard-Editionen bei 799 Dollar starten. Knapp 800 Dollar pro Kopie mag teuer klingen, aber zu bedenken ist, dass hier ein Jahr uneingeschränkter technischer Support enthalten ist.
Die AS-Version ist die Premium-Edition von RHEL, die Kompatibilität mit einer Vielzahl unterschiedlicher Hardware-Architekturen verspricht. AS läuft auf typischer Linux-Hardware, also x86, Intel-Itanium und AMD-64, aber auch auf nicht ganz so typischer Architektur wie IBMs pSeries-, iSeries-, zSeries- und s/390-Prozessorarchitekturen. Diese Version unterstützt Maschinen mit vielen Prozessoren und großen Speicherkonfigurationen – bis zu 16 Prozessoren und 64 GByte Arbeitsspeicher in x86-Architekturen. Verglichen mit den WS- und ES-Versionen ist die AS-Version teuer, aber die einzige Version, für die 24/7 technischer Support mit einer Stunde Reaktionszeit angeboten wird – ein Muss für Mission-Critical-Applikationsserver.
Berücksichtigt man die preisgünstigere x86-Architektur und die RHEL-AS-Kosten, dann ist diese Lösung insgesamt billiger als Sun-Solaris oder IBM-AIX auf Sparc- oder pSeries-Servern. RHEL-AS für x86-Prozessoren startet bei 1499 Dollar mit Standard-Support. Für Premium-Level-Zugriff erhöht sich der Preis auf 2499 Dollar. RHEL-AS für zSeries- und s/390-Architekturen startet bei heftigen 15000 Dollar – darin ist noch kein Premium-Support enthalten, der kostet weitere 3000 Dollar.
Die Standard-Paketauswahl erschien den verschiedenen Versionen angemessen, und der Redhat-Installer gestattet eine leichte Anpassung der Installation. RHEL erlaubt Administratoren außerdem, Applikationen auf dem Betriebssystem angepasst zu kompilieren. Das funktionierte auf allen drei Versionen problemlos, als wir probeweise die letzte Version des Apache-Web-Servers kompilierten. Custom-Applikationen unterstützt Redhat zwar nicht per se, deren Einsatz beeinflusst jedoch nicht die Supportangebote.
Managementmodus
Die Entscheidung ist gefallen, das Data-Center voller RHEL-Server steht da. Aber wie wird es nun kosteneffizient administriert? Natürlich mit den enthaltenen RHN-Diensten. RHN ist ein komplettes System-Management-Tool, das auf einer einfachen auf Web basierenden Schnittstelle fußt und in drei Varianten kommt: hosted, Proxy-Server und Satellite-Server. Die Funktionalität des Dienstes lässt sich durch Hinzufügen von Modulen wie Update, Monitoring, Management und Provisioning erweitern.
Das gehostete RHN-Dienst-Modul ist das übliche – und jenes, welches wir alle zu hassen gelernt haben. Eine Zeit lang hat Redhat dieses Modul kostenlos für ein System angeboten, allerdings mit eingeschränkter Funktionalität. Dann ersetzte der Hersteller diesen kostenlosen Service durch einen Demonstrationsmodus und verlangte von den Demo-Usern, alle 60 Tage Formulare auszufüllen, um den Dienst weiterhin nutzen zu können. Natürlich wurden nur Benutzer, die versuchten, den Dienst kostenlos zu nutzen, derart bestraft – zahlende Kunden genossen bevorzugten Service und Zugriff auf Software-Updates.
Opfer dieser Situation brauchen sich nicht zu fürchten: Wird das RHEL-Angebot gekauft und genutzt, funktioniert dieser Dienst prima. Nach der Installation von RHEL-AS verbanden wir uns sofort mit dem RHN-hosted-Server und nutzten das Update-Modul, um die fünf, sechs Software-Patches zu schnappen, die zu dieser Zeit verfügbar waren. Das Update-Modul, das bei RHEL »up2date« heißt, ist in die Desktopumgebung integriert und meldet sich regelmäßig beim Service. Sind Software-Updates oder Sicherheits-Patches verfügbar, benachrichtigt das Modul den Administrator.
Für kleinere RHEL-Installationen und Benutzer, deren Internetverbindungen nicht in puncto Bandbreite begrenzt sind, reicht der gehostete Dienst aus. Aber weil dieser Modus verlangt, dass sich jeder Computer direkt via Internet mit RHN verbindet, um Updates zu suchen oder herunterzuladen, werden einige Standorte einen Alternativplan benötigen. Dafür stehen die Proxy- und Satellite-Dienst-Angebote zur Verfügung, die großen RHEL-Kunden viele Vorteile bieten. Beide Produkte bringen die Software in die Unternehmens-Firewall: Ein Computer nimmt Kontakt mit Redhat-RHN-Servern auf, und die anderen Server verbinden sich mit diesem Proxy- oder Satellite-Server. Die RHN-Datenbank – und zu einem großen Teil der Applikationsserver – befinden sich beim Proxy-Angebot immer noch auf den Redhat-Servern, aber der Web-Inhalt und -Server im LAN.
Der Satellite-Modus zeigt die größte Flexibilität, indem er die Datenbank, die Applikation und den Web-Server ins LAN bringt. Satellite läuft getrennt vom Internet, und Software-Updates lassen sich via CD oder DVD laden. Für die Nutzung des Satellite-Dienstes muss der Kunde eine separate Oracle-Lizenz besitzen, die RHN als Datenbank-Backend verwendet. Redhat sagt, dass in künftigen Versionen eine eingebettete Version der Datenbank enthalten sein soll.
Add-ons genutzt
Nachdem wir den Modus für den RHN-Dienst ausgewählt hatten, selektierten wir die gewünschte Funktionalität – natürlich zu weiteren Kosten. Das Update-Modul, das zu jeder RHEL-Version gehört, erlaubt Updates der Installation auf Basis eines jährlichen Abonnementmodells, sendet priorisierte Benachrichtigungen via E-Mail, verfügt über Auto-Update-Fähigkeiten und gestattet einfache Point-and-Click-Installationen mit Abhängigkeitsprüfungen. Die meisten RHN-Nutzer werden diesen Modus kennen.
Das Management-Modul ist ein Add-on zum Update-Modul. Die Funktionalität ist unterschiedlich, je nachdem, ob ein gehosteter, Proxy- oder Satellite-RHN-Dienst ausgeführt wird. Im gehosteten Modus fanden wir hilfreiche Systemgruppierungen, Systemberechtigungen und Fähigkeiten zur geplanten Aktionsausführung. Systeme ließen sich in selbst erzeugte Klassen gruppieren, wobei einzelne Systeme Mitglied vieler Gruppen sein durften. Das ist sehr nützlich, falls Systeme beispielsweise nach Standorten und zusätzlich noch nach Applikationsdiensten gruppiert werden sollen. Unmittelbar nach dem Einschalten des Management-Moduls in RHN ließen sich Benutzer mit spezifischen Berechtigungen für Gruppen oder einzelne Systeme erzeugen. Das Modul erlaubt vom RHN-Dienst aus außerdem die Ausführung geplanter Aufgaben, beispielsweise Reboots, ohne dass zuvor eine Verbindung zur jeweiligen Maschine hergestellt werden muss.
Mit dem Modul können Administratoren benutzerdefinierte Kanäle erzeugen und Pakete lokal zwischenspeichern, um sie im Proxy-Modus an verwaltete Hosts auszuliefern. Mit benutzerdefinierten Kanälen können Administratoren RPM-Applikationen von Drittherstellern beispielsweise an Hosts und System-Management-Scripts verteilen. Wir haben basierend auf RHEL 3.0 beispielsweise einen benutzerdefinierten Kanal erzeugt und anschließend die Fähigkeit zum Aktualisieren und Installieren von Office-Produktivitätswerkzeugen entfernt. Die Optionen sind fast grenzenlos.
Im Satellite-Modus erlauben die Managementangebote sogar noch feinere Kontrolle. Neben den bereits erwähnten gehosteten und Proxy-RHN-Angeboten konnten wir im Satellite-Modus Kanäle klonen und Berechtigungen basierend auf Kanälen statt Systemen erzeugen. Das kann in abgestuften Umgebungen nützlich sein, in denen der Administrator einen Kanal für Testmaschinen erzeugt. Sobald die Software getestet ist, klont er den Kanal für die Produktionsmaschinen.
Wir hatten Zugriff auf das Management-Modul und das Proxy-Server-Angebot, das auf RHEL 2.1 installiert war (gegenwärtig ist die Proxy-Software nur für RHEL 2.1 zertifiziert). Die Erzeugung von Systemgruppen und Berechtigungen für Benutzer war eine Kleinigkeit. Die Software erlaubte die Durchsuchung der Datenbank nach Dingen wie installierter Software und Hardware, IP-Adressen sowie Standorten. Die Erzeugung benutzerdefinierter Kanäle war Dank einer simplen auf Web basierenden Schnittstelle einfach. Die Software ist mächtig und gibt Administratoren grenzenlose Anpassungsmöglichkeiten.
Das Monitoring-Modul, ein Hard-/Softwareprodukt von Redhat, steht nur zur Verfügung, wenn RHN im Proxy-Modus läuft. Redhat arbeitet daran, dieses Modul auch auf dem Satellite-Server verfügbar zu machen, also für Kunden, die vom Internet getrenntes RHN benötigen. Wir haben das Monitoring-Modul nicht getestet, aber Redhat gibt an, dass es Autodiscovery, agentenloses Server-Monitoring einschließlich Unix- und Windows-Server, Reporting und Benutzerbenachrichtigungen bietet. Die Monitoring-Software integriert sich in andere Monitoring-Pakete, beispielsweise HPs »Openview« oder BMCs »Patrol«.
Was noch kommt
Wenn Sie diesen Artikel lesen, wird Redhat wahrscheinlich bereits ein Update des RHN-Dienstes anbieten, das ein Provisioning-Modul enthält. Dieses Modul war nicht Teil unseres Tests, weil Redhat die Dokumentation noch nicht fertig hatte. Das Modul wird das Management-Modul ergänzen und Konfigurationsmanagement für RHEL-Maschinen, Rollback-Fähigkeiten und Baremetal-Recovery-Dienste zur Verfügung stellen. Laut Redhat wird das Provisioning-Modul Änderungen basierend auf Delta-Aktionen verfolgen und Server in den jüngsten funktionsfähigen Zustand zurücksetzen können. Es soll ferner möglich sein, eine Maschine ohne viele Benutzereingriffe zu klonen.
Fazit
In unseren Tests arbeitete RHEL 3.0 problemlos. Gemeinsam mit RHN wird es gut in die meisten Unternehmen passen, die sich für Linux entschieden haben. Natürlich ist noch Raum für Verbesserungen. Oben auf unserer Wunschliste stehen Premium-Support für alle Releases, ES auf 64-Bit-Plattformen wie Intel-Itanium und AMD-64, Unterstützung von mehr Arbeitsspeicher für ES und Änderungen im Lizenzierungsmodell.
Mit der Fähigkeit, durch NPTL-Support im Kernel mehr Threads verarbeiten zu können, kann Linux sich mit Unix messen. Wer über eine Unix-zu-Linux-Migration nachdenkt, der kommt aktuell eigentlich nicht an RHEL vorbei, denn den RHEL-Features, den Managementfähigkeiten via RHN, der installierten Basis und dem Support des größten Linux-Anbieters laufen alle anderen Anbieter hinterher. [ nwc, dj ]