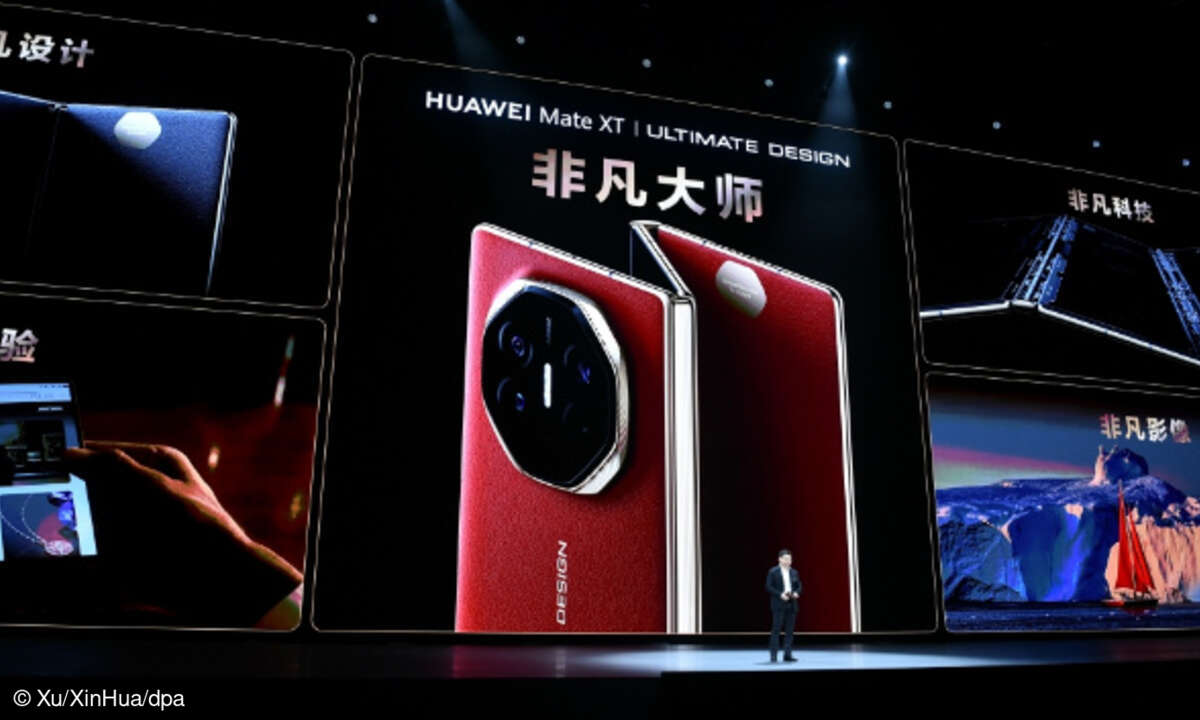Gedanken eines Smombies
Ob beim Lesen eines Buches oder Daddeln auf dem Smartphone – beide verbindet, dass der Nutzer bewusst Realitätsflucht begeht. Oder etwa doch nicht?

Es gibt Wörter im deutschen Sprachgebrauch, die sind poetisch („Knabenmorgenblütenträume“), einfallsreich-scherzhaft („Hüftgold“), wunderbar komprimierend und international einsetzbar („Zeitgeist“) oder einfach nur erschreckend nah an der Wirklichkeit wie „Smombie“. Für diejenigen, die damit nichts anfangen können: Das Kunstwort, das sich aus den Begriffen Smartphone und Zombie zusammensetzt, soll für all jene stehen, die das Leben, glotzend aufs Display, stumm an sich vorüberziehen lassen. Für mich verkörpert das Jugendwort des Jahres 2015 eine Generation von Menschen, deren Verhaltensweise mich gleichermaßen fasziniert und abstößt – und das stets verbunden mit dem Wissen, dass auch ich mich dem bisweilen nicht entziehen kann. So vergeht kaum ein Tag so wie heute, an dem ich nicht in der S-Bahn stehe, kurz von meinem Smartphone aufblicke (oh ja, auch ich bin ein Smombie) und um mich herum die zahlreichen bleichen Gesichter sehe, die wie in Trance auf das Mobiltelefon gerichtet sind. Ob es den Leuten Ende des 15. Jahrhunderts auch so gegangen sein mag, als die Ausbreitung des Buchdrucks ihren Anfang nahm? Nur mit dem kleinen Unterschied, dass damals Menschen auf Papier starrten anstatt auf leuchtende Displays? Wer weiß. Fest steht: Beiden ist gemein, dass der Nutzer bewusst Realitätsflucht begeht. Beim Bücherlesen vielleicht sogar noch gezielter als beim Smartphone. Kann man doch bei Letzterem zumindest noch als „Ausrede“ vorschieben, mal eben Fragen aus der WhatsApp-Gruppe des Sportvereins beantworten zu wollen, die anstehende Reise zu planen oder die aktuellsten News zu checken.
„Doch aufgepasst!“, denke ich mir, während ich noch kurz die Welt rette/148 Mails checke: Woher stammt denn der (Irr-)Glaube, dass ich als Smombie wirklich Realitätsflucht begehe? Ist nicht das Digitale längst ebenso Teil der wirklichen Welt wie das Analoge? „Als real wird zum einen etwas bezeichnet, das keine Illusion ist und nicht von den Wünschen oder Überzeugungen einer einzelnen Person abhängig ist. Zum anderen ist real vor allem etwas, das in Wahrheit so ist, wie es erscheint, beziehungsweise dem bestimmte Eigenschaften ‚robust‘ – also nicht nur in einer Hinsicht und nicht nur vorübergehend – zukommen“, heißt es da auf Wikipedia, nachgeschaut auf dem eigenen Handy. Von dieser Definition ausgehend ist das Digitale durchaus real. Vielleicht, mit Bezug auf das World Wide Web, gefüttert und genährt durch die Wünsche und Überzeugungen Einzelner, aber dennoch real. Man könnte natürlich überspitzt behaupten, dass nur Fassbares, haptisch Greifbares, real sei – aber wo kämen wir da hin? Sind dann Gedanken und Meinungen, Emotionen und Werte nicht Wirklichkeit? Das ist mir dann doch zu philosophisch.
Auf der anderen Seite führt mich das zu der Erkenntnis, dass die seit einiger Zeit propagierte „Digital-Entgiftungskur“, auch Digital Detox genannt, so zielführend auch nicht sein kann, wenn ihr eine Realitätsverweigerung zugrunde liegt. Und überhaupt: Wer sagt denn, dass „digital“ gleich „Gift“ sein muss? Wer sagt denn, dass über einen Chat ausgetauschte Erfahrungen nicht ebenso wertvoll und „echt“ sein können wie es in einem persönlichen Gespräch der Fall sein kann? Abgesehen davon macht „die Dosis das Gift“, wie schon Paracelsus konstatierte. Ein Merksatz, der sich im Übrigen auf zahlreiche Beispiele unseres alltäglichen Konsumverhaltens anwenden lässt. In kleinen Mengen verabreicht, lässt sich so einiges leicht verdaulicher und verträglicher aufnehmen – denke ich mir und verstaue das Smartphone wieder im Rucksack.