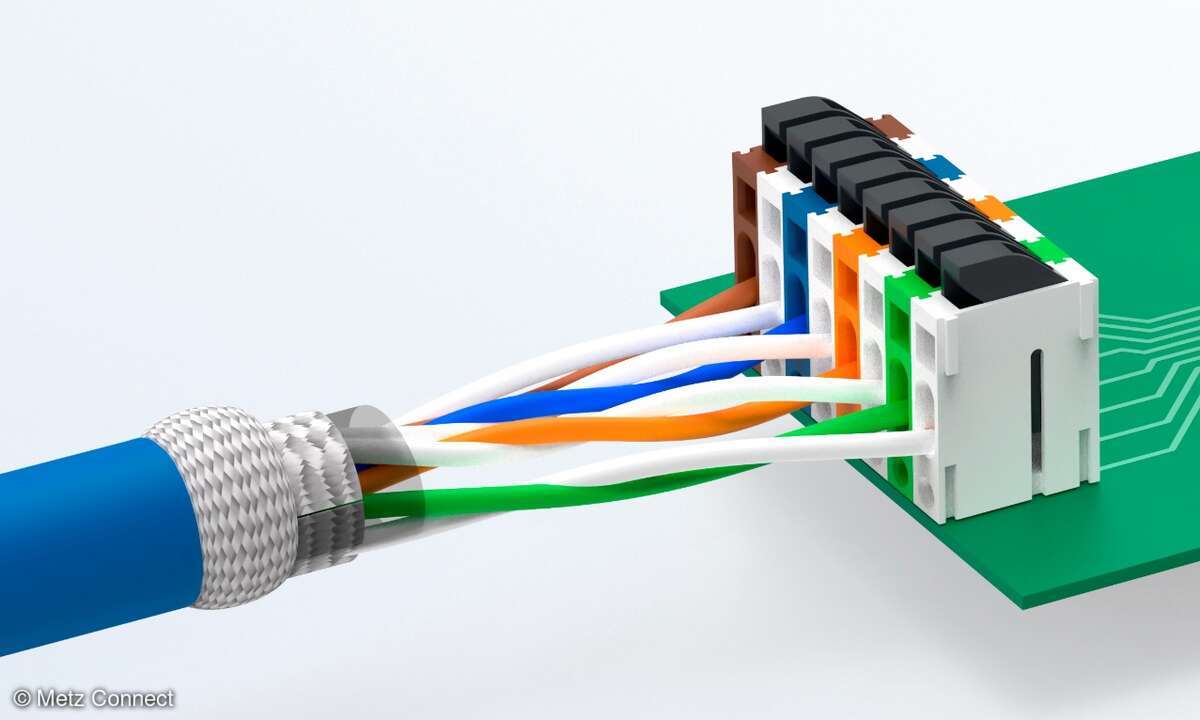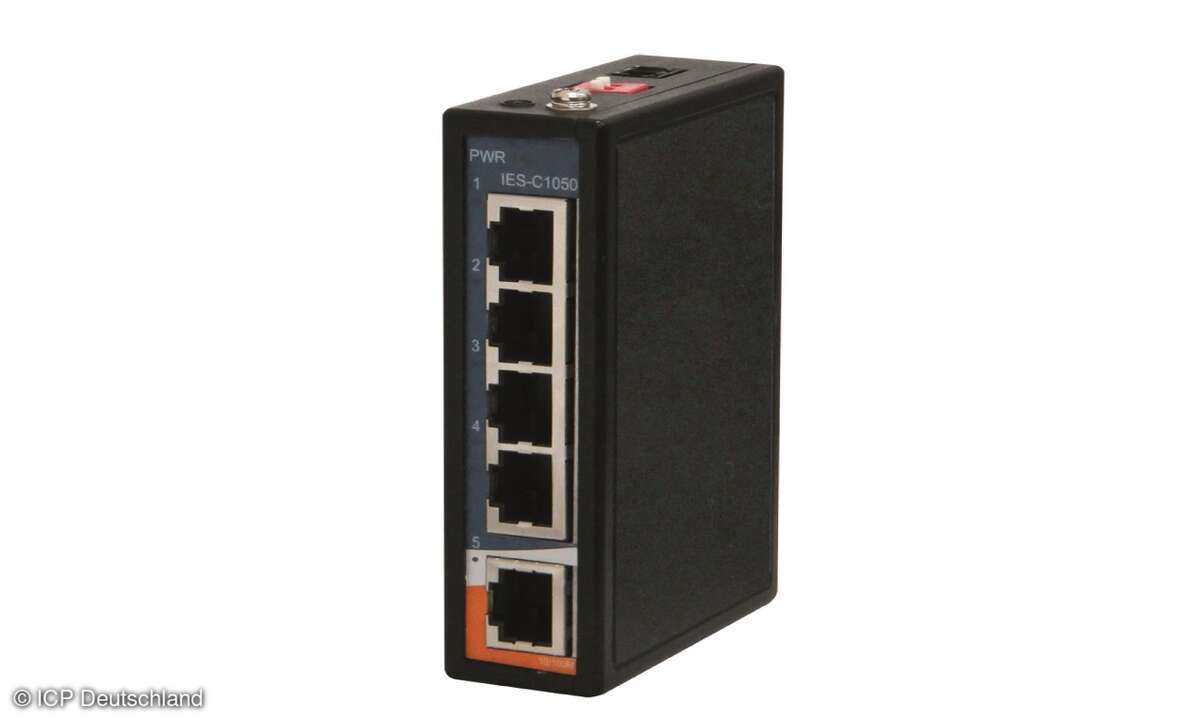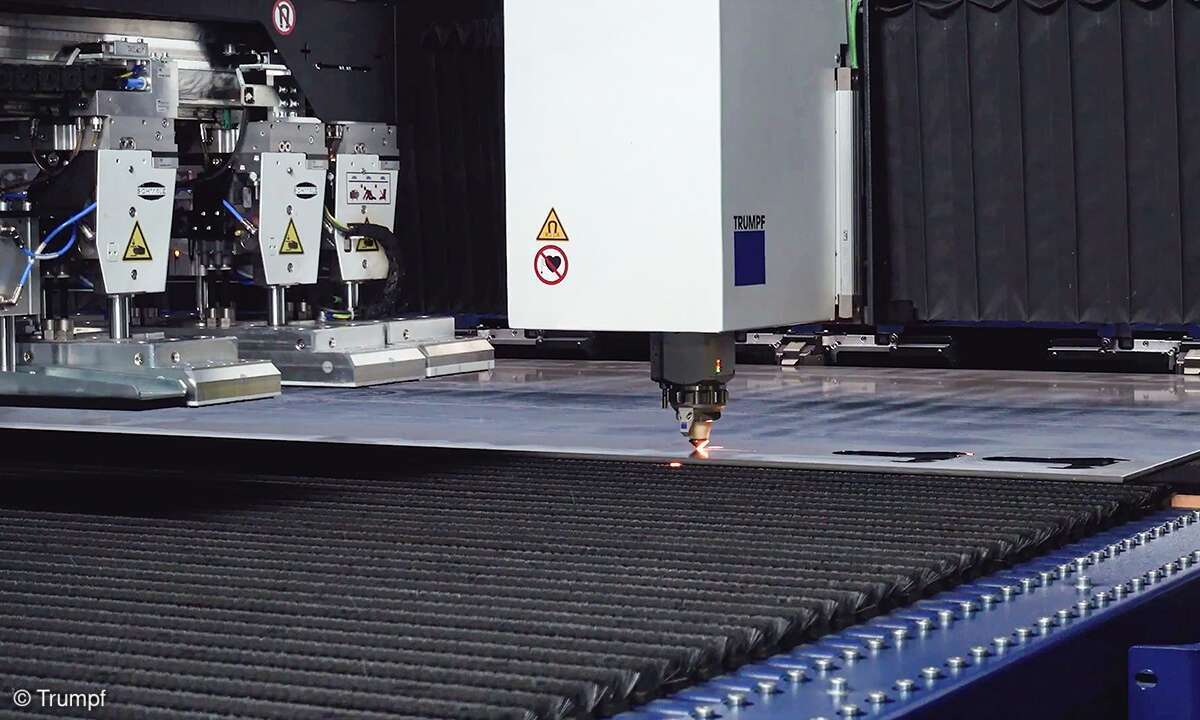Langstreckenwettbewerb
Gigabit-Ethernet-Weitverkehrsnetze – Die traditionellen WAN-Technologien haben Konkurrenz aus der LAN-Ecke bekommen. Das gute alte Ethernet schickt sich an, als alternative Weitverkehrstechnik Karriere zu machen.

Vor allem größere und international agierende Institutionen sind heute darauf angewiesen, ihre Außenstellen über leistungsfähige WAN-Strecken mit ihrer Zentrale zu verbinden. In der Vergangenheit kamen für diesen Aufgabenbereich vor allem Technologien wie SDH zum Einsatz, in der letzten Zeit gewinnt aber auch im WAN-Bereich Gigabit-Ethernet über optische DWDM-Systeme eine immer größere Bedeutung.
WAN-Verbindungen spielen vor allem für zwei unterschiedliche Einsatzgebiete eine Rolle: Zum einen verwenden viele Einrichtungen Weitverkehrsnetze, um Außendienstmitarbeiter und Benutzer von Home-Offices an ihre Infrastruktur anzubinden. Zum anderen setzen große Organisationen diese Technik ein, um ihre einzelnen Niederlassungen miteinander zu vernetzen. Für Außendienstmitarbeiter und Home-Office-User genügt es in der Regel, DSL- oder ISDN-Verbindungen anzumieten.
Unternehmen, die über mehrere Standorte verteilt sind und die über Außenstellen mit jeweils mehr als 200 Mitarbeitern verfügen, werden bei der Integration ihrer Niederlassungen ins Unternehmensnetz mit speziellen Herausforderungen konfrontiert. Bei Außenstellen dieser Größe ist es nämlich bei klassischen, SDH-basierten WAN-Anbindungen in der Regel erforderlich, in jeder Niederlassung praktisch die gleiche IT-Infrastuktur aufzubauen, wie in der Unternehmenszentrale. Solche WAN-Strecken erlauben zwar durchaus einen unkomplizierten Austausch von Informationen, die über WAN laufenden Applikationen dürfen aber keine zu hohen Anforderungen an die durch die Verbindung hervorgerufenen Latenzzeiten stellen, da schnelle Direktzugriffe ohne Zeitverzögerung über sie meist nicht möglich sind.
Das macht den Zugriff über das WAN auf Datenbanken und CAD-Systeme, wie auch Speicherkonsolidierungsmaßnahmen und Backup-Vorgänge über Weitverkehrsnetze schwierig und zwingt die IT-Abteilungen folglich dazu, ihre zentrale Infrastruktur aufzugeben und statt dessen dezentrale Umgebungen einzusetzen, in denen unter anderem jede Außenstelle über einen eigenen Speicherpool mit eigener Hard- und Software und jeweils eigenen IT-Verantwortlichen verfügt. In Verbindung mit den sowieso meist relativ hohen Preisen, die die WAN-Verbindungen kosten, können die Ausgaben, die für diese mehrfache Vorhaltung an Material und Know-how anfallen, durchaus ein Ausmaß erreichen, bei dem sie ernsthaft auf das Unternehmensergebnis durchschlagen.
SDH-Verbindungen
SDH – für »Synchonous Digital Hierarchy« – ist eine Standard-Technologie für synchrone Datenübertragungen über optische Medien. Sie verwendet mehrere unterschiedliche synchrone Transportmodule (STM) und Übertragungsraten. So gibt es beispielsweise STM-1 mit 155 MBit/s, STM-4 mit 622 MBit/s, STM-16 mit 2,5 GBit/s und STM-64 mit 10 GBit/s.
Da SDH Daten anders als Ethernet überträgt, müssen Unternehmen, die diese Technik für ihre WAN-Anbindungen nutzen, sämtliche darüber transferierten Informationen beim Verlassen der einen Niederlassung in ein SDH-kompatibles Format umwandeln, dann übertragen und zum Schluss, vor der Einspeisung in das LAN der anderen Niederlassung, wieder in ein Ethernet-konformes Format zurück transferieren. Dazu sind spezielle Umsetzungslösungen erforderlich, die Geld kosten und Latenzzeiten verursachen. So benötigen die aktiven Komponenten beim Umwandeln von Ethernet über ATM und Sonet auf SDH typischerweise jeweils etwa vier Millisekunden. Im Router-basierten SDH-Netz kommen konzeptbedingt beim Routing-Vorgang an jedem Netzknoten weitere Millisekunden hinzu, was bei der gesamten Datenverbindung zu Latenzen zwischen 20 und 80 Millisekunden führt.
SDH hat aber durchaus auch Stärken: Diese ergeben sich daraus, dass die eigentliche Datenübertragung im WAN im Betrieb über unterschiedliche Router an verschiedenen Standorten abläuft. Dieser Ansatz mit vielen alternativen Übertragungswegen sorgt dafür, dass die Datentransfers innerhalb des Kernnetzes auch bei Störungen weiterhin funktionieren. SDH stellt also eine verhältnismäßig sichere und zuverlässige Lösung dar, bremst den WAN-Verkehr aber wegen des Umwandlungs- und Routing-Aufwands deutlich aus.
Gigabit-Ethernet über DWDM
Setzt ein Unternehmen bei den WAN-Übertragungen auf Gigabit-Ethernet-Technologien, die über optische DWDM-Systeme (»Dense Wavelength Division Multiplexing«) laufen, so kann es im Vergleich zu SDH-Nutzern von einer ganzen Reihe von Vorteilen profitieren. Das Ethernet-Protokoll wurde zwar ursprünglich nicht für Weitverkehrsnetze konzipiert und bringt bei den Übertragungen einen relativ hohen Overhead mit, DWDM-basierte Gigabit-Ethernet-Lösungen machen dieses Manko aber auf Grund anderer Vorteile locker wieder wett.
Optische DWDM-Systeme nutzen das physikalische Prinzip, dass sich verschiedene in eine Glasfaser eingespeiste optische Wellenlängen – wie etwa die Farben rot und blau – nicht mischen. Die einzelnen Wellenlängen lassen sich auch nach Hunderten von Kilometern wieder mit optischen Filtern trennen. Eine Glasfaser kann heute bis zu 80 optische Wellenlängen mit einem Datenübertragungsvolumen von je 10 GBit/s parallel transportieren – mit Lichtgeschwindigkeit. Die einzelnen Verbindungen werden dabei von Punkt zu Punkt aufgebaut, ein logisches Routing wie bei SDH-Netzen ist nicht existent. Dies führt zu deutlich geringeren und stabileren Laufzeiten.
Vor einigen Jahren hieß es immer, dass solche Gigabit-Ethernet-Systeme zu teuer für die Anbindung von Außenstellen seien. Das hat sich in der letzten Zeit mit der stark gestiegenen Verbreitung dieser Technologie und den damit verbundenen Preissenkungen bei den erforderlichen Komponenten geändert. Darüber hinaus verbleibt der Datenverkehr in DWDM-Gigabit-Ethernet-Netzen die ganze Übertragung hindurch im Ethernet-Format, was den Einsatz aufwändiger Umwandlungstechniken überflüssig macht. Das verringert nicht nur die Latenzzeiten weiter, sondern minimiert auch den Administrationsaufwand und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Unternehmen, die jetzt ja nur noch mit einer Eins-zu-Eins-Übertragung der Dienste konfrontiert sind, ihre Service-Level-Agreements (SLAs) viel exakter definieren können, als zuvor.
Überblick über die Vorteile von Gigabit-Ethernet
Zusätzlich zu den bereits genannten Faktoren, die für reine Ethernet-Umgebungen in Unternehmen unter Einschluss der WAN-Strecken sprechen, kommt noch eine ganze Reihe reiner Kostenargumente: Wenn die durch die Verbindungen zwischen den einzelnen Niederlassungen erzeugten Latenzen so gering bleiben, dass die Arbeit über das WAN praktisch genauso ablaufen kann wie über das LAN – was bei Gigabit-Ethernet-Anbindungen der Fall ist – so sind die IT-Abteilungen dazu in der Lage, deutliche Einsparungen vorzunehmen.
Über Gigabit-Ethernet auf DWDM-Technologie stellen beispielsweise weder Datenbank- noch Speicherzugriffe über weite Entfernungen ein Problem dar. Das gleiche gilt auch für Backup-Vorgänge. Das bedeutet, die Unternehmen können ihre auf die einzelnen Niederlassungen verteilten Serverinfrastrukturen und Anwendungen zu großen Teilen in einem einzigen Rechenzentrum zusammenführen. Daraus ergibt sich wiederum, dass die Administratoren nicht mehr gezwungen sind, viele separate Serverlösungen für das ganze Unternehmen anzuschaffen.
Sie kommen statt dessen mit wenigen großen und leistungsfähigen Serverplattformen aus, was im Vergleich zu vielen »kleinen« Produkten kostengünstiger ist. Außerdem können sie ihre Speicherinfrastruktur auch in einen einzigen gemeinsamen Pool integrieren und so sämtliche Vorteile moderner Speichervirtualisierungslösungen nutzen. Neben den Kosteneinsparungen, die eine zentrale SAN-Infrastuktur wegen der besseren Gesamtspeicherauslastung im Vergleich zu verteilten Einzelkomponenten bringt, sei in diesem Zusammenhang nur der geringere Verwaltungsaufwand durch zentrales Speichermanagement und zentralisiertes Backup genannt. Gleiches gilt für die aus modernen Servervirtualisierungstechnologien resultierenden Vorteile, wie bessere Hardwareauslastung und dynamische Leistungsanpassungen an wechselnde Anwendungsanforderungen.
Ein einheitliches Rechenzentrum für das ganze Unternehmen bringt darüber hinaus auch noch Einsparpotential vor Ort, was die Rechenzentrumsflächen, die Klimaanlagen und Kühlsysteme sowie den Stromverbrauch betrifft. Das sind alles Faktoren, die im Lauf der Zeit durchaus einen großen finanziellen Unterschied machen können.
Auch die Sicherheit lässt sich durch eine zentrale IT-Infrastruktur bei deutlich einfacherer Security-Administration auf ein höheres Niveau heben. Da alle Außenstellen – und damit alle Unternehmensarbeitsplätze – in einem gemeinsamen internen Netz mit vergleichbaren Durchsatzraten arbeiten, genügt es, für die ganze Institution einen einzigen Internet-Zugang bereit zu stellen. Das bedeutet, anders als in aufgeteilten Umgebungen, in denen aus Performance-Gründen jede Niederlassung ihren eigenen Internet-Anschluss hat, müssen die Administratoren nur eine Firewall verwalten und es reicht aus, eine einzige DMZ für alle vom Unternehmen bereitgestellten externen Dienste aufzubauen. Das verringert den Verwaltungsaufwand signifikant und sorgt für einen geringeren Personalbedarf.
Mit dem Personalbedarf ist der letzte Punkt der Einsparungsliste erreicht. Da in einem einheitlichen, über Gigabit-Ethernet vernetzten System alle wesentlichen Applikationen in einem zentralen Rechenzentrum laufen, ist es nicht mehr erforderlich, auch in den Außenstellen hochqualifizierte Spezialisten zu beschäftigen. Diese müssen nur noch im Unternehmensrechenzentrum anwesend sein und für die externen Niederlassungen reichen normale Support-Mitarbeiter zur Anwenderbetreuung völlig aus.
Ein Fallbeispiel
Oft treffen die Mitarbeiter von WAN-Verbindungsspezialisten wie Teragate bei ihren potentiellen Kunden auf folgende Situation: Die betroffenen Unternehmen verfügen über mehrere, regional verteilte Niederlassungen und möchten diese – auf Grund der eben genannten Argumente – zu einem einzigen, übergreifenden Netz zusammenfassen. In solchen Fällen ergibt es Sinn, einen hochverfügbaren Gigabit-Ethernet-Ring mit 99,95 Prozent Verfügbarkeit über alle Standorte hinweg aufzubauen. Im Idealfall implementiert der WAN-Spezialist bei der Realisierung des Projekts nicht nur das Gigabit-Ethernet-Backbone, sondern garantiert auch in den SLAs fest definierte Latenzzeiten.
Das Gute bei einem solchen Ansatz: Die Kunden haben in diesem Fall jederzeit die Wahl und können – je nach ihren Anforderungen – sowohl die für sie passende Übertragungsgeschwindigkeit aussuchen (dabei stehen bei Teragate zum Beispiel beliebige Verbindungen zwischen 10 MBit/s und 10 GBit/s zur Verfügung), als auch die für sie relevanten Dienste (wie eine AES-Datenverschlüsselung).
Auf Wunsch lässt sich sogar die Integration zusätzlicher Schnittstellen wie Anbindungen von Ficon, Escon oder Fibre-Channel an Ethernet-Umgebungen realisieren.
Fazit
Obwohl Gigabit-Ethernet-Anbindungen nach wie vor etwa drei bis vier Mal so teuer wie VPN-Lösungen sind, rentiert sich der Aufbau eines DWDM-basierten Gigabit-Ethernet-WANs in den meisten Fällen für große Unternehmen trotzdem, und zwar auf Grund der oben genannten Einsparmöglichkeiten. Der Einspareffekt ist in der Regel dreimal so groß wie die Netzkosten. Dabei gilt es als durchaus realistisch, bei der Konsolidierung umfangreicher Unternehmensnetze Einsparpotentiale von bis zu 30 Prozent der gesamten IT-Kosten zu realisieren. Deswegen sollten die Verantwortlichen in solchen Einrichtungen durchaus einen Blick auf Gigabit-Ethernet-Angebote werfen.
Dominikus Schweighart,
Business Development Manager,
Teragate