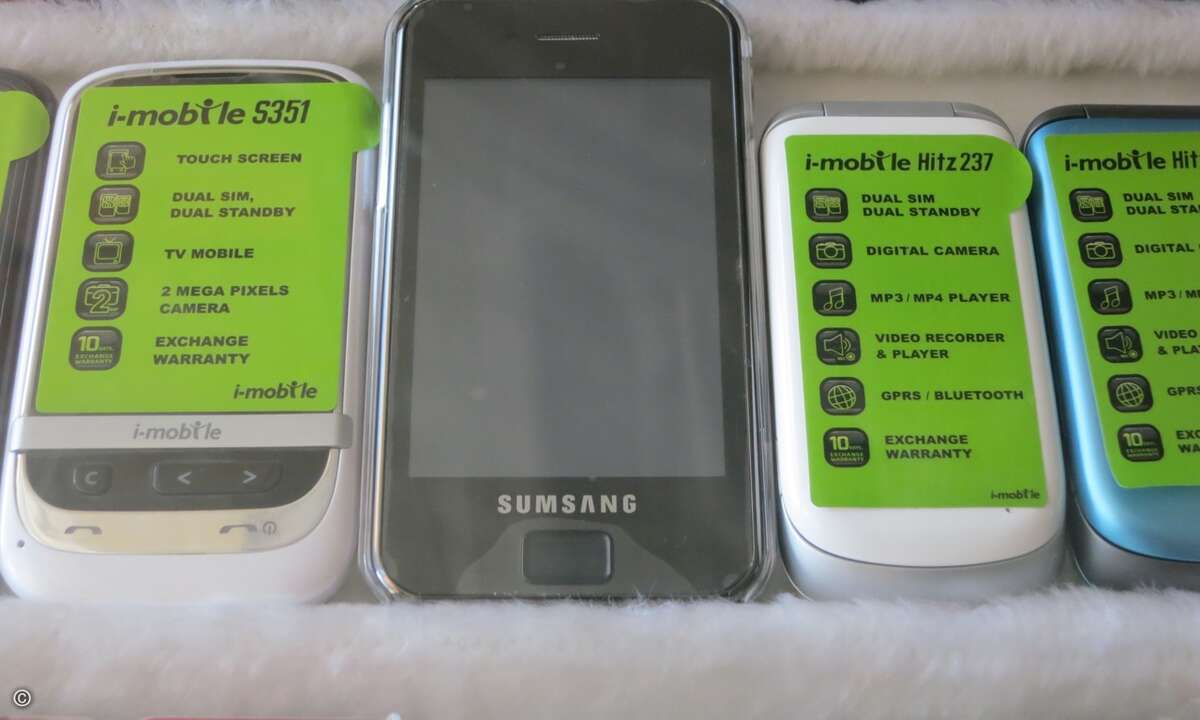»Universaldienst falscher Weg«
»Universaldienst falscher Weg« Noch immer gibt es in Deutschland weiße Flecken auf der DSL-Karte. Mit Jürgen Grützner, Geschäftsführer des VATM (Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten e.V.) sprach Ariane Rüdiger für staatundit darüber, wie diese Löcher zu schließen sind.

Wie breit ist für Sie Breitband, Herr Grützner?
Die derzeit offizielle europaweit gültige Definition, nämlich 144 KBit/s, greift auf jeden Fall zu kurz. Mit 1 MByte/s können Sie aber die wichtigsten Aufgaben bewältigen.
Anwendungen wie IP-TV wohl kaum.
Das ist richtig, aber der Nutzwert für den Endanwender ist bei IP-TV zweitrangig, es geht um Unterhaltung.
Wie groß ist nach Ansicht Ihres Verbandes der ungestillte Bedarf an Breitbandverbindungen in Deutschland?
Wir schätzen, dass rund fünf Millionen Menschen und rund 2200 Gemeinden keinen Breitbandanschluss bekommen können.
Was spricht dagegen, diesen Missstand durch eine gesetzliche Universaldienstverpflichtung zu beseitigen?
Seit Neuestem plädiert sogar die bayerische FDP dafür, und es gibt auch neue, dahin gehende Bestrebungen auf EU-Ebene. Wir halten das für den falschen Weg. Meiner Meinung nach werden die marktwirtschaftlichen Möglichkeiten noch nicht ausgenutzt. Die Telekom zum Beispiel hat schon oft an Standorten ausgebaut, wo sie das angeblich nicht konnte, sobald der Wettbewerb geboten hat. Deshalb fordern wir, dass die Telekom ihre Baupläne langfristig offen legen muss, um hier nicht mehr strategisch gegen Wettbewerber agieren zu können. Außerdem ist eine Universaldienstleistung rechtlich schwierig durchsetzbar: Als Universaldienst wird nur ein Service definiert, den fast alle nutzen. Gerade auf dem Land liegen die Nutzungsraten für Breitbandtechnologie aber nur bei 15 bis 20 Prozent der Haushalte. Damit lässt sich dieser hohe Anspruch nicht durchdrücken, selbst wenn man prinzipiell für eine Universaldienstleistung im Breitbandbereich wäre.
as hilft den Betroffenen vor Ort wenig. Wie wollen Sie das Problem lösen?
Mein Verband ist gerade dabei, eine bislang einmalige Datensammlung zu erstellen. Sie umfasst für alle Orte bestimmte Kenndaten: Zahl der Haushalte und Unternehmen, topologische Merkmale bezogen auf Ortsteile, die Entfernung zum nächsten Breitband-Zugangspunkt, die dort vorhandene Zuführung und so weiter. Dazu nutzen wir Daten aus Google Earth, es gibt aber auch andere Quellen wie Katasterdaten, die man verwenden kann. Dann sollte eine Task Force, zum Beispiel beim Städte- und Gemeindebund, für jeden Standort eine Vorauswahl möglicher Technologien treffen, die an diesem speziellen Ort für Breitbandimplementierung geeignet sind. Schließlich könnten die jeweiligen Gemeinden an entsprechende Betreiber herantreten beziehungsweise die Lösung ausschreiben.
Und wenn sich das an einem Ort nicht rechnet, weil nicht auf Anhieb genügend Interessenten da sind?
Tatsächlich kostet die Akquise eines Telekommunikationskunden 200 bis 300 Euro. Um diese Kosten zu senken, sollten Gemeinden im Vorhinein Listen von interessierten Haushalten oder Unternehmen erstellen. So sinken die Akquisekosten und es lohnt sich für den Provider eher, dort zu investieren.
Das heißt aber nicht, dass eine Implementierung dann profitabel ist.
Man braucht zwei- bis dreihundert Kunden an einem Ort, um profitabel arbeiten zu können. Sollten die tatsächlich nicht zusammen kommen, bin auch ich für Subventionen, denn Infrastruktur ist eine öffentliche Aufgabe. Aber Geld sollte nur in Höhe des finanziellen Abstands zwischen einer für den Anbieter profitablen und der vorhandenen Kundenzahl fließen.