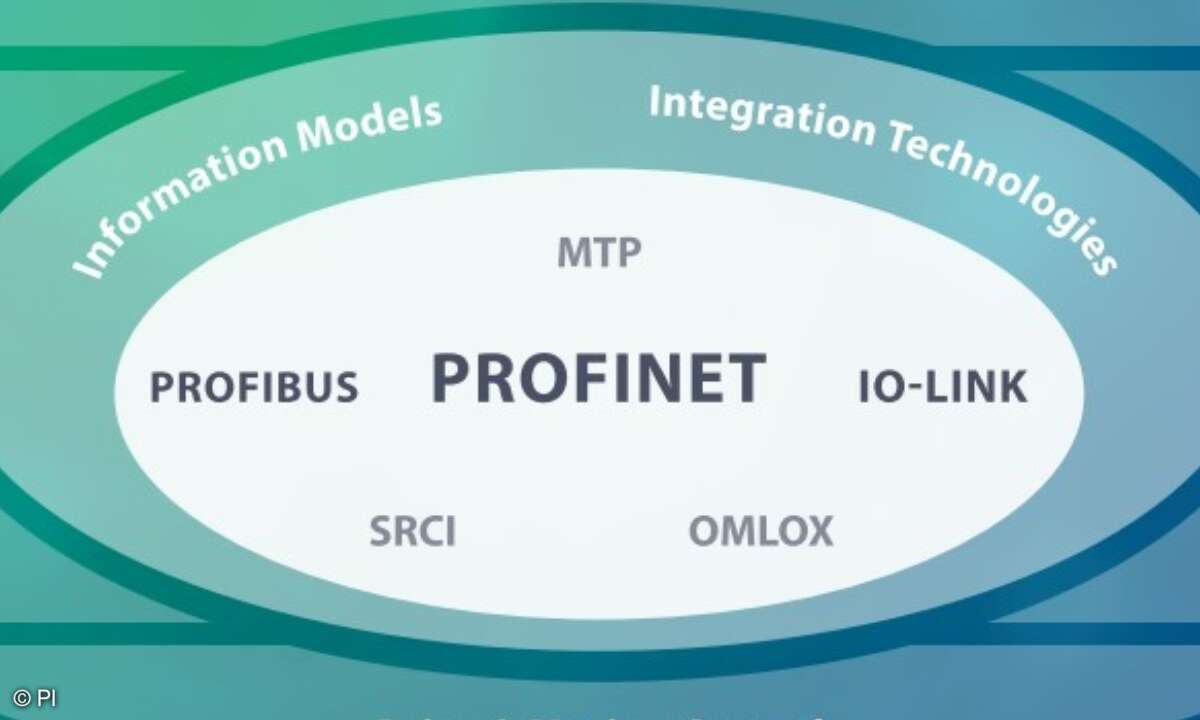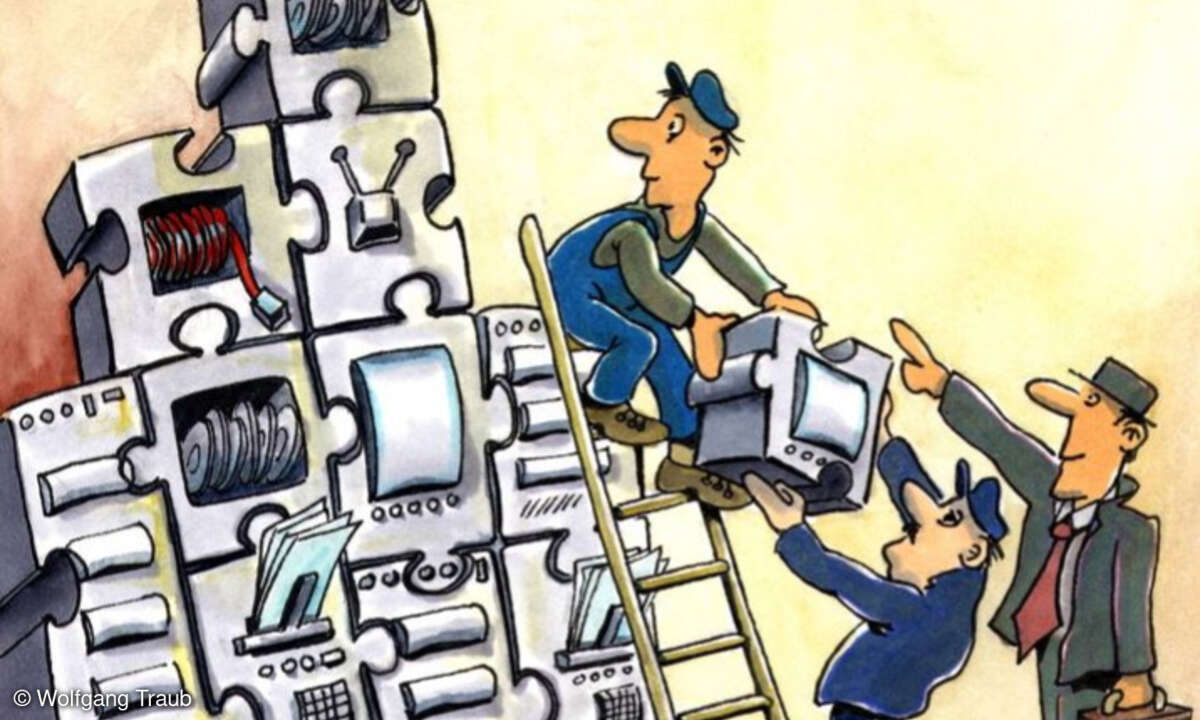CRN-Roundtable Opensource: Opensource nur mit vollem Einsatz
CRN-Roundtable Opensource: Opensource nur mit vollem Einsatz. Hat das Geschäftsfeld Opensource-Software genügend Potenzial, um zu rechtfertigen, dass Systemhäuser dafür Kompetenz aufbauen? CRN sprach mit Herstellern, Distributoren und Händlern, die sich im Opensource- Segment bereits einen Namen gemacht haben, über die Herausforderungen und Chancen im Geschäft mit der freien Software.
CRN-Roundtable Opensource: Opensource nur mit vollem Einsatz
Moderator:
Lohnt es sich für Systemhäuser, vom altbekannten Windows auf Linux umzusteigen? Für sie bedeutet dies ja, Kompetenzen und Know-how aufzubauen, das ist kein geringer Invest.
Krahfuss:
Ich sage dazu uneingeschränkt: Ja, das lohnt sich. Voraussetzung ist allerdings eine fundierte, umfassende Kompetenz im Linux- respektive Opensource-Bereich. Das Systemhaus muss sich voll und ganz auf die Thematik einlassen und nicht sicherheitshalber zweigleisig fahren wollen. Man muss es richtig machen wollen.
Hierlmeier:
Können Sie da ein wenig konkreter werden? Was heißt denn hier »richtig machen«?
Uhl:
Das heißt, wie Herr Krahfuss schon sagte, Kompetenz aufbauen, aber auch in Krisensituationen nicht gleich alles hinzuschmeißen. Das kostet Zeit und damit Geld, aber das Engagement lohnt sich.
Schultze-Melling:
Der Grund für den großen Respekt vieler Systemhäuser, aber auch mittelständischer Kunden sind die ungeklärten Fragen zum Lizenzrecht in der Linux-Welt: Darf ich eine Opensource-Software verkaufen oder nicht? Was muss ich kostenlos anbieten, was darf kosten? Muss ich eigene Weiterentwicklungen umsonst hergeben? Da ist viel Unsicherheit unterwegs. Es muss also erst mal der rechtliche Aspekt rundum geklärt werden.
Moderator:
Und wer soll diese offenen Fragen beantworten und damit Sicherheit geben?
Schmitz:
Da kommen wir etablierten Hersteller wie Novell-Suse ins Spiel. Wir können die nötige Rücksicherung geben, aber auch für Ausbildung sorgen, die den Partnern das Geschäft mit Linux vertrauenswürdig macht. Wir haben eine heterogene Partnerlandschaft, so dass es nicht darum geht: Linux, ja oder nein ? es geht darum, welche Lösung für die Kunden am besten ist.
Ganten:
Um weiter Akzeptanz auf der breiten Basis im Markt aufzubauen, brauchen die Partner Know-how und zwar durch Maßnahmen wie Zertifizierung und Schulung. Und sie benötigen lösungsorientierte Angebote. Aber auch der Kunde muss informiert werden, und wir bei Univention haben da mit Einladungen und Informationsveranstaltungen gute Erfahrungen gemacht. Und ein ausschlaggebender Faktor sind durchdachte Service Level Agreements (SLA), die für Vertrauen sorgen und für die Partner auch eine Rückversicherung darstellen. Auch eine LPI-Zertifizierung (Linux Professionell Institute) ist immer sinnvoll, um die Haftung zu reduzieren.
Schultze-Melling:
Ganz aus der Haftung kommen Sie mit GPL (GNU Public Licence) wohl nie, da bleiben immer Risiken. Wichtig ist jedoch ein sauberes SLA, damit ist ein Stück Risiko auf jeden Fall ausgeräumt.
Kühn:
Wir als Value Add Distributor sehen uns da ebenfalls in der Pflicht, den Partnern Rückhalt zu geben. Wir suchen zusammen neue Lösungen, die der Kunde braucht, Neueinsteiger erhalten fachliche Unterstützung bei ihrem Distributor in Zusammenarbeit mit dem Hersteller.
Schmitz:
Für den Handel kann Opensource-Software sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal sein. Der Dienstleister kann entscheiden, will er einer von vielen Me-To-Anbietern sein, die Microsoft anbieten oder setzt er auf den USP Opensource, auf den USP Kostenersparnis. Denn da hat Opensource-Software eindeutig die Nase vorn.
Behringer:
Da bin ich mir nicht so sicher, ob in einer Gesamtkalkulation Linux wirklich Windows überlegen ist. Ich beispielsweise implementiere beide Welten und stelle immer wieder fest, dass es einen riesigen Mehraufwand bedeutet, die beiden Systeme in Harmonie zu bringen, wenn ich Linux implementiere.
Ganten:
Das stimmt, eine Linux-Migration kann recht schmerzvoll sein, wenn auch das Resultat den Aufwand rechtfertigt. Man muss sich eben den Endkunden genau ansehen, ob ein Opensource-Konzept zu ihm passt.
Schmitz:
Sicherlich lässt sich nicht einfach lapidar sagen, dass Linux dem Kunden billiger kommt. Es ist nötig, ganz detailliert die Punkte abzustecken und zu definieren, wo Einsparungspotenzial liegt: Wann ist welche Lösung besser, was lässt sich mit der vorhandenen Software machen? Der Dienstleister muss auch wissen, wo er aufhören muss zu integrieren, denn eine Hundert-Prozent-Migration gibt es nicht. Sie als Dienstleister sind in der Pflicht, kompetent zu beraten, damit können Sie punkten.
Schwaller:
TCO ist der falsche Ansatz, darauf kommt es gar nicht so sehr an. Bislang fehlt der Opensource-Szene schlichtweg Infrastruktur und ein Applikationsportfolio für den Desktop, da sind wir definitiv noch im Nowhere-Land. Es wird in einer ganzen Reihe Opensource-Projekten »rumgefrickelt«. Jeder macht?s ein wenig anders, es gibt keine Vorgaben für Architektur oder Identity Management. Wieso beispielsweise existiert noch kein Groupware-Standard ? weil das Know-how bei den Systemhäusern nicht da ist. Es gibt im Bereich Groupware an die 20 verschiedene Opensource-Lösungen. Da blickt doch keiner mehr durch ? und der Kunde schon gar nicht. Wir müssen schließlich gegen eine strukturierte .Net-orientierte Umgebung antreten, in der in Software-Factories Produkte entstehen. Was wir brauchen sind also Linux-basierte Software-Factories, kein Szenario für jede Software.
Ganten:
Microsoft hat Standards geschaffen, aber damit Türen zugemacht. Um wieder flexibel zu werden und ihren Kunden vielleicht eine besser geeignete Lösung anzubieten, müssen Systemhäuser einen enormen Mehraufwand betreiben. Standards sind nötig, aber es ist wichtig, dass sie nicht von einem Hersteller aufgesetzt werden, sondern von mehreren Beteiligten.
Krahfuss:
Jedem Kunden ist doch eine eigene individuelle Lösung wichtig. Und gerade da liegt die Stärke von Opensource. Gewisse Standards müssen sich etablieren, das ist richtig. Das darf aber nicht auf Kosten der Individualität gehen ? wie bei Microsoft-Standards, die eine Diktatur darstellen. Denn solche »geschlossenen« Standards lassen sich nicht an spezielle Anforderungen anpassen und damit geht jede Flexibilität und damit Individualität verloren. Ich sehe diesen Punkt für Systemhäuser mehr als Chance denn also Risiko.
Ganten:
Ein Systemhaus muss entscheiden, ob es unabhängig sein will oder ob es in Abhängigkeit willkürlicher Lizenzmodelle proprietärer Hersteller verweilen will. Viele Partner haben Angst, Leads von Microsoft zu verlieren, wenn sie sich entscheiden, auch Opensource-Lösungen anzubieten. Wir arbeiten seit einem Jahr innerhalb eines Partner-Programms mit Systemhäusern zusammen ? mit großem Erfolg. Es hat sich gezeigt, dass bei unseren Installationen die Kunden nur in Ausnahmefällen auf Linux verzichten wollen und 95 Prozent aller Erstkundenkontakte zeigen reges Interesse an dem Thema.
Wiegmann:
Engagierten, aufstrebenden Systemhäusern bietet Linux auf jeden Fall eine große Chance. Im MS-Umfeld findet eine Abgrenzung beim Wettbewerb um den Kunden fast ausschließlich über den Preis statt. Dazu kommt, dass ein riesiges Heer vergleichbarer »Microsoft-Spezialisten« um die Aufträge buhlt. Opensource-Anbieter haben hier einen klaren Vorteil, sich abgrenzen zu können: einmal über günstigere Lizenzbedingungen und zum zweiten durch die Dienstleistung. Und nur durch Dienstleistung kann ich wachsen.
Ganten:
Der Opensource-Markt, allen voran Linux, wächst. Wir haben im letzten Jahr eine Steigerung um 130 Prozent erzielt. Um dieses Wachstumspotenzial auszuschöpfen, brauchen wir kompetente Partner, die sich in diesem Geschäftsfeld engagieren wollen. Nur so lässt sich die Nachfrage überhaupt decken. Und unser Beispiel sollte interessierten Systemhäusern zeigen: Die Chancen, neue Kunden zu gewinnen, sind groß!
Schmitz:
Wir haben festgestellt: Mehr als 80 Prozent aller Unternehmen setzen bereits irgendwo ein Linux-Derivat ein.
Behringer:
Um das Argument von Herrn Schwaller aufzugreifen: Ein Manko stelle ich allerdings in der Opensource-Ecke immer wieder fest. Es fehlt an konkreten Lösungsansätzen, es fehlt am Applikationsportfolio. Der Kunde kommt zu mir und wünscht sich die Lösung. Und die kann ich ihm oftmals mit Opensource-Software eben nicht liefern. Und es fehlt ihm eine Sicherheit, die ihm garantiert, dass die Lösung auch in Zukunft zuverlässig unterstützt und weiterentwickelt wird.
Uhl:
Das ist nicht ganz richtig: Die Community bietet eine Vielzahl von Lösungsansätzen. Aber ich gebe Ihnen recht, dass es professionelle Partner wie IBM oder Novell-Suse braucht, damit Systemhäuser sich vertrauensvoll auf Opensource einlassen. Denn der Kunde fordert mit Recht Nachhaltigkeit.
Wiegmann:
Sicherlich gibt es im Microsoft-Umfeld eine große Lösungsvielfalt. Doch die Community hat den klaren Vorteil, dass dort eine Vielzahl von Lösungen ständig bereit steht. Der Kunde hat bei uns Alternativen, die er bei Microsoft nicht hat. Und letztendlich entscheidet der Kunde. Die Kunst des Systemhauses ist es, sich in Lösungen einzuarbeiten.
Rimner:
Gegenfrage: Wie groß ist denn die Anzahl unzufriedener Kunden in der Microsoft-Welt? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es meine Aufgabe ist, herauszufinden, wo den Kunden der Schuh drückt und ihm dann die für ihn beste Lösung anzubieten ? egal ob Microsoft oder Opensource. Das muss ich als Experte und Fachmann entscheiden, der schließlich mehr Ahnung hat, als der Kunde.
Wiegmann:
Der Kunde hat bestimmte Anforderungen, die gelöst werden müssen, Linux alleine hilft keinem Systemhaus weiter. Wir müssen im Opensource-Bereich Anwendungs-orientiert vorgehen, Applikationen im Bereich ERP und Groupware entwickeln, davon können Systemhäuser profitieren. Es gibt eine ganze Reihe inzwischen etablierter Opensource-Applikationen, die auch eine gute Verbreitung haben. Allein im Content Management gibt es schöne Lösungen. Opensource-Lösungen müssen dabei nicht unbedingt das Beste sein, sondern sie müssen Commodity werden. Und da sind wir auf einem guten Weg ? wie allein die Veröffentlichungen von Büchern belegen. Opensource braucht also möglichst gutes Marketing.
Hierlmeier:
Und wer soll das Marketing im OS-Segment übernehmen? Die Projektentwickler? Das ist wohl unwahrscheinlich? Die Systemhäuser? Wer ist zuständig? Da fehlen doch Ressourcen und Zuständigkeiten.
Ganten:
Wir brauchen keine Marketing-Maschinerie, wir sind eine. Das gesamte Linux-Umfeld ist in den letzten acht Jahren auch ohne Marketing sehr erfolgreich. Der Grund dafür: Es kommt nicht aus einer Quelle, viele Menschen entwickeln, viele Leute setzen es ein, viele Leute reden darüber.
Schwaller:
Abgesehen davon: Es läuft doch eine gigantische Marketing-Maschinerie: Seit Jahren engagieren sich Firmen wie IBM massiv in diesem Thema.
Uhl:
Und in Embedded-Systemen ist Linux Standard wie beispielsweise bei Handys. Hier kauft der Kunde die Lösung für ihr Problem und keine Technologie. Und die Lösungsorientierung ist die Stärke von Opensource.
Schmitz:
650 Millionen Anwender setzen Microsoft ein, die finanzielle Power, gezielte Marketing-Maßnahmen dagegen zu setzen, hat niemand. Was wir mit Opensource verfolgen, ist eine Strategie der kleinen Schritte und indem wir uns ein zweites Standbein beim Kunden aufbauen und punktuell strategisch aktiv werden.
Wiegmann:
Wenn die Qualität der Opensource-Lösungen weiter zunimmt, dann wird die Rechnung aufgehen.
______________________________________________
Die Teilnehmer
Peter H. Ganten, Geschäftsführer des Softwarehauses Univention> Hartmut Goebel, Goebel Consult, Moderator
> Oliver Kügow, Geschäftsführer des Systemhauses Teamix IT Services in Nürnberg
> Uta Kühn, Marketingleiterin beim VAD
> Johann Krahfuss, Vertriebsleiter bei SEP Global Storage Management
> Gerd Rimner, Geschäftsführer des Systemhauses RMTS in Kirchheim
> Dr. Jyn Schultze-Melling, Rechtsanwalt bei Nörr Stiefenhofer Lutz, Spezialist für IT-Recht
> Robert Schmitz, Vertriebsleiter bei Novell-Suse
> Tom Schwaller, technischer Direktor der Linux Solutions Group e.V.
> Thomas Uhl, Vorstand Strategie & Technik der Topalis AG, Stuttgart
> Olaf Wiegmann, Geschäftsführer Hard- und Softwarehaus in Bremen
> Evi Hierlmeier, Chefredakteurin CRN