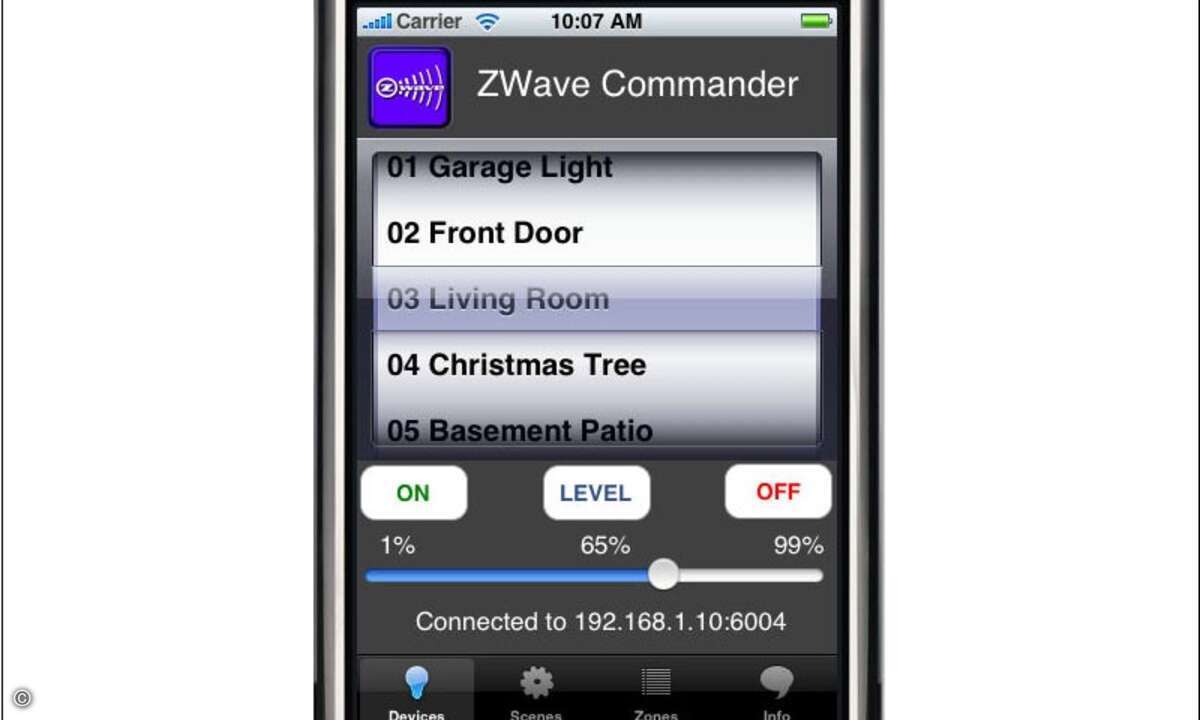Gebäudeeffizienz
Energiesparen in Gebäude lohnt sich, dort findet nämlich die größte Verschwendung statt. IT-Lösungen können gewissermaßen als Hirn einer intelligenten Steuerung dienen, allerdings steht dazu zunächst eine nichttriviale Datensammlung aus den verschiedensten Gewerken an. IBM kooperiert dazu mit Partnern zum Beispiel aus der Gebäudeleittechnik und setzt auf seine Maximo-Software.
Unter dem Motto „Smarter Planet“ entwirft IBM derzeit die Vision einer intelligent vernetzten
Welt, deren Herausforderungen mit Lösungsansätzen aus der eigenen Produktpalette in Verbindung mit
solchen der Partner gemeistert werden sollen. Teil dieser Strategie sind seit einem Jahr auch
Konzepte und Lösungen für den effizienteren und nachhaltigeren Betrieb von Gebäuden.
Der Bedarf an „Smarter Buildings“ ist unbestritten. Hagen Neulen, Business Solution Manager bei
IBM, nennt als Beleg Zahlen: Der Stromverbrauch für Gebäude macht danach weltweit 42 Prozent der
Gesamtmenge aus – die Hälfte davon wird verschwendet. Zudem seien Gebäude mit 15 Prozent
Verursacher Nummer eins von Treibhausgas. Auch die Wasserverschwendung in Gebäuden ist hoch, denn
die Hälfte des ins Gebäude kommenden Wassers fließt wieder ab. Nicht nur der Umwelt, sondern auch
dem eigenen Portemonnaie zuliebe muss etwas geschehen: 30 Prozent der Gesamtbetriebskosten für ein
Gebäude betreffen die Energie.
In einem Smarter Building sind, so Neulen, alle Komponenten angefangen von der Leittechnik bis
zur IT der Anwender sinnvoll vernetzt und arbeiten zusammen, um den Energie- und Wasserverbrauch,
Müllentsorgung und Abwasser effizienter und kostengünstiger zu gestalten. Die Input-Daten kommen
aus den Sensoren, die von Bewegung und Temperatur bis zu Luftfeuchtigkeit oder äußere
Wetterbedingungen alles überwachen, aber natürlich auch aus Zählerständen mit Verbrauchsdaten oder
Rechnungen aus den ERP-Systemen.
Was sich als Konzept schlüssig und relativ einfach anhört, birgt in der Realität des Alltags
mehr Fußangeln, als es auf den ersten Blick scheint. Die Datenleitungen – per Draht oder auch per
Funk – aus den verschiedenartigsten Gewerken des Bauwerks müssen zunächst einmal physisch an die IT
angebunden werden, was alles andere als ein triviales Unterfangen ist, denn auf dem Markt tummelt
sich ein ganzes Heer von Protokollen und Verfahren, die mitnichten in irgendeiner Form TCP/IP- oder
Ethernet-kompatibel sind. Bei der Einbindung bestehender Gewerke ist also meist eine Art Konverter
nötig – diese Gateway-Funktionalität überlässt IBM den Partnern, in diesem Fall zum Beispiel
Siemens, Honeywell, Johnson Controls, APC oder Emerson.
Aber selbst bei einem Neubau „auf der grünen Wiese“ ist die Gateway-Funktionalität gefragt. Der
Markt bietet zwar immer mehr Steuerungs-, Sensor- und Aktor-Devices mit IP-Anschluss, doch jede
Leuchtstoffröhre oder jeden Lichtschalter selbst damit zu versehen, hieße nach Einschätzung aller
Experten, über das Ziel hinauszuschießen.
Das logische Zusammenführen der Daten übernimmt dann wieder IBM selbst. Für ein einheitliches
Format sorgt eine Websphere-Schicht (Bild) als Integrations-Layer. Den zentralen Bestandteil eines
kompletten Systems stellt die Tivoli-Lösung Maximo Asset Management dar, mit der Funktion eines
klassischen Facility-Managements. Die Software speichert alle Daten zu dem Gebäude und behandelt
sie als Asset. Die Basis dazu bildet eine SOA-Architektur, was garantieren soll, dass sich auch die
komplexesten Gebäude und Liegenschaften effizient verwalten lassen.