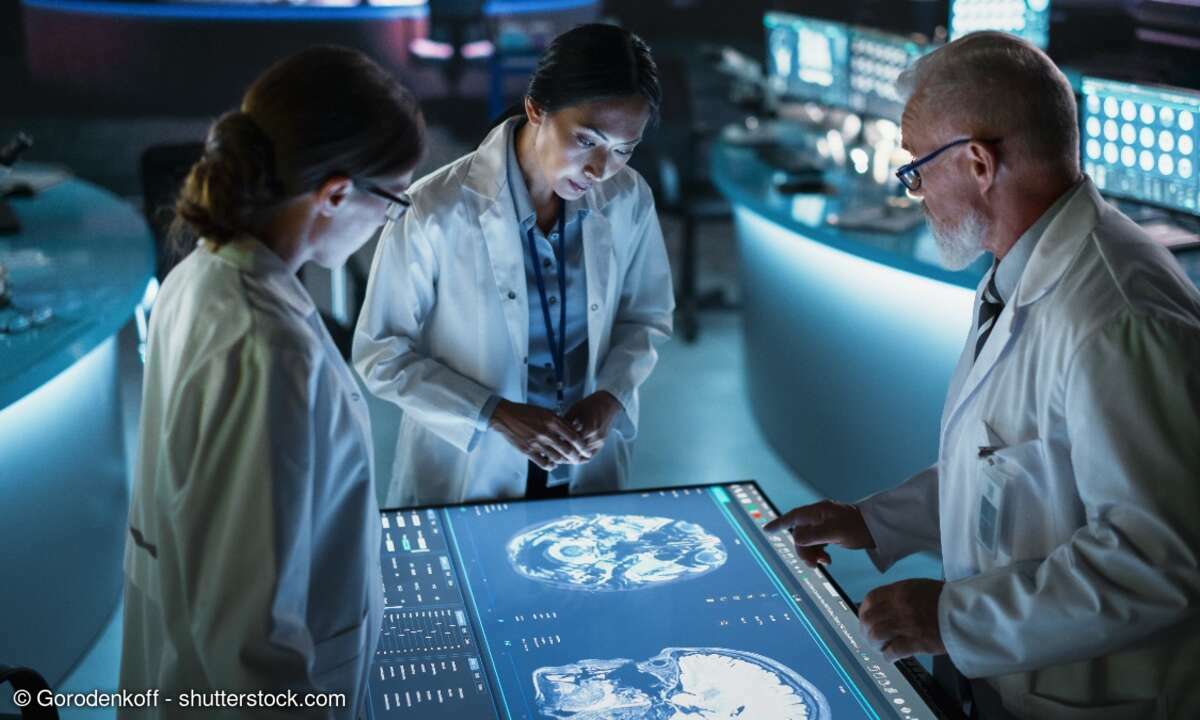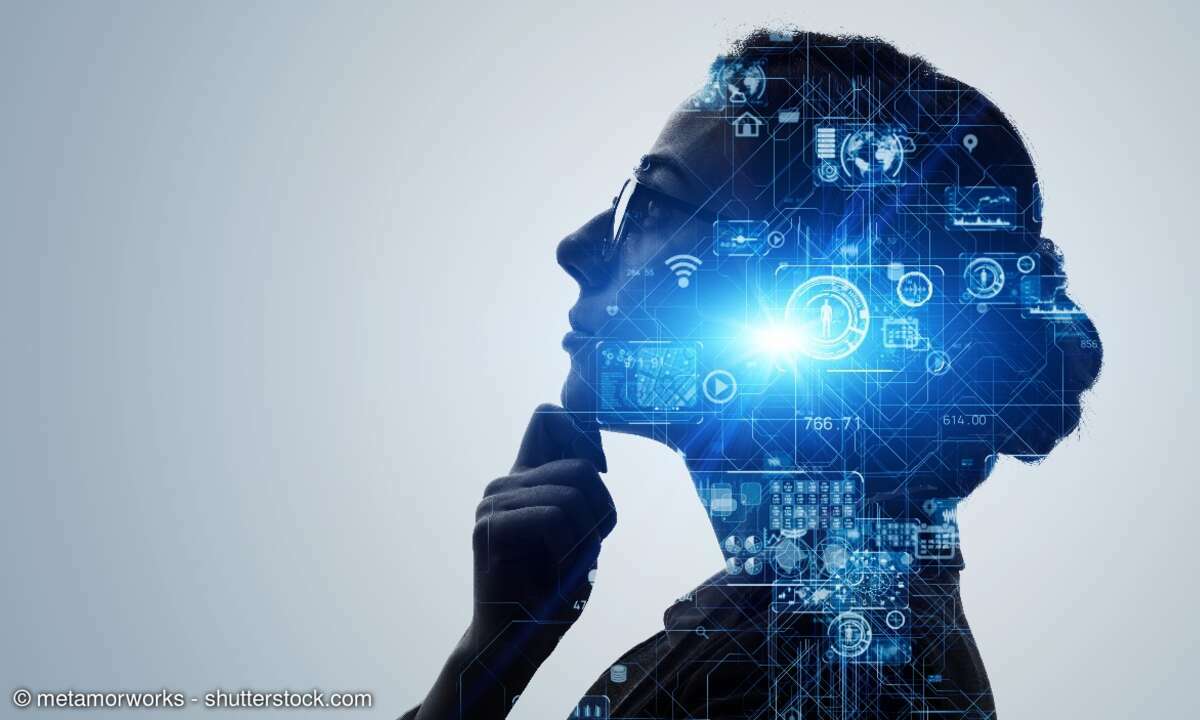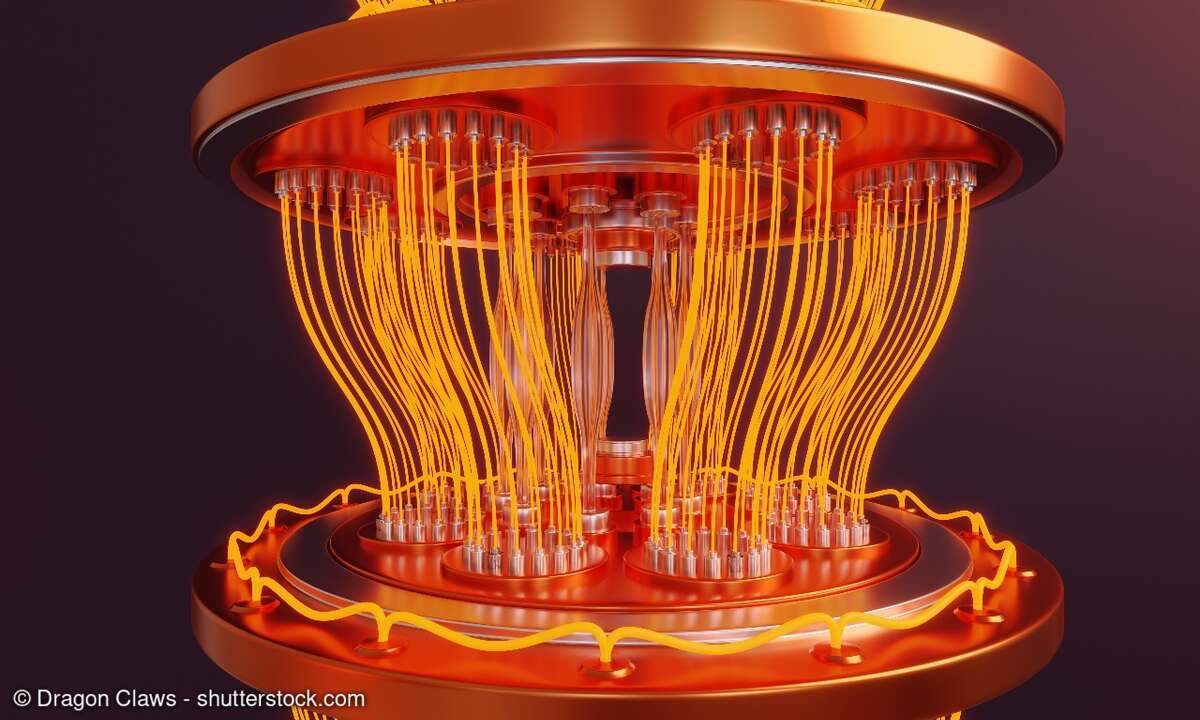Intelligente Lieferketten
Intelligente Lieferketten RFID-Chips vereinfachen nicht nur die aktuelle Verwaltung von Waren, sondern generieren auch planerisch relevante Daten. Business-Intelligence-Werkzeuge machen diese Informationen für geschäftliche Entscheidungen nutzbar.


Mit der Erkennung und Lokalisierung von Waren oder Packstücken durch Chips zur Radio Frequency Identification (RFID) können in Industrie, Logistik und Handel Personal- und Prozesskosten im Lager, in der Produktion oder der Filiale eingespart werden. Denn die Liefer- und Produktdaten auf den hauchdünnen Transpondern lassen sich ohne Sichtkontakt elektronisch erfassen. Das hilft beispielsweise, das Inventar im Lager oder den Inhalt eines Einkaufswagens an der Kasse zu erfassen, ohne die Waren dafür bewegen zu müssen. Seit die Preise der Funkchips in den letzten zwei, drei Jahren deutlich gesunken sind, investieren Unternehmen verstärkt in diese Technologie. So wurden im Jahr 2005 den Marktforschern von IDTechEX zufolge weltweit 600 Millionen RFID-Tags verkauft. Das Nutzenpotenzial der intelligenten Etiketten ist damit jedoch nicht ausgeschöpft. Per RFID erfasste Daten bei der Analyse von Prozessen und zur Steuerung des Unternehmens zu verwenden, ist künftig ebenfalls eine Möglichkeit dieser Technologie. Verborgenes Potenzial kann dadurch sicht- und nutzbar werden: Schwachstellen, Effizienz- und Abstimmungslücken in den Beschaffungs-, Produktions- und Logistikprozessen lassen sich so viel schneller erkennen. Mit der RFID-Technologie kann der Einzelhandel der Vision einer durchgängigen Steuerung und Kontrolle der gesamten Wertschöpfungskette einen wesentlichen Schritt näherkommen. Gleiches gilt für die mehrstufigen Lieferketten in der produzierenden Industrie. Mit RFID können Entscheider aus den Bereichen Produktentwicklung, Marketing oder Sortimentsplanung Daten über das Kaufverhalten ihrer Kunden gewinnen und so deren Bedürfnisse genauer erfassen. Beispiel Einzelhandel: Für eine optimale Versorgung der Verbrauchermärkte ist eine Abbildung aller Lieferprozesse nötig. Idealerweise werden alle aktuell laufenden Marketing-Aktivitäten direkt verknüpft – ausgehend von der Auslieferung eines Produktes über das Lager bis zum Point of Sale (POS) beim Einzelhändler. Um sicherzustellen, dass die Kunden die richtige Ware zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort vorfinden, müssen Daten zusammengefasst werden, die sich aus Fragestellungen ergeben wie: Wann verlässt eine Ware das Lager des Herstellers? In welcher Filiale läuft eine Marketing-Kampagne besonders erfolgreich? Wo und wann wird ein bestimmtes Produkt knapp? Wieviel Zeit wird für den Transport der Waren benötigt? In welcher Reihenfolge sollten Regionen und Filialen beliefert werden? Zumal in Zeiten des verschärften Wettbewerbs sind zufriedene Kunden das A und O, und leere Regale sind Gift für eine langfristige Kundenbindung.
Daten integrieren
Wollen Unternehmen RFID-Daten für die strategische Steuerung heranziehen, müssen sie sich allerdings zwei Aufgaben stellen. Zunächst sind sie gefordert, die immens großen Datenmengen, die durch RFID entstehen, zu verarbeiten und zu filtern. So erlauben es die smarten Chips, Warenströme in Echtzeit zu erfassen und auch Prozesse vor- und nachgelagerter Partner in der Lieferkette zu berücksichtigen. Damit entsteht ein Datenvolumen im Terabyte- oder sogar Petabyte-Bereich. Die Kette wird aber erst dann wirklich transparent, wenn die wichtigen von den unwichtigen Daten getrennt sind. Denn viele haben eine Funktion für die operativen Prozesse, sind jedoch für die Steuerung zu vernachlässigen. Es kommt also darauf an, die dispositiv relevanten Informationen herauszufiltern. Einen echten Mehrwert bringen die RFID-Daten nur, wenn sie für Auswertungen und Analysen aggregiert zur Verfügung stehen. Zum anderen müssen Unternehmen in der Lage sein, die RFID-Daten mit Informationen aus anderen operativen Systemen zusammenzuführen. Denn ein aussagekräftiges Gesamtbild der Lieferkette entsteht erst, wenn die RFID-Daten mit Daten etwa aus bestehenden Lösungen für Supply Chain Management (SCM), Customer Relationship Management (CRM) oder Enterprise Resource Planning (ERP) verbunden werden. Nur so sind die Entscheider in der Lage, die Wechselwirkungen innerhalb ihrer Geschäftsprozesse zu erkennen.
Auswertungen und Analysen
Viele Unternehmen setzen auf Lösungen aus dem Bereich Data Warehousing (DW) und Business Intelligence (BI), um für ihre Entscheidungen relevante Daten zusammenzustellen und auszuwerten. Solche Systeme können operative Daten gewissermaßen in strategisches Wissen verwandeln. Sie führen Informationen aus allen Unternehmensbereichen zusammen, so dass sich auch versteckte Ursache-Wirkungs-Beziehungen identifizieren, Trends aufspüren und Prognosen erstellen lassen. Die RFID-Technologie ist für ein solches entscheidungsunterstützendes System eine Datenquelle unter vielen und liefert zusätzliche Bausteine für das Gesamtbild des Unternehmens. BI-Werkzeuge können alle Prozessschritte abdecken, die nötig sind, um aus RFID-Daten strategisch relevante Informationen zu gewinnen – von der Bereinigung und Integration der Daten bis hin zur Analyse und Verteilung der Informationen. RFID-Daten lassen sich in Echtzeit in ein skalierbares Data Warehouse laden, ohne dass Schnittstellen programmiert werden müssen. Mit Regeln könne dafür gesorgt werden, dass nur die Daten übernommen werden, die die Anwender für ihre Analysen benötigen, versichert etwa Jörg Petzhold, Manager beim BI-Anbieter SAS. So reduziert sich das Datenvolumen erheblich, und es entsteht eine Basis, auf die die Anwender mit Analyseinstrumenten unterschiedlicher Art – von multidimensionalen Abfragen bis zu Data-Mining- und Forecasting-Verfahren – zugreifen können. Mit tiefer greifenden Analysen können die Fachanwender beispielsweise Muster im Kundenverhalten oder im Abverkauf der einzelnen Filialen erkennen – wichtige Anhaltspunkte für die regelmäßige Anpassung des Filialsortiments. Auch können die Manager bei Handelsketten etwa nachprüfen, welche Kundensegmente ein bestimmtes Angebot oder einen speziellen Service fordern und welche Filiale besonders davon betroffen ist. Transparenz in der Lieferkette hilft darüber hinaus, Verluste etwa durch Diebstahl oder Falschlieferungen zu vermeiden: Produzenten und Händler haben jederzeit die Möglichkeit, ihre Bestände zu überprüfen, auch wenn diese noch zwischen verschiedenen Standorten unterwegs sind. Analysewerkzeuge zur Betrugserkennung weisen auf Auffälligkeiten in der Lieferkette hin, so dass sie den Ursachen frühzeitig auf den Grund gehen und gegebenenfalls eingreifen können. So lassen zum Beispiel Stornos ohne Warenrücklauf vermuten, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit Unregelmäßigkeiten an der Kasse passieren.
Prognosen und Planungen
Verzahnt mit den Analyseinstrumenten sind Prognosewerkzeuge, die Trends frühzeitig erkennen und eine fundierte Planung ermöglichen. RFID-Daten können dabei eine wichtige Rolle spielen, geben sie doch Aufschluss über die Stationen der Lieferkette sowie Zeit, Ort und Umfang eines Verkaufs. Sortimentsplaner im Einzelhandel können mithilfe von Werkzeugen zur Absatzprognose sehen, welche Produkte zum Beispiel in einem halben Jahr wo nachgefragt werden. So ist sichergestellt, dass die entsprechenden Artikel rechtzeitig im Zentrallager beziehungsweise in der entsprechenden Filiale vorhanden sind. Bei produzierenden Unternehmen haben die Produktplaner darüber hinaus die Möglichkeit, die Produkte an sich verändernde Kundenbedürfnisse anzupassen. Und Umtausch- und Reklamationsdaten dienen außerdem dazu, Qualitätsmängel zeitnah zu erkennen und zu beheben. Mit Was-wäre-wenn-Szenarien lassen sich zudem Auswirkungen externer Faktoren auf Produktion, Konsum und Logistik simulieren – zum Beispiel die Erhöhung des Erdölpreises oder der Mehrwertsteuer, ein besonders heißer Sommer oder ein schneereicher Winter. Die Ergebnisse aus den Analysen und Prognosen lassen sich schließlich in Form von Berichten ad hoc oder vorkonfiguriert zur Verfügung stellen. Detaillierte Rollenkonzepte sorgen dabei für eine gesteuerte Informationsverteilung. »Das bedeutet, dass jeder Anwender genau die Informationen bekommt, die er für seine Aufgaben benötigt«, erläutert Petzhold. Letztlich führt die Integration von RFID-Daten mit anderen operativen Daten auf einer zentralen Plattform zu einem geschlossenen Kreislauf: Informationen aus den Analysen und Prognosen fließen mithilfe spezieller Fachanwendungen wieder in das operative Geschäft zurück.
Nadine Hoffmann ist Journalistin in München.