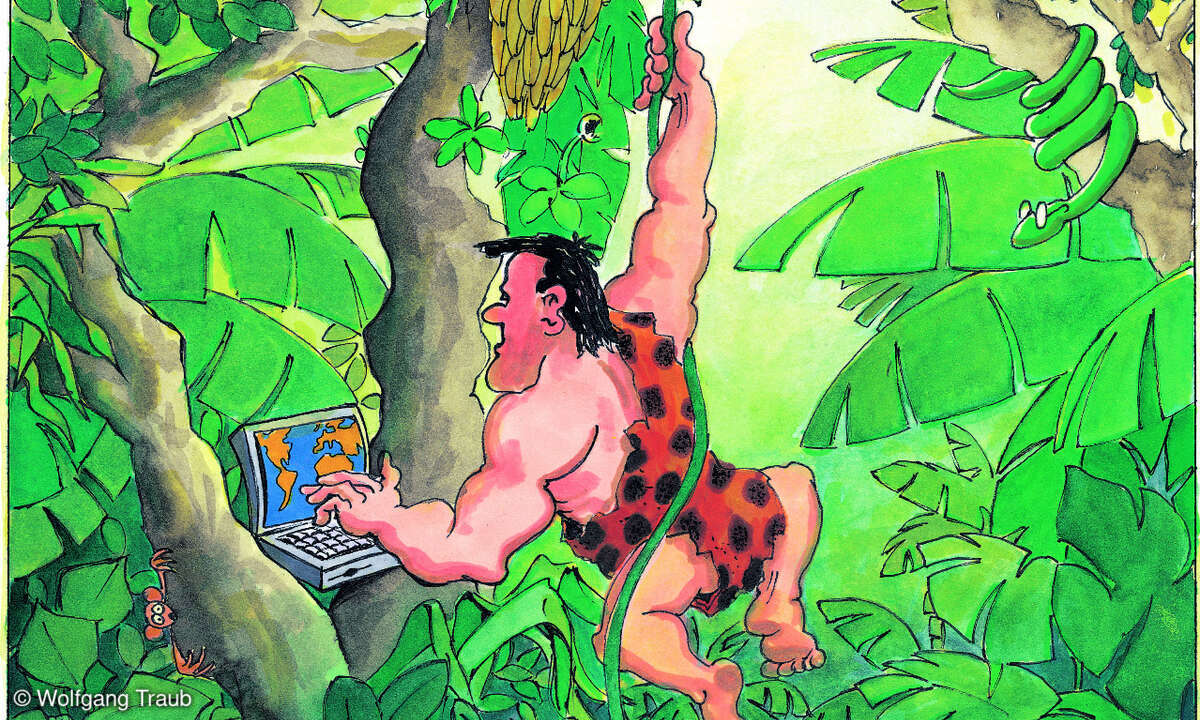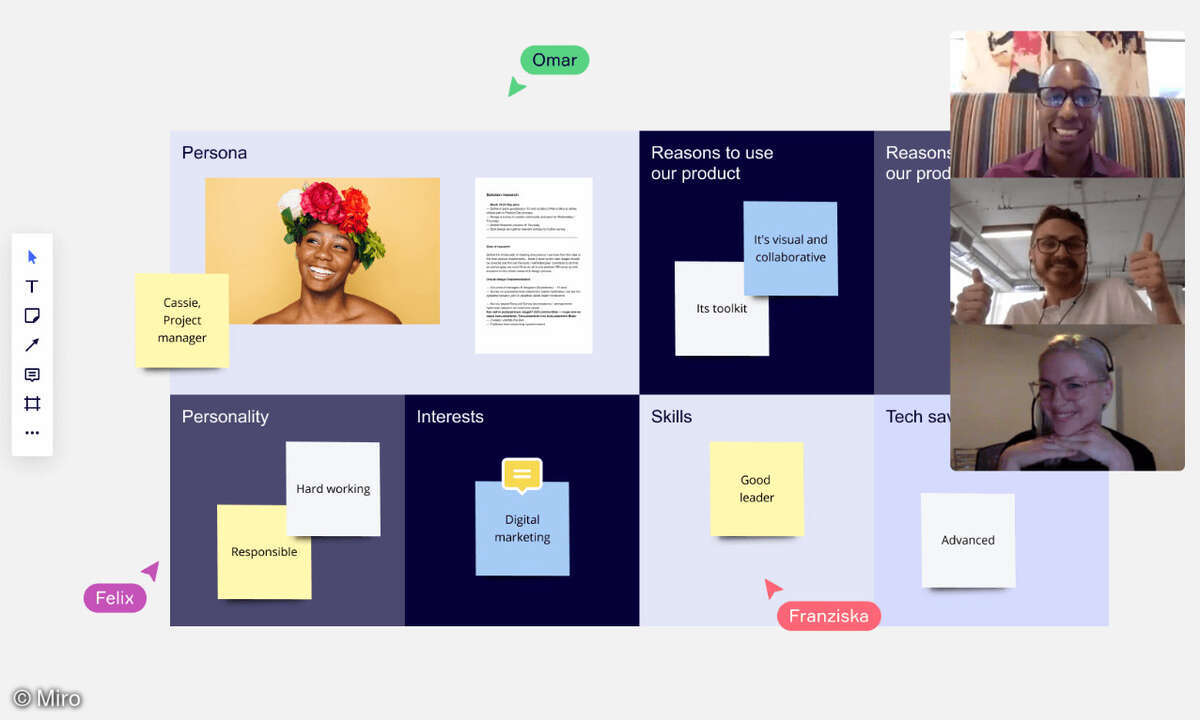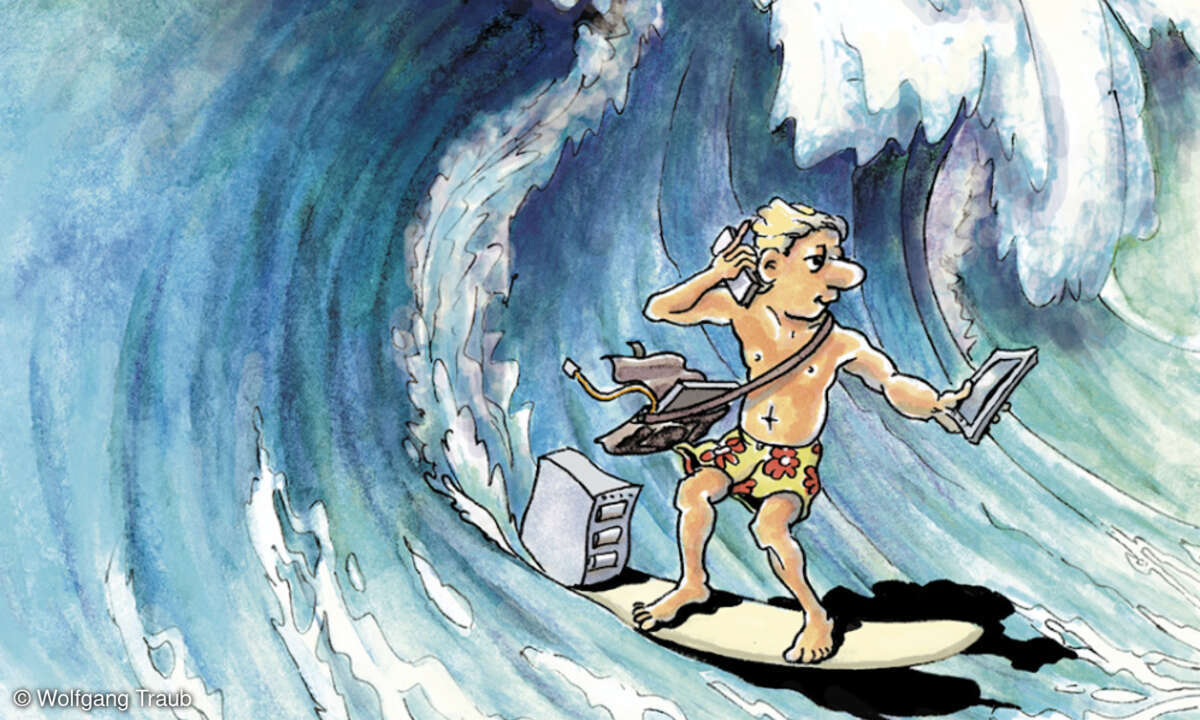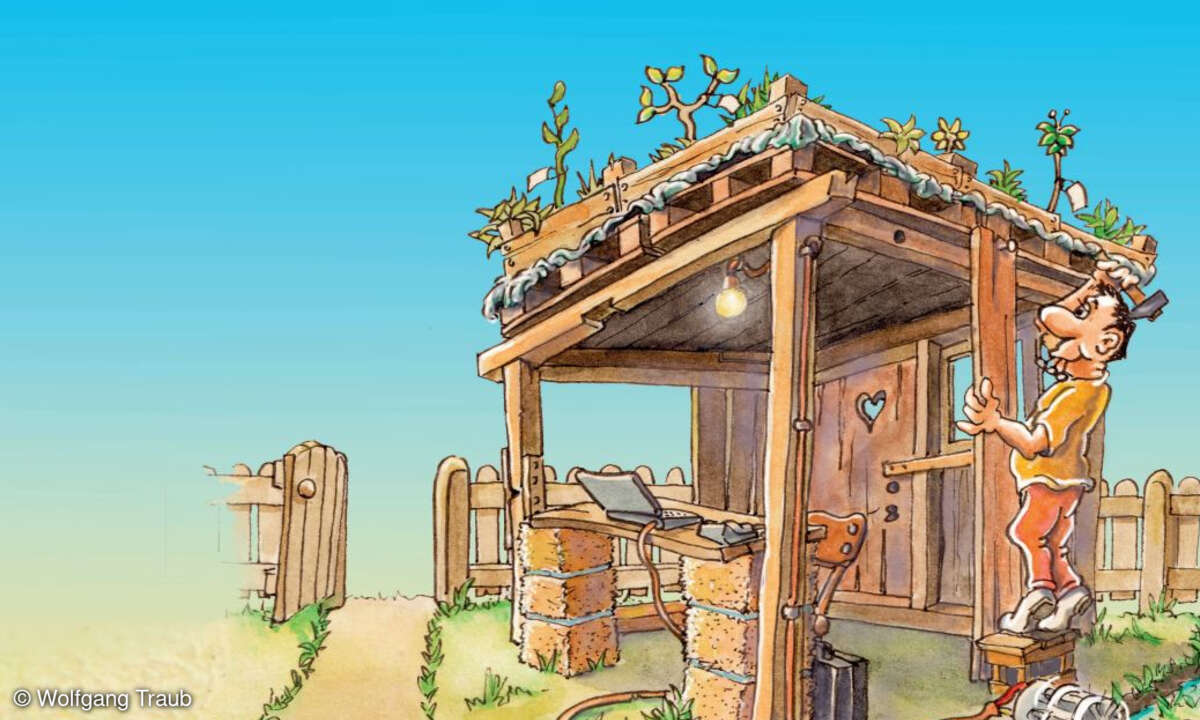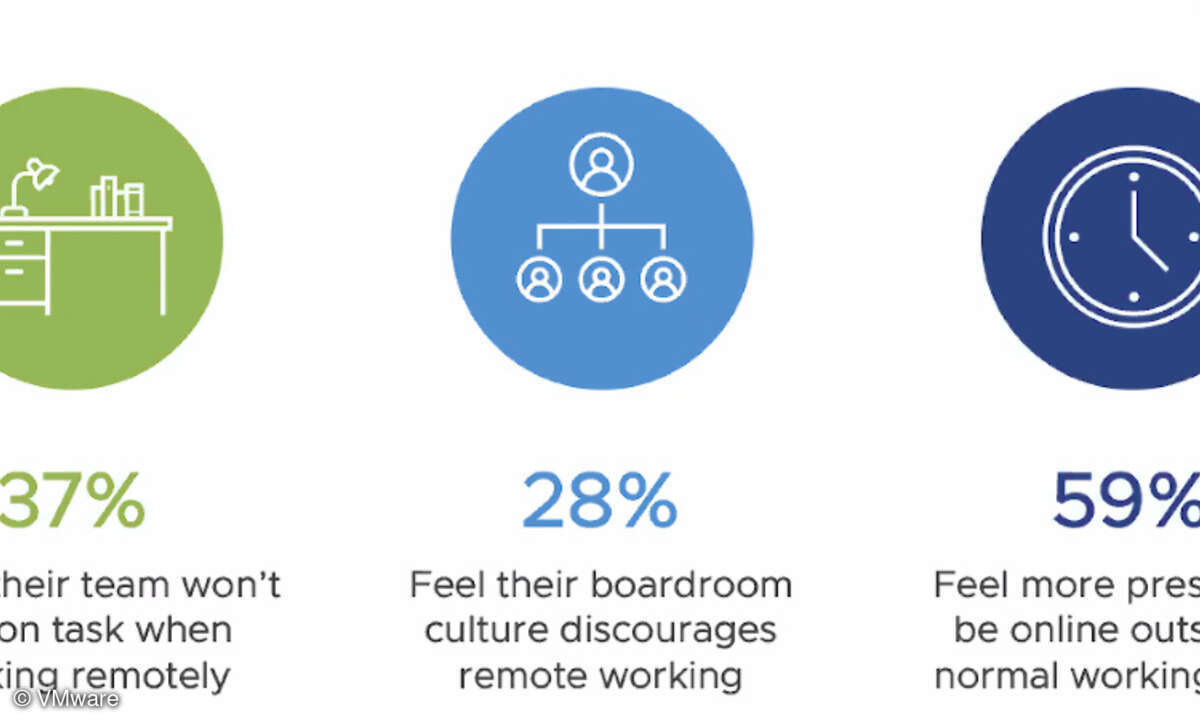Kürzung der Pendlerpausschale verstößt gegen Verfassung
Wann beginnt der Weg zur Arbeit? Am Werkstor, meint die Bundesregierung und kürzte daraufhin einen Teil der Pendlerpauschale. Zu unrecht, wie das niedersächsische Finanzgericht entschieden hat. Grund zum Jubeln haben Arbeitnehmer dennoch nicht.

Das niedersächsische Finanzgericht betrachtet die von der Koalitionsregierung vergangenes Jahr beschlossene Kürzung der Pendlerpauschale als verfassungswidrig und hat eine vom Lohn- und Einkommenssteuer Hilfe-Ring angestrengte Klage an das Bundesverfassungsgericht verwiesen. Der Verein zog für mehrere Mitglieder vor Gericht. Ausgesetzt und nach Karlsruhe verwiesen wurde nun die Klage eines berufstätigen Ehepaars (AZ: 8 K 549/06), dem ein niedersächsisches Finanzamt einen Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte zwar eingetragen hatte, allerdings erst für eine Strecke ab dem 21. Entfernungskilometer. Nach einem Koalitionsbeschluss im Sommer 2006 dürfen Arbeitnehmer die ersten 20 Kilometer Fahrstrecke zum Arbeitsplatz nicht als Werbungskosten steuerlich geltend machen. Der Gesetzgeber machte sich im Rahmen des Steueränderungsgesetzes für das so genannte Werkstorprinzip stark, demzufolge die Arbeit erst mit dem Betreten des Firmengeländes beginne. Werbungskosten könnten lediglich in Härtefällen geltend gemacht werden, wenn der Weg zur Arbeit mehr als 20 Kilometer betrage. Finanzminister Peer Steinbrück (SPD) will so Mehreinnahmen in Milliardenhöhe erreichen, gegen den Widerstand vom Bund der Steuerzahler sowie zahlreicher Lohnsteuervereine.
Nach Auffassung des niedersächsischen Finanzgerichts verstoße der Gesetzgeber gegen das vom Grundgesetz in Artikel 3 Absatz 1 verankerte Gleichbehandlungsgebot. Bei Fahrten zur Arbeit handele es sich nicht um freie Aufwendungen, sondern um zwangsläufige Kosten, die Arbeitnehmer tragen müssen, um Einkommen erzielen zu können. Sie müssen sich daher steuerlich senkend auswirken.
Das sieht der Bundesfinanzminister freilich anders. Ein Ministeriumssprecher wies lapidar darauf hin, dass Niedersachsen für solche Einschätzungen bekannt sei. Das letzte Wort hat nun das Bundesverfassungsgericht. Dem Sprecher zufolge korrigiere Karlsruhe »in der Regel« die Entscheidungen der niedersächsischen Gerichte. Steinbrück wird daher wohl weiter mit Mehreinnahmen von 2,5 Milliarden Euro rechnen können.