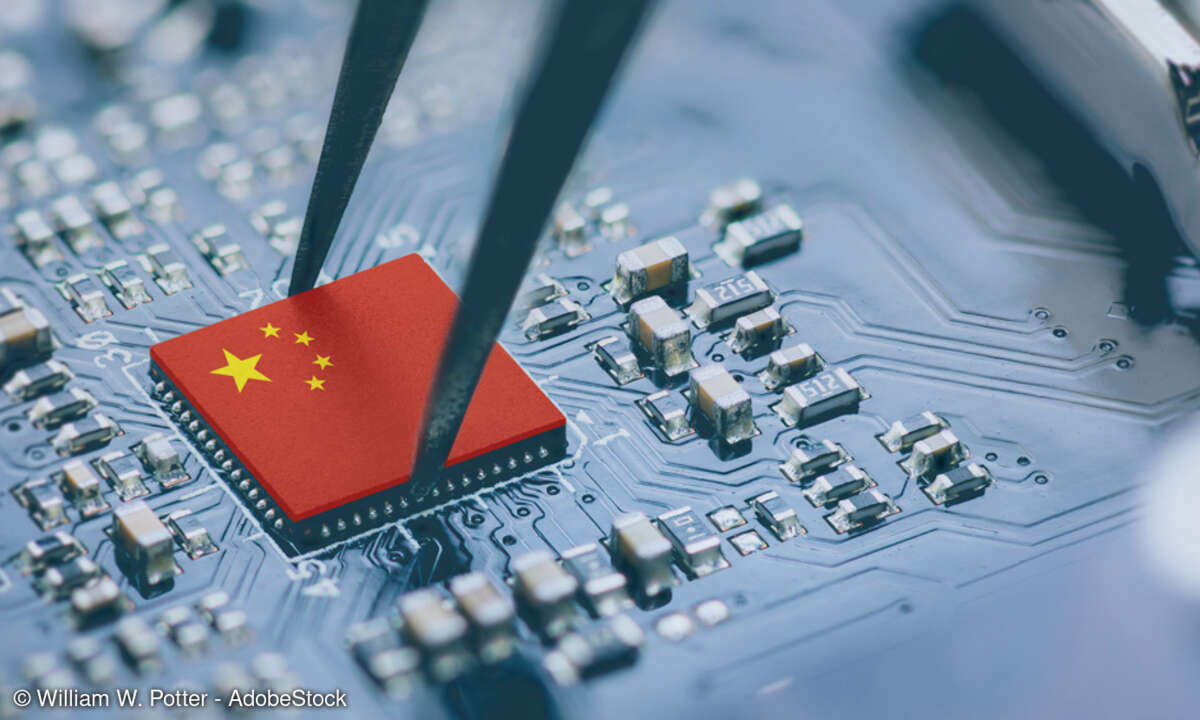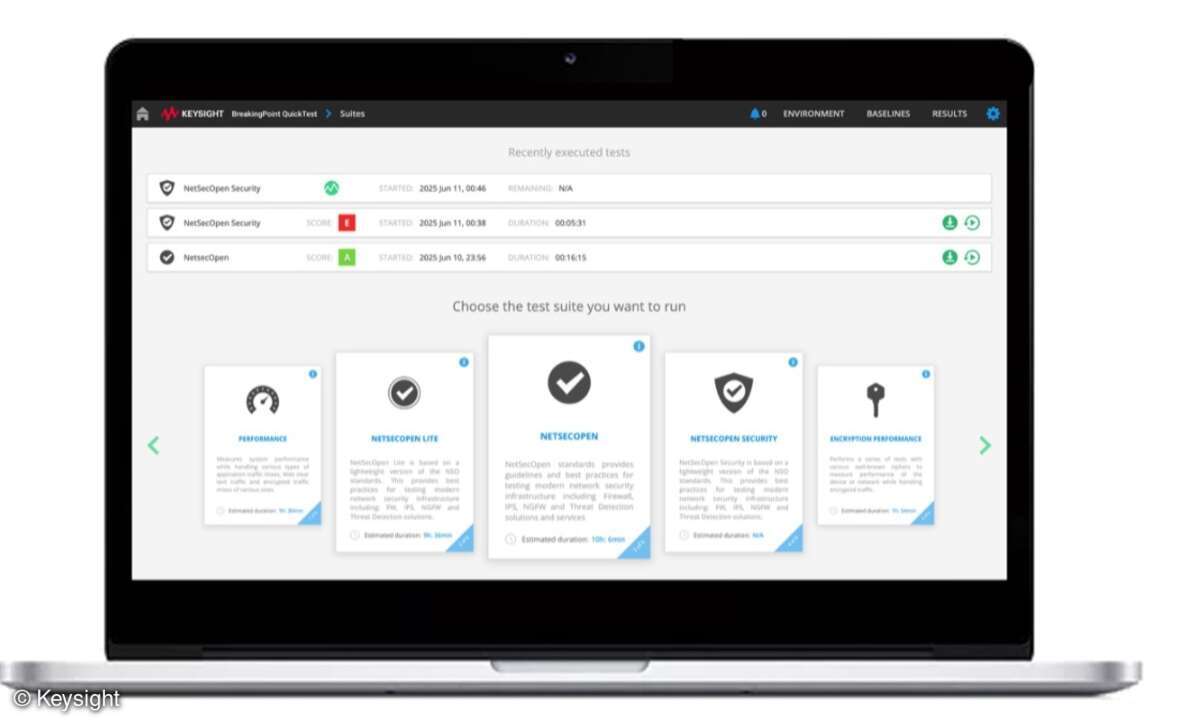Ohne Technik geht’s nicht
Gemäß dem Slogan "People, Process, Technology" ist der Einsatz geeigneter Technik für die Umsetzung von ITIL (IT Infrastructure Library) unabdingbar. Der Fokus liegt hier auf prozessunterstützender Software, also auf IT-Service-Management-(ITSM-)Tools. Klar muss sein: Die Einführung eines Prozesses erfordert mehr als nur die Anschaffung eines neuen ITSM-Werkzeugs.
In der Theorie ist der gangbare Standardweg klar vorgezeichnet: Zuerst kommt der Prozess, dann die Technik. In der Praxis findet man häufig eine andere Situation vor: Die Technologie folgt hier selten dem Prozess, da in der Regel oft schon verschiedene Tools im Hause vorhanden sind. Ist tatsächlich eine Neuanschaffung geplant oder war bisher kein Werzeug im Einsatz, kann dennoch - mehr oder weniger unterschwellig - eine gewisse Präferenz bezüglich eines ITSM-Tools vorherrschen. In aller Regel jedoch wird man nicht an der Evaluierung einer Lösung vorbeikommen.
Kernfaktoren der Evaluierung
Inwieweit ist eine Evaluierung eigentlich neutral? In jedem Unternehmen gibt es versteckte Motivationen, eine Evaluierung bewusst oder unbewusst zu steuern. Dabei zieht man gerne externe Berater hinzu, zumal zur Neutralität die Erfahrung aus anderen IT-Umgebungen vorteilhaft ist. Die Erfahrung interner Mitarbeiter ist hingegen auch durch einen externen Berater nicht zu schlagen. Theoretisch sind dies ideale Voraussetzungen für den Vergleich von IT-Service-Management-Systemen für den hauseigenen Einsatz. Dieser vermeintliche Vorteil schwindet jedoch sogleich mit der häufig beobachteten Tendenz, bestehende Systeme (und den damit verbundenen Einfluss auf diese) zu behalten. Auch die bereitzustellende Infrastruktur ist bei der Evaluierung zu berücksichtigen. Interne Mitarbeiter neigen auch hier dazu, prozessferne Bereiche aus der Betrachtung auszuklammern.
Eine Evaluierung im Tool-Sektor erfolgt analog zur Priorität der Faktoren in der Praxis meist nach folgendem Schema: Nach der Festlegung des Funktionsumfangs und der Beurteilung des Funktionserfüllungsgrads erfolgt eine Berechnung der zu erwartenden effektiven Kosten bis zur Einsatzreife.
Die Einschätzung der über die Softwarelösung hinausgehenden Kompetenz des Herstellers wird in der Regel nachrangig durchgeführt. Wichtig, wenngleich oft übersehen, ist eine Beurteilung des Know-hows und der Erfahrung des Herstellers in der Prozessberatung und -umsetzung, zumal ein ITSM-Tool die Prozesse maßgeblich und dauerhaft unterstützen soll. Nicht zuletzt ist neben der ITIL-Zertifizierung des Werkzeugs auch die Frage interessant, wie "lebendig" die Software eigentlich ist.
Unternehmen evaluieren ständig. Was häufig gemacht wird, birgt aber auch die Gefahr, ebenso häufig falsch gemacht zu werden. Oft wird unter jedem erdenklichen Aspekt getestet und gegeneinander abgewogen - in der Regel von technisch orientierten Personen, Administratoren und Entwicklern. Daher ist es nicht verwunderlich, dass gerade die Ergonomie als absolut wichtiger Faktor oft vernachlässigt wird. Ergonomie sollte jedoch bei der Evaluierung klar mit im Fokus stehen. Wie bereits im ersten Teil dieser Serie ("Der Faktor Mensch",
www.lanline.de/kn31708487) beschrieben, entscheidet diese letztlich über die dauerhafte Akzeptanz eines Tools im Praxisbetrieb.
So sollte man es sich nicht nehmen lassen, im Zuge einer Evaluierung auch Referenzimplementierungen zu begutachten. Allerdings ist die Gefahr groß, sich hier blenden zu lassen. Hersteller haben mit ihren Referenzkunden oft feste Abkommen, was die Präsentation der Lösung im Rahmen einer solchen Begutachtung betrifft. Man entgeht diesem Problem, wenn man sich einen solchen Betrieb wann immer möglich live ansieht und mit ausführenden, also in den Prozess involvierten Mitarbeitern spricht. So kann man sich aus erster Quelle darüber informieren, was sich in der Praxis als schlecht herausgestellt und was sich bewährt hat. Dass diese Einschätzungen einer gewissen Subjektivität unterliegen, versteht sich von selbst.
Dennoch lassen sich oft genügend Faktoren identifizieren, die für die eigene Entscheidung hilfreich und letztlich ausschlaggebend sind. Ein undogmatischer, aber nicht minder praxisrelevanter Ansatz wäre das folgende Vorgehen: Nachdem man primär die Ergonomie und damit die effiziente Unterstützung der Mitarbeiter evaluiert, geht man eine möglichst übergreifende Untersuchung des Funktionsumfangs und der speziellen Funktionalitäten des Tools an. Dabei sind nicht nur die tatsächlich im Unternehmen benötigten, sondern auch die so genannten "stillen" Funktionen in Betracht zu ziehen. Denn in der Regel ist zu erwarten, dass mit dem Einsatz einer Software sukzessive die Anforderungen an diese steigen.
Meist wird der Faktor "Kosten und Kosteneffizienz" (inklusive aller Lizenz-, Projekt- und Wartungskosten) nicht ausreichend und im gesamten Kontext betrachtet. Nicht selten stellt damit eine Budgetüberschreitung das gesamte Projekt letztendlich in Frage.
Gegenwärtig ist ein regelrechter Hype um webbasierte Applikationen zu beobachten. Dies ist vor dem Hintergrund wachsender Flexibilität und zunehmender Vernetzung durchaus konsequent, braucht man doch zur Anbindung eines "Clients" lediglich den richtigen Browser und eine ausreichend gute Netzwerkverbindung. Häufige Ladezyklen - unvermeidbar bei webbasierten Lösungen - bewirken häufig subjektiv unregelmäßige Reaktionszeiten, die der Bediener als Unhandlichkeit wahrnimmt. Nicht-webbasierte Lösungen erfordern die durchgängige Installation proprietärer Client-Software, und oft wird auch die Anpassung an eine geeignete Plattform notwendig sein. Zweifelsohne sind dies Mehrkosten, die vordergründig betrachtet im Vergleich zur webbasierten Lösung vermeidbar wären.
Nicht zu vergessen sind auch die Kosten für Betrieb und Administration, die bei beiden Varianten höchst unterschiedlich ausfallen können. Dabei spielt der Aufwand für die Ausbildung oder Umschulung von Administratoren ebenso eine Rolle wie die Kosten für die Implementierung einer neuen Betriebsplattform, gegebenenfalls inklusive der Kosten für neue Hardware, Software und Datenbanken.
Ein weiterer wesentlicher Faktor liegt im Support. Gerade hier zahlt sich ein besonders kritischer Blick aus, denn für die nachhaltige Effizienz des Tools wird nicht zuletzt auch die Schnelligkeit und Verfügbarkeit oder Erreichbarkeit des Hersteller-Supports entscheidend sein. Gibt es Support nur per Mail oder ist auch mehrsprachiger telefonischer Support möglich? Hier sollte man sich von der tatsächlichen Leistung und nicht vom Branding des Herstellers leiten lassen. Eine gute Entscheidungshilfe erhält man durch Test und Evaluierung des Hersteller-Supports noch während der Evaluierungsphase.
Unterschiedliche Lösungskonzepte
Betrachtet man den Einsatz gängiger, praxiserprobter Tools, so kann man zwei Produktphilosophien erkennen: Zum einen gibt es das "Best of breed"-Prinzip, gemäß dem die jeweils beste Lösung (also das beste Helpdesk-Tool, die beste CMDB-Lösung etc.) zum Einsatz kommt. Zwangsläufig resultiert daraus eine gewisse Heterogenität der ITSM-Landschaft, die man jedoch in Kauf nehmen muss. Als Alternative kann man dem Konzept "All in one" folgen. Dies sind meist umfangreiche Tools von nicht minder großen Herstellern - eine Lösung, die vorzugsweise von großen Firmen gewählt wird, zumal sie oft auch mit einem deutlich höheren Kostenniveau verbunden ist. Dafür liegt hier insbesondere mit Blick auf die Ergonomie der Vorteil der Einheitlichkeit auf der Hand. Bei beiden Ansätzen ist genau abzuwägen, in welchen Customizing-Aufwand man bereitwillig investieren will. Dabei ist zu bedenken, dass gerade der Aufwand zur Einführung einschließlich eines Customizings zu Beginn oft unterschätzt wird.
Es wird weiterhin unterschieden zwischen einer dem Tool immanenten Entwicklungsumgebung, die volle Flexibilität gewährleistet, und einer Spezialanwendung, die die wichtigsten Funktionen bei eingeschränkter Anpassungsfähigkeit abdeckt. Erstere Lösungen gehen meist mit der Verwendung einer proprietären Skriptsprache einher. Die Möglichkeit etlicher Tools, die Bedienoberfläche frei zu modifizieren, birgt die Gefahr, "gebastelte" Oberflächen zu erzeugen. Schlechte Ergonomie ist die Folge. Fällt die Entscheidung zugunsten einer Lösung mit maximaler Flexibilität, so ist zu bedenken, dass gerade diese auch entsprechende Nachteile mit sich bringen kann.
Fazit
Die Auswahl eines ITSM-Tools ist eine vielschichtige Angelegenheit. Der Aufwand einer gründlichen Evaluierung zahlt sich jedoch aus, da der Einsatz dieser Werkzeuge mit einer langfristigen Bindung einhergeht. Zwar raten Fachleute einerseits von einer Evaluierung lediglich auf Basis reiner Funktionslisten ab; andererseits ist manchmal auch der Mut gefragt, sich pragmatisch für eine nicht ganz perfekte Lösung zu entscheiden: Das Tool erfüllt zwar nicht alle Funktionsanforderungen, dafür aber die entscheidenden. Um die notwendige neutrale Perspektive zu erhalten, ist ein externer ITIL-Berater dringend zu empfehlen. Auch fällt die Trennung von "Altlasten" leichter, wenn eine externe Sichtweise zum Tragen kommt.