Saft ohne Störung
Buyer’s Guide: Unterbrechungsfreie Stromversorgungen – Komplette Stromausfälle mögen in einem modernen Netz selten sein. Doch Schwankungen gehören zum Alltag, und ohne Filterung durch eine USV können EDV-Komponenten erheblichen Schaden nehmen.
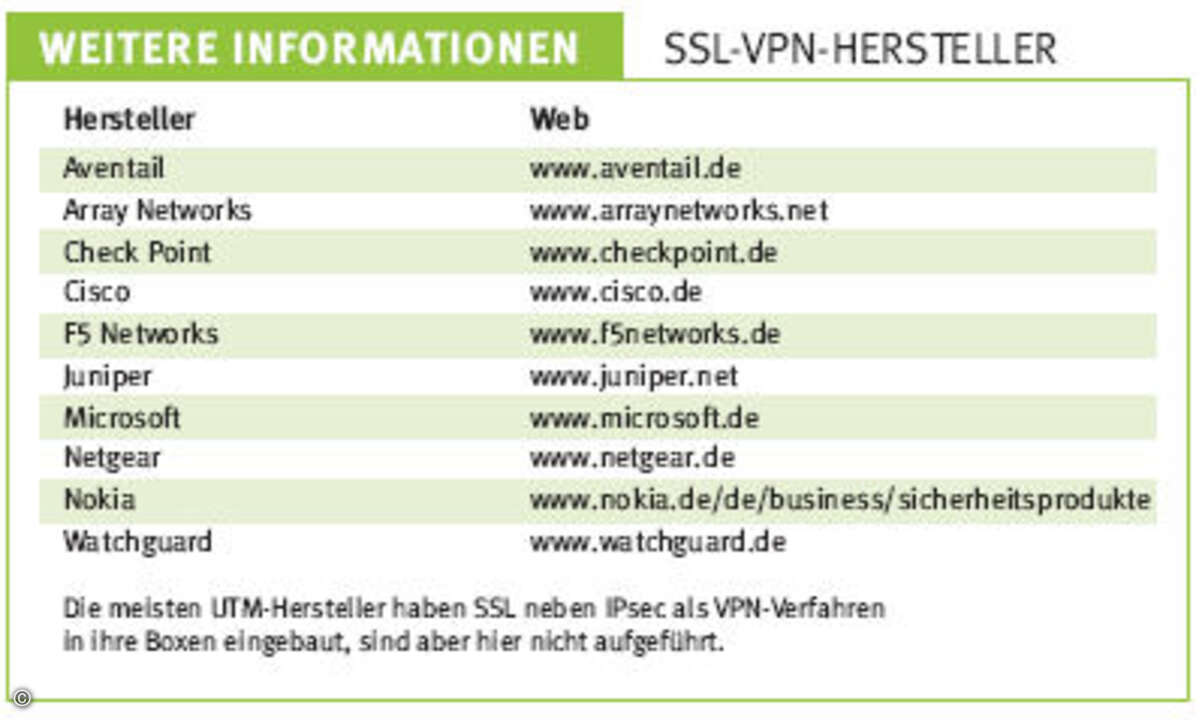
Marketingstrategen erfinden in der Regel für jede noch so nebensächliche Technologie ein klingendes Schlagwort. Bei »unterbrechungsfreie Stromversorgung« versagten die Wortakrobaten allerdings. Viele Anwender denken daher noch immer, eine USV diene ausschließlich dafür, um Geräte bei einem Komplettausfall des Netzes am Laufen zu halten. Der Blackout ist im Mittel aber nur einer von zehn Fällen, in welchen die Elektronik einer modernen USV zum Schutz des Verbrauchers einspringt. Bei den anderen neun Einsätzen korrigiert die USV Störungen aus dem Netz, welche den Verbrauchen auf lange Sicht oder auch kurzzeitig Schaden zufügen. Leider kann man diese neuen Problemfälle weder sehen, noch hören oder riechen. Der unerklärliche Absturz eines PCs oder der Ausfall einer RAM-Bausteins rührt oft von Netzstörungen her. Allerdings bemerkt der Anwender das nicht und kann daher keine Parallelen zwischen Netzfehler und Hardware-Ausfall feststellen. Die richtige USV filtert Störungen und Schwankungen aus dem Netz und sorgt dafür, dass die angebundenen Verbraucher mit sauberem Strom versorgt werden. Korrekterweise müsste man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung daher als »störungsfreie Stromversorgung« bezeichnen.
Wer behelligt wen
Rein theoretisch liegt an einer Steckdose im deutschsprachigen Raum eine Spannung von 230 Volt Wechselstrom bei 50 Hz Taktfrequenz an. Soweit die Theorie. In der Praxis schwanken sowohl Frequenz als auch Spannung um einige Prozent. Laut Versorger ist das auch so zulässig, denn der Stromanbieter selbst hat auf einen Großteil der auftretenden Störungen überhaupt keinen Einfluss. Störungen im Netz kommen in der Regel gar nicht von außen, sondern von den Verbrauchern selbst. Viele schlecht verarbeitete oder alte Maschinen senden Störungen zurück ins Netz und damit zu allen anderen Verbrauchern. Induktivlasten verzögern den Spannungs- gegenüber dem Stromverlauf, und das Zu- oder Abschalten großer Verbraucher sorgt für Spannungseinbrüche oder Spitzen. Erst in den vergangenen Jahren führte der Bund immer strengere Normen für Elektroartikel ein. Moderne Geräte müssen primärseitige Filter einsetzen, damit keine Oberwellen oder Spannungsschwankungen zurück ins Netz gelangen. Doch nur ein Teil der Geräte hält die strengen Normen ein. Gerade die billigen Fernost-Schaltnetzteile von Computern, Halogenlampen oder sonstigen Hifi-Geräten sorgen für unsaubere Stromnetze. Somit wird klar, dass in großen Bürogebäuden mit Hunderten von PCs, Druckern und Monitoren gar keine saubere Spannung an den Steckdosen anliegen kann. Auch im Small- oder Home-Office sieht die Lage nicht besser aus. Altbauten mit dünnen Leitungen und stromhungrige Haushaltsgeräte wie Wasch- und Spülmaschinen, Herde und Mikrowellengeräte sorgen für ein reichliches Durcheinander in den Steckdosen.
Viele Anwender meinen noch immer, Computer seien weitgehend resistent gegen Störungen aus der Steckdose. Nicht selten kommt es vor, dass bei einem besonders kurzen Stromausfall der Fernseher abschaltet und das Licht flackert, der PC jedoch weiterläuft. Es läge also verlockend nahe, daran zu glauben, dass das Schaltnetzteil des PCs selbst Filter genug ist. Rein theoretisch könnte man die PC-Netzteile mit wirkungsvollen Filtern versehen. Aber das kostet extra, und wie in so vielen anderen Bereichen gilt auch bei den PC-Netzteilen: Hauptsache billig. Ein 400-Watt-PC-Schaltnetzteil kostet gerade mal 50 Euro. Mit herkömmlicher Netzteiltechnik bekommt man für dieses Geld nicht einmal den passenden Trafo, geschweige denn eine brauchbare Regelelektronik.
Störungen auf der Primärseite eines Schaltnetzteils können je nach Dauer oder Frequenz die Elektronik ziemlich durcheinander bringen. Das führt im Zweifelsfall dazu, dass eine Spannungsspitze oder -Senke an der Primärseite auch eine Spitze oder Senke auf der Sekundärseite hervorruft. Eine kurzfristige Über- oder Unterspannung schadet noch keiner Komponente. Muss ein Dimm oder die Elektronik einer Festplatte sehr häufig solche »Wackler« ertragen, kommt es zu Ausfällen.
Schutz vor diesen Einflüssen bieten unterbrechungsfreie Stromversorgungen. Allerdings gibt es da eine unüberschaubare Vielzahl von Geräten und Technologien, sodass der Anwender nur selten weiß, welches Gerät er überhaupt braucht.
Abhängig oder unabhängig
Bislang mussten Administratoren sich mit Technologiebezeichnungen wie Standby, Line-Interactive oder Online herumschlagen. Jetzt gibt es eine EU-Norm EN 50091-3 (IEC 62040-3) zur Klassifizierung von USV-Anlagen. Diese definiert drei Typen: VFD (»Voltage and Frequency Dependent«), VI (»Voltage Independent«) und VFI (»Voltage and Frequency Independent«).
VFD-Geräte offerieren nur einen geringen Schutz. In diese Klasse fallen passive Filter, wie man sie ab und zu in Steckdosenleisten vorfindet. Ohne elektronisch regelbare, aktive Filter und einen Batteriepuffer können diese Systeme nur wenige Störungen zuverlässig korrigieren. Zu VFD-Geräten zählen auch Billig-USVn, die als Offline- oder Standby-Geräte im Handel zu finden sind. Hier schaltet die Maschine einfach auf Batterieversorgung um, wenn die Eingangsspannung für einen Zeitraum von etlichen Millisekunden außerhalb der Toleranzwerte liegt. Störungen innerhalb des erlaubten Spannungsfensters rauschen durch diese USV ebenso hindurch wie kurzfristige Spitzen und Aussetzer. VFD-Geräte eignen sich nicht zum Schutz von Computeranlagen, weder im Büro, noch im Home-Office. Ihre Schutzwirkung ist zu gering.
VI-Geräte kennen viele Anwender als »Line-Interactive«-USVn. Diese Geräteklasse überwacht permanent die Eingangsspannung und kann mit elektronischen Filtern eine ganze Reihe von Störungen ausmerzen. Bei Unterspannungen kann eine VI-UPS Strom aus der Batterie zufüttern. Dieses Verfahren arbeitet mit relativ geringen Verlusten und hat sich im unteren Preis- und Leistungssegment etabliert. VI-Anlagen reichen aus, um einzelne Server und Gruppen von Arbeitsstationen abzusichern. Die Geräte dieser Klasse bieten Hersteller typischerweise bis zu 1 KVA Leistung an. Bei höheren Strömen fällt die Regelelektronik dann so teuer aus, dass es kaum einen Preisvorteil gegenüber der VFI-Geräteklasse mehr gibt. Frequenzschwankungen kann eine VI-USV nicht kompensieren.
In die VFI-Klasse fallen Doppelwandler oder Online-Anlagen. Diese Geräte koppeln den Sekundärteil der USV gänzlich vom Netz ab. Eine Ladeelektronik füllt die Akkumulatoren der USV. Ein Wechselrichter entnimmt den Strom aus den Batterien und erzeugt daraus die Sekundärversorgung. Eine direkte Verbindung zwischen Primär- und Sekundärseite gibt es nur dann, wenn die USV bei Überlastung auf Bypass-Betrieb schaltet. VFI-USVn arbeiten weniger effizient als VI-Anlagen. Die beiden Wechselrichter verbraucht selbst permanent Strom.
Damit sich Doppelwandler-Geräte kosteneffizient einsetzen lassen, muss die Leistung des Geräts sehr nahe am tatsächlichen Stromverbrauch liegen. Je stärker ausgelastet die VFI-USV arbeitet, desto geringer fällt der prozentuale Verluststromanteil durch die eigene Elektronik aus. Es ist nicht sinnvoll, eine 6-KVA-Anlage in einer kleinen Serverfarm mit 2-KVA-Verbrauch einzusetzen. Online-USVn eigenen sich zum Schutz von Serverracks und ganzen Servergruppen. Dank des permanent aktiven Wechselrichters benötigen VFI-USVn einen Lüfter für die Kühlung. Daher findet man diese Geräte nicht in der Desktop-Klasse.
Richtig herunterfahren
Bevor die Batterie zur Neige geht, muss die USV den angeschlossenen Computern mitteilen, dass die Versorgung bald endet. So bleibt den angebundenen Rechner Zeit genug, einen ordentlichen Systemabschluss durchführen. USVn kommunizieren via serieller Schnittstelle, USB oder LAN mit einem Rechner. Oft setzen die Hersteller Server-fähige Software auf dem PC mit der Direktverbindung zur USV ein. So kann der PC, welcher mit der USV kommuniziert, weitere Maschinen über das LAN informieren. Größere Anlagen offerieren eine SNMP-Karte als Sonderzubehör. Kaum ein USV-Hersteller schreibt die Monitoring-Software für seine Geräte selbst. Hier muss der Anwender aufpassen, was er überhaupt im Lieferumfang enthält. Oft legen USV-Hersteller dem gerät nur zeitlich limitiert lauffähige Testversionen einer USV-Software bei. Die USV-Softwarehersteller verlangen dann oft horrende Lizenzgebühren. Gut zu wissen, dass sowohl Windows als auch Linux USV-Dienste kostenlos mitliefern, welche die seriellen Protokolle vieler USV-Hersteller verstehen. Wichtig dabei ist aber auch, dass der PC der USV mitteilen kann, dass er einen Shutdown eingeleitet hat. Dann muss die USV auf jeden Fall die Sekundärseite kurz abschalten, selbst wenn der Strom genau in diesem Moment zurückkehrt.
Fazit: Server und Arbeitsplätze, die wichtige Daten beherbergen und entscheidende Dienste ausführen, benötigen den Schutz einer USV. Dabei empfehlen sich VI-Systeme für Clients und kleine Serverinstallationen. Größere EDV-Anlagen mit mehreren Servern sollten IT-Verwalter über eine oder mehrere VFI-USVn absichern.
ast@networkcomputing.de












