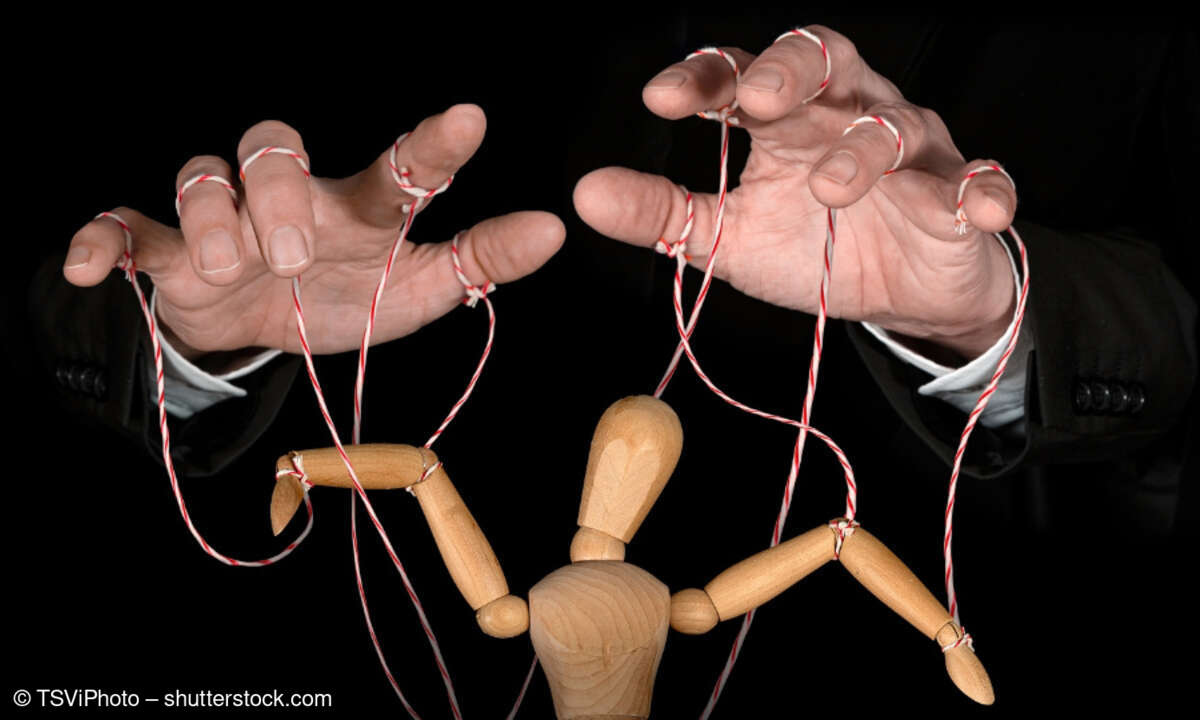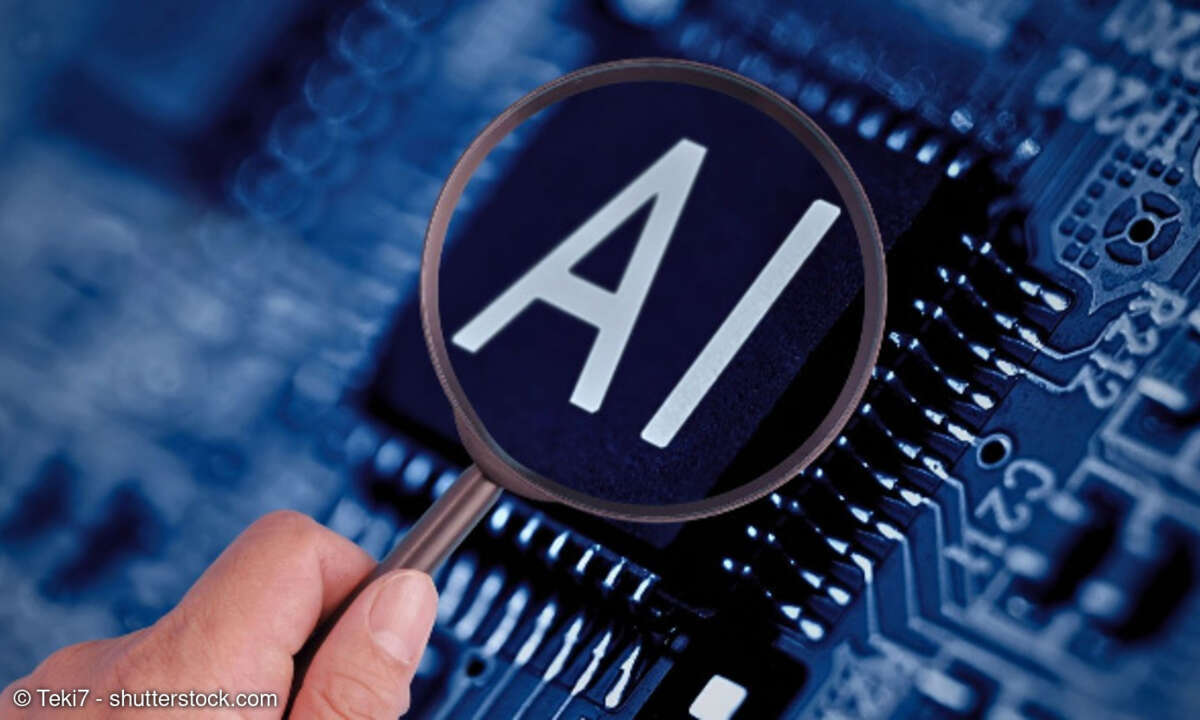Synergien mit Zukunft
Synergien mit Zukunft. Die Vorzeigebranche Maschinenbau setzt weiterhin auf innovative Softwarelösungen. Um den Erfolg des IT-Einsatzes sicher zu stellen, ist eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Softwareindustrie unverzichtbar.
Synergien mit Zukunft
Der Maschinen- und Anlagenbau gehört momentan wieder zu den Vorzeigebranchen. Nachdem die »New-Economy« kläglich versagt hat, besinnt man sich wieder auf die traditionellen Stärken in Deutschland. Starkes Umsatzwachstum, hohe Exportquoten und technologische Führerschaft sind durchaus Kenngrößen der Branche. Trotz eher ungünstiger Einflüsse im Umfeld, wie hoher Eurokurs sowie hohe Kosten für Energie und Rohstoffe, setzt sich die Kompetenz der hiesigen Branche international durch. Die Produkte sind in 2004 mit 19,3 Prozent Handelsanteil weltweit auf Rekordniveau nachgefragt.
Dabei will sich die Branche keineswegs auf ihren Lorbeeren ausruhen. Wie die Tendenzbefragung 2004 des Verbandes Deutscher Maschinen und Anlagebau (VDMA) ausweist, stehen zur Verbesserung der Wettbewerbssituation Maßnahmen in den Bereichen »Forcierte Produktinnovation« und »Mitarbeiterqualifikation« hoch im Kurs. Um als Standort mit hohem Lohnniveau die Konkurrenzfähigkeit zu erhalten, muss einerseits die Produktführerschaft verteidigt werden und zum anderen ist es erforderlich, die Arbeitsproduktivität zu steigern.
Um diesen Nutzen zu erschließen, sind IT- und Software-Lösungen ein entscheidender Hebel. Dies ist umso bedeutender, als sich bereits heute für die kommenden Jahre ein Mangel an qualifiziertem Personal für die Branche erkennen lässt.
Es gilt also, Routineaufgaben weiter zu automatisieren und komplexe Abläufe wirkungsvoll durch geeignete Systeme zu unterstützen. Dass die Unternehmen dieser Branche diesen Weg gehen wollen, lässt sich auch wieder aus der vorgenannten Tendenzumfrage ableiten. Hier wird deutlich, dass als Strategie zur Verbesserung der Wettbewerbssituation die Option der Produktionsverlagerung ins Ausland an letzter Stelle der Möglichkeiten rangiert ? obwohl gerade dieses Thema gerne in der öffentlichen Diskussion in den Vordergrund gerückt wird.
Notwendige Transparenz
Der Einsatz von Software zur Automatisierung von Routineaufgaben und Verbesserung der Unternehmensprozesse ist für die Betriebe seit Jahren ein Dauerthema. Neu ist allenfalls immer wieder, dass sich die Frage des Softwareeinsatzes unter veränderten technologischen Gesichtspunkten und Einsatzmöglichkeiten stellt.
Zu kritisieren ist hierbei, dass oftmals neue Konzepte zu früh als reife Produkte verkauft werden oder der Versuch unternommen wird, mit »alten« Lösungen auf neue Trends aufzuspringen.
Nach Jahren der Euphorie ist insbesondere bei mittelständischen Unternehmen vielfach eine zurückhaltende oder abwartende Haltung eingekehrt. Aus unserer Sicht wird es daher immer wichtiger, eine bessere Transparenz über die angebotenen Technologien und deren Einsatzpotentiale aufzuzeigen.
Das entwickelte VDMA-Modell soll beispielsweise dabei helfen, Unternehmenssoftware deren Abhängigkeiten und Schnittstellen untereinander zu skizzieren. Die Einordnung orientiert sich einerseits an den Funktionalitäten gegenüber den Wertschöpfungsprozessen, andererseits an den daran beteiligten Personen und Institutionen.
Ausgehend von diesem oder vergleichbaren Modellen müssen sich die Firmen immer wieder die Frage stellen, wo stehe ich heute und wo will ich hin. Dabei ist gerade bei neuen Technologien durchaus eine gewisse Skepsis und Betrachtung des Umfeldes ratsam, bevor in Software investiert wird ? dann allerdings mit klarer Zielrichtung und Konsequenz in der Umsetzung.
Mittelstand adressieren
Selbst bei kleinen Unternehmen werden inzwischen vielen Aufgaben IT-gestützt durchgeführt. Systeme, die bei der täglichen Arbeit direkt helfen wie zum Beispiel Office, Internet, Email, Buchhaltung, CAD haben eine breite Durchdringung erfahren und sind nahezu überall zu finden. Große Unterschiede gibt es allenfalls hinsichtlich der Intensität und der Art und Weise, wie diese Systeme zusammenspielen.
Problematisch ist, dass auf einigen Anwendungsfeldern inzwischen ein starkes Gefälle besteht zwischen großen Unternehmen, die sich eigene IT-Spezialisten leisten und neue Technologien »ausprobieren« können, und klein- und mittelständischen Unternehmen, die mit vergleichsweise geringem Personal die anstehenden EDV-Aufgaben lösen müssen und meist höhere Investitionsrisiken tragen.
Während sich beispielsweise »große« Automobilisten und Maschinenbauer mit Themen wie PLM, Digitale Fabrik oder Collaboration beschäftigen, gibt es viele Mittelständler, die gerade mal den Umstieg von 2D auf 3D oder die Einführung eines PDM-Systems geschafft haben.
Durch die komplexen Abhängigkeiten in Lieferketten, insbesondere in Richtung der Automobilindustrie, geraten dabei viele mittelständische Betriebe unter einen erheblichen Druck.
Trotz des Vorsprungs großer Unternehmen muss sichergestellt werden, dass auch der Mittelstand weiterhin auf die Potentiale neuer IT-Technologien setzt und sich die Anbieter noch stärker als bisher an dessen Bedürfnissen orientiert. Die Erfahrung zeigt, dass Systeme, die in Grossunternehmen und bei Massenfertigern durchaus vorzeigbare Erfolge bringen, sich nicht ohne Anpassung auf den mittelständischen Maschinenbau anwenden lassen. Vorkonfigurierte oder abgespeckte Lösungen erleichtern hier den Einstieg und lassen einen schnelleren ROI realisieren.
Synergien nutzen
Während in der Automobilbranche das Verhältnis von Fertigung im Inland zur Zulieferung aus dem Ausland bereits eins zu eins beträgt, ist es in der Investitionsgüterindustrie noch bei einem gesunden Verhältnis von vier zu eins.
Deswegen ist es wünschenswert, dass beide Seiten, Softwareanbieter und -anwender, sich darauf einlassen, die jeweils andere Seite besser zu verstehen und sich selbst besser zu erklären. Die Hersteller sollten lernen, dass sie stärker an den Problemstellungen von heute, anstatt an Lösungen von morgen argumentieren sollten. Kein Unternehmen löst sein ERP-System deshalb ab, weil etwas ganz neuartiges mit XML nicht funktioniert. Der Entschluss dazu erfolgt in der Regel auf Grund von langem und starken Leidensdruck, weil ganz grundsätzliche Funktionalitäten fehlen oder mangelhaft abgebildet sind.
Die Anwenderseite sollte sich vor Augen führen, dass die deutschen Systemanbieter, die häufig selbst eine mittelständische Prägung haben, branchennah und leistungsfähig sind. So werden die Produkte nicht nur ständig leistungsfähiger und benutzerfreundlicher, die Systemhäuser verfügen darüber hinaus über profundes Branchenverständnis, das sie aus einer Vielzahl von Kundenprojekten erworben haben. Eine gelebte Partnerschaft wird so fast automatisch zur win-win Situation.
RAINER GLATZ ist Abteilungsleiter Informatik bei VDMA und Geschäftsführer des Fachverbandes Software