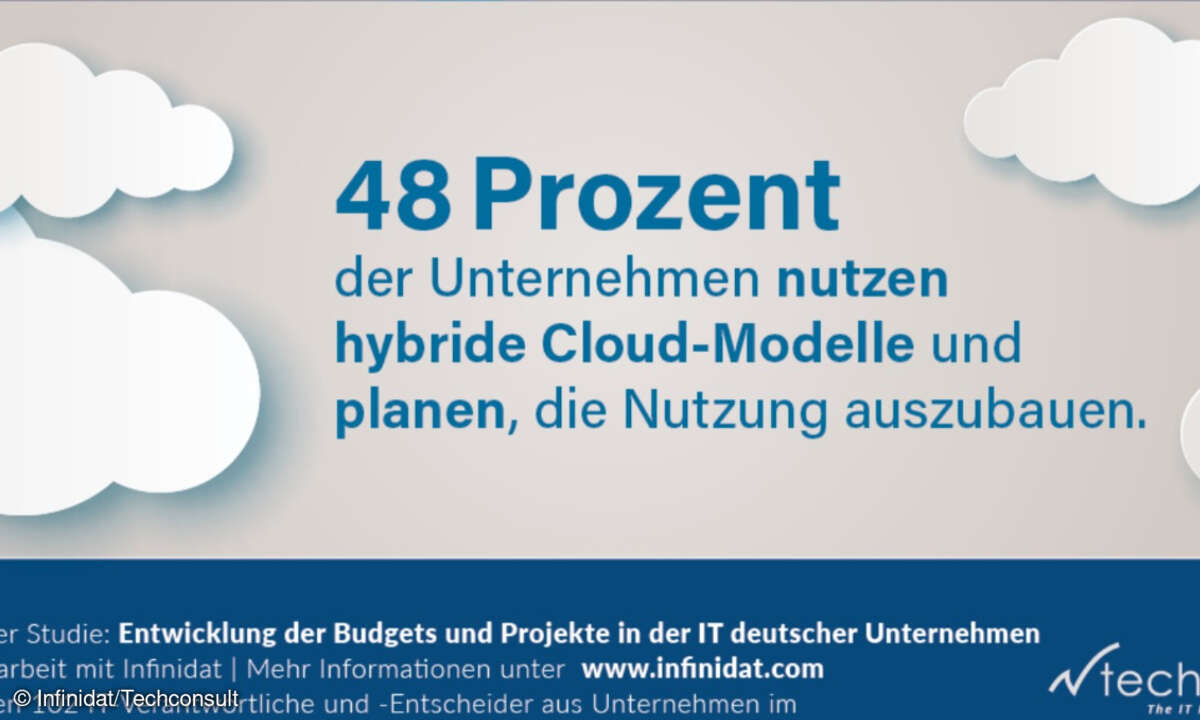Platzsparend und vorkonfektioniert
In Rechenzentren (RZs) spielen die Verkabelungssysteme für die Hochverfügbarkeit eine wichtige Rolle. Gefragt sind modulare, werksseitig ausgemessene und vorkonfektionierte Plug-and-Play-Systeme für hohe Datenraten, die zudem platzsparend sind.
Dass RZs die Nervenzentren eines Unternehmens sind, wird schon allein daran deutlich, wie aufwändig die Betreiber sie schützen: USVs, redundante Auslegungen der Verbindungen zwischen den aktiven Komponenten. Hinzu kommen eine leistungsfähige, zuverlässige Klimatisierung sowie zahlreiche weitere Schutzmaßnahmen wie Zutrittskontrolle und Brandschutz, die die geschäftskritischen Daten und Anwendungen absichern sollen. Auch die Verkabelung spielt für die Verfügbarkeit eines RZs eine tragende Rolle. Falsch geplante Infrastrukturen können schnell dazu führen, dass die Leistungsfähigkeit des Netzes mit den Anforderungen nicht mithalten kann und dass es zu Verzögerungen oder gar zu Downtimes kommt.
Für die Verkabelungsinfrastruktur in RZs gibt es zwei maßgebliche Normen: Die jüngere ist die EN 50173:2007 "Information Technology Generic Cabling Systems". Teil 5 beschreibt die zulässigen Verkabelungen der Teilsysteme Netzzugang, Hauptverteilung und Bereichsverteilung innerhalb der RZ-Netzwerkstruktur. Gültig ist darüber hinaus die TIA/EIA-942 (SP-3-0092), "Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers". In dieser Norm sind unter anderem vier Zuverlässigkeitsstufen definiert, die eine Klassifizierung der RZs nach unterschiedlichen Kriterien erlauben, etwa nach Auslegung, Kühlleistung, Verfügbarkeit und Downtime (mehr dazu im Beitrag "Der aktuelle Stand des Wandels" im Sonderheft RZ-Ausstattung vom 6.10.2008:
www.lanline.de/kn31650304). Die für die Betreiber wichtigen Aspekte dabei sind die Verfügbarkeit und die Downtime.
Ein Tier-4-Rechenzentrum zeichnet sich nach TIA/EIA-942 durch eine Verfügbarkeit von 99,995 Prozent aus. Die fehlerbedingte Downtime beträgt dort also nicht mehr als zwei Minuten pro Monat. Dies ist extrem wenig Zeit, um auf Fehler zu reagieren und diese zu beheben. Um dies zu gewährleisten, sind umfangreiche Redundanzen für alle Komponenten einzurichten. Das gilt für die aktiven Geräte, für die Netzteile/Stromversorgung und Klimatisierung ebenso wie für die Verkabelung.
Doch selbst in einem Tier-1-Datacenter, das eine Verfügbarkeit von "nur" 99,671 Prozent ausweist, beläuft sich die maximale Betriebsunterbrechung auf knapp zweieinhalb Stunden pro Monat. Downtimes im Zusammenhang mit der Verkabelung - oder gar fehlerhaften Kabeln und Steckern - sind bei derart kleinen Zeitfenstern inakzeptabel.
Die Verkabelung muss so ausgelegt sein, dass auch Veränderungen und Erweiterungen ohne Unterbrechung des laufenden Betriebs, in kürzester Zeit und sehr flexibel erfolgen können. Bei einer herkömmlichen Verkabelung bedeutet jede Änderung der Netzwerkinfrastruktur einen großen Aufwand: Die Verkabelung besteht aus vielen einzeln verlegten Strecken. Der Techniker muss für die neuen Verbindungen Stecker konfektionieren oder vor Ort spleißen und die neuen Strecken dann durchmessen. All dies gilt es in Rechenzentren schon aus Zeitgründen auf alle Fälle zu minimieren. Dazu kommt, dass die bei Vor-Ort-Arbeiten anfallenden winzigen Bestandteile der Kupfer- und LWL-Kabel zu Verunreinigungen führen, die den Ausfall der aktiven Komponenten hervorrufen können. Deshalb sind fast nur noch "gebündelte" - also hochpaarige oder hochfasrige - sowie werksseitig vorkonfektionierte und ausgemessene Plug-and-Play-Systeme gefragt. Diese sollten den aktuellen oder den gerade in der Diskussion befindlichen Normen (Klassen EA oder FA) entsprechen. Mit einer Verkabelung nach der zukünftigen Klasse FA ist der RZ-Betreiber auch für Übertragungsgeschwindigkeiten von 40 und/oder 100 GBit/s gerüstet.
Platzbedarf minimieren
Was bei der Planung der Verkabelung ebenfalls berücksichtigt werden muss, ist der aktuelle und der zukünftige Platzbedarf. In den letzten Jahren mussten viele Betreiber feststellen, dass trotz der zunehmenden Leistungsfähigkeit und Dichte der installierten Komponenten der vorhandene Platz kaum noch ausreicht. Eine Erhöhung der Leistungsdichte ist aber ebenso teuer wie neue Rechenzentrumsfläche. Kein Wunder also, dass das vorhandene Platzangebot schon jetzt zu den häufigsten Sorgen der RZ-Betreiber gehört.
Der Trend geht deshalb nicht nur in den Serverracks, sondern auch in den Verteilerschränken sowie auf den Kabelrinnen und Leitungen in Richtung einer immer höheren Packungsdichte. Auf "schlanke" Produkte ist bereits bei der Auswahl der Kabel zu achten. Die heute erhältlichen Kupfer- und Glasfaser-Trunks - letztere zumeist als vorkonfektionierte Bündeladerkabel, mit denen die aktiven Komponenten angebunden werden - bieten gegenüber vielen Einzelkabeln in allen Teilbereichen des RZs erhebliche Platzvorteile. Der typische Kabelsalat, der mit den Jahren oft fast zwangsläufig auftritt, lässt sich mit hochfasrigen Trunk-Kabeln ebenfalls vermeiden. Hinzu kommt, dass sie, auf Rinnen und Leitungen oberhalb der Schränke oder im Doppelboden verlegt, die Luftzirkulation der Klimatisierung weniger behindern. Runde Kabelkonstruktionen sollten flach-ovalen vorgezogen werden, weil sie flexibler und biegsamer sind. Eine klare Beschriftung der Trunks ist ebenfalls vorteilhaft und trägt zur Übersichtlichkeit der Installation bei.
Um den verfügbaren Platz in den Systemschränken optimal nutzen zu können, geht der Trend bei den Stecksystemen in Richtung Miniaturisierung. Mehrpolige Stecksysteme bieten auch unter diesem Aspekt große Vorteile. Bei der klassischen Kupferverkabelung galt es zum Beispiel lange Zeit als sicher, dass mit maximal 24 RJ45-Ports pro Höheneinheit (HE) im Schrank bei einer Performance ab 1 GBit/s das Maximum erreicht sei. Mittlerweile gibt es aber auch Verteiler, die mit Telco-Steckern angefahren werden und dadurch bis zu 48 RJ45-Ports pro HE zur Verfügung stellen. Im Glasfaserbereich steht mit dem MPO ein genormter Mehrfaserstecker zur Verfügung. Für Rechenzentren ist dieses Steckgesicht auf vorkonfektionierten Trunk-Kabeln mit Multimode-Fasern (OM 2, OM 3) und mit Singlemode-Fasern (OS 2) erhältlich. Mit dem MPO-Steckverbinder können zwölf Glasfasern und mehr auf einmal verbunden werden. In Kombination mit einer Platz sparenden Verteilerlösung lassen sich damit bis zu 192 Fasern auf einer HE anschließen, was 96 LC-Duplex-Verbindungen entspricht. Der Trend geht beim MPO sogar bis zu 72 Fasern in einem Steckverbinder.
In den meisten Serverräumen und Rechenzentren sind ständige Veränderungen die Regel. Dazu kommen die im Vergleich zur Verkabelung häufigen Technologiesprünge bei den aktiven Komponenten, mit denen die Verkabelungsinfrastruktur mithalten muss. Gefragt sind deshalb sowohl für Server- als auch für reine Netzwerkschränke möglichst modulare Verteilsysteme. Eine ideale Verteilerlösung, die einen hohen Investitionsschutz bietet, sollte es ermöglichen, verschiedene Kupfer- und Glasfaseranschlusstechniken so in einem Gehäuse zu kombinieren, dass diese nach Bedarf und relativ schnell ausgewechselt werden können. Dies erreichen viele RZ-Betreiber durch die Kombination mehrerer Verteilmodule oder -kassetten auf je einer HE.
Auf dem Markt sind seit einigen Jahren zum Beispiel intern mit Fasern vorkonfektionierte Fiber-Optic-Kassetten erhältlich, die frontseitig die gängigen LWL-Anschlüsse (LC Duplex, SC Duplex, LSH-C) bieten und rückseitig über einen MPO-Adapter verfügen. Für Kupferverkabelungen gibt es entsprechende Kupferkassetten, die frontseitig mit Standard-RJ45-Anschlüssen und auf der Rückseite mit einem 50-poligen Telco-Stecker bestückt sind. Mit solchen Modulen lassen sich nicht nur sehr viele Twisted-Pair- und Fiber-Optic-Module auf engstem Raum abschließen, sondern auch gemischte Bestückungen beider Techniken auf einer HE realisieren.
Geschwindigkeit
Eine RZ-Verkabelung muss mindestens für 1 GBit/s, zumeist aber für 10 GBit/s und mehr ausgelegt sein und die Anwendungen mit diesen hohen Bitraten auch zuverlässig übertragen können. Für platzsparende Plug-and-Play-Systeme mit vorkonfektionierten Trunk-Kabeln und einer mehrpoligen Anschlusstechnik kommen in den deutschsprachigen Ländern in weit über 90 Prozent aller Rechenzentren nur zwei Kupfer- und eine Fiber-Optic-Lösung zum Einsatz.
Im Bereich Kupfer sind das der ungeschirmte MRJ-21 und der geschirmte Telco-Stecker. Mit beiden lassen sich je sechs Gigabit-Ethernet-Verbindungen in einer Verbindung realisieren.
Der Telco-Stecker ist zwar breiter, bietet gegenüber dem anderen Steckgesicht aber - neben der Schirmung - die Vorteile einer höheren Stabilität und der Verpolungssicherheit.
Für hochperformante 10-Gigabit-Ethernet-Verbindungen stehen zwei genormte Kategorie-7A-Steckverbindungen zur Verfügung. Die Anwender bevorzugen dafür aber vor allem Glasfaserlösungen. Das hat zwei Gründe: Zum einen sind aktive Geräte mit 10-GBit/s-Ports preislich kaum von denen mit entsprechenden LWL-Anschlusstechnik zu unterscheiden. Zum anderen bieten Glasfasersysteme hinsichtlich zukünftiger Übertragungsraten wie 40 oder 100 GBit/s eine höhere Zukunftssicherheit. Diese hohen Datenraten werden aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr seriell übertragen, sondern parallel mit dem Steckgesicht MPO.