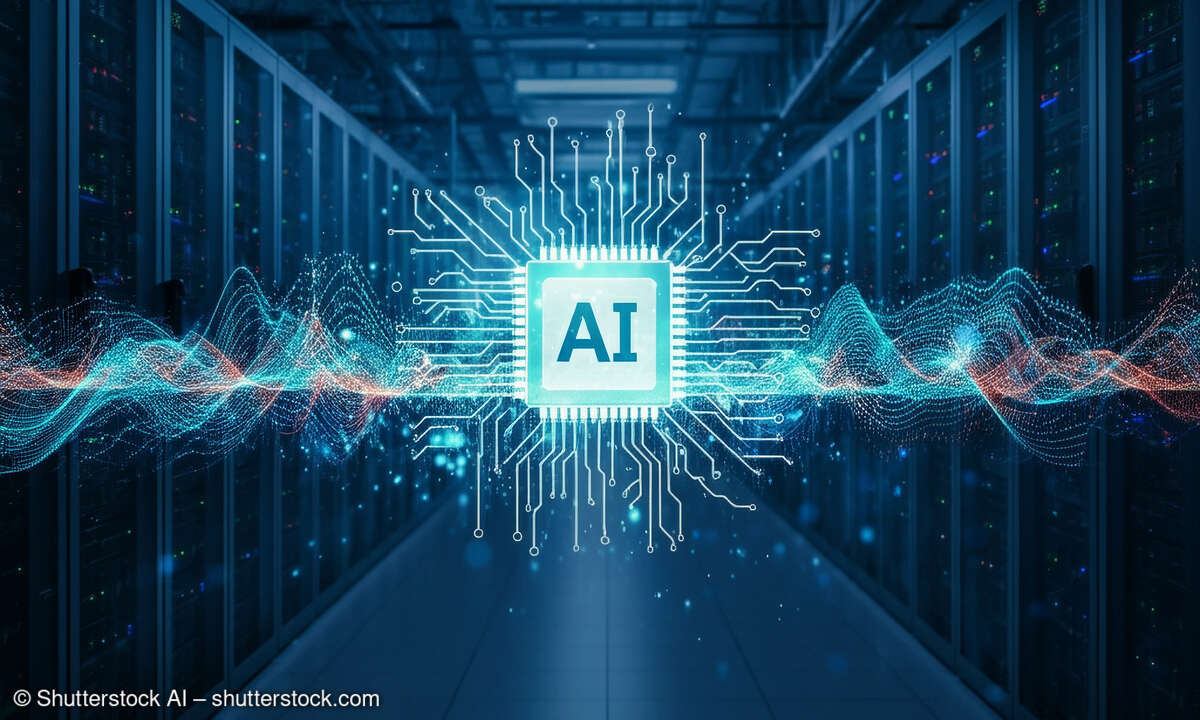Quantenbits sollen leichter beherrschbar werden
Zwei aktuelle Forschungsergebnisse halten den Glauben an den extrem schnellen Quantencomputer wach: Am Sandia National Lab ist ein siliziumbasierter Nanospeicher entstanden, in dem einzelne Elektronen isoliert, gemessen und manipuliert werden können. Ein Forscherteam mit deutscher Beteiligung hat dafür die Manipulation des Elektronenspins perfektioniert.
Statt mit dem digitalen System von Null und Eins arbeiten Quantencomputer auch mit
Verschränkungen: Beispielsweise zeigt der als Informationsträger genutzte Spin eines Elektrons nach
unten oder oben – das Quanten-Computing nutzt zudem die Überlagerung der beiden Basiszustände aus
und stellt damit die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung mit der traditionellen
Computerarchitektur bei bestimmten Probleme in den Schatten. Anwendungsfelder der noch stark
theoretischen Forschung sind die Simulation komplexer physikalischer Systeme, chemischer
Komponenten und pharmazeutischer Moleküldesigns.
Die Sandia-Forscher um Projektmanagerin Rebecca Horton haben einen Ein-Elektron-Transistor in
0,35-CMOS-Prozesstechnik gebaut. Der Quantenpunkt soll als erster auf Basis der billigen
Siliziumtechnik ein Quantenbit erzeugen – die Strukturen in der Größenordnung von 50 Nanometer
sollen damit in traditionelle CMOS-Schaltkreise integrierbar werden. "Wir schlagen vor,
siliziumbasierte Quantenpunkte und extrem sensitive Elektronen.Messsysteme zu kombinieren", erklärt
Malcom Carroll vom Sandia-Department für photonische Mikrosystemtechnologie. Neben der
Miniaturisierung und dem Design arbeiten die Forscher auch daran, die Siliziumtechnik bei
Tieftemperaturen funktionieren zu lassen, die für die Quantentechnik erforderlich ist.
In einem zweiten Forschungsprojekt ist es Bochumer Physikern zusammen mit Kollegen aus Dortmund,
Sankt Petersburg und Washington gelungen, den Elektronenspin auszurichten, zum kontrollierten
Torkeln zu bringen und auszulesen. Mit optischen Impulse richten sie die Spins der Elektronen auch
jederzeit beliebig neu aus. "Das ist der erste, wichtige Schritt zu einer Adressierung dieser
Quantenbits, die in künftigen Datenübertragungssystemen und Rechnern Einzug halten werden", ordnet
Professor Andreas Wieck das Ergebnis ein. Wieck ist Lehrstuhlinhaber für angewandte
Festkörperphysik an der Ruhr-Uni Bochum (RUB).
Komplexe Rechenoperationen finden auf kleinstem Raum statt: Elektronen enthalten nicht nur
Ladung – sie drehen sich auch wie ein Kreisel um die eigene Achse und erzeugen so ein Magnetfeld,
ähnlich dem der Erde. Durch das Anlegen eines äußeren Magnetfelds beschleunigen oder verlangsamen
die RUB-Forscher dieses Kreiseln, bringen den Kreisel zum Torkeln und kippen seine Achse in fast
beliebige Winkel. Werden diese Varianten als Informationsträger genutzt, lässt sich nicht nur mehr
Information speichern: Benachbarte Elektronen üben wie zwei Pinwand-Magnete Kräfte aufeinander aus
und die lassen sich in verschiedene Konfigurationen bringen, was die Datenspeicherung und
-verarbeitung noch komplexer gestaltet. Wieck: "Solche Quantenbits können schon in geringer Anzahl
von nur einigen zig Qubits anstelle einiger Millionen Bits sehr komplexe Rechenvorgänge ausführen."
Spins werden in Indium-Arsenid-Inseln eingesperrt: Einzel-Elektronenmessungen sind nur mit
höchstempfindlichen Instrumenten unter großen Schwierigkeiten durchführbar. Eine Spezialität des
internationalen Forscherteams ist es daher, rund eine Million Elektronen in jeweils fast genau
gleiche Indium-Arsenid-Inseln einzusperren und ihre Wirkung zu addieren. Diese "ensemble"-Messungen
in den Quantendots ergeben um sechs Größenordnungen stärkere Signale, die einfach aufzuzeichnen und
sehr robust sind. Wieck: "Entgegen den Vorurteilen vieler internationaler Konkurrenten verhalten
sich dabei alle beteiligten Elektronenspins genau gleich und die mikroskopischen Effekte können
daher sehr einfach gemessen werden."
Quantendots lassen sich optisch schalten: Nach der aktuellen Studie ist es nun gelungen, diese
Elektronenspins nicht nur auszurichten, sondern auch optisch mit einem Laserpuls zu beliebigen
Zeitpunkten in eine gewünschte Richtung zu drehen und diese Richtung mit einem weiteren Laserpuls
auszulesen. Dies ist der erste wichtige Schritt, um Qubits zu adressieren und zu beeinflussen. "Das
Interessante ist dabei, dass diese Elektronen in Festkörper eingeschlossen sind", erklärt der
RUB-Physiker. "Man braucht also nicht wie zum Beispiel bei der Quantenoptik aufwändige
Höchstvakuumtechnik und allseitigen Lichteinschluss, um sie dauerhaft in einem Bauelement halten zu
können." Das Höchstvakuum wird nur einmal bei der Herstellung der Quantendots in Bochum benötigt,
danach ist das Halbleitersystem gegen Lufteinfluss versiegelt, langlebig und zuverlässig wie alle
heute schon verwendeten Transistoren und Speicherzellen.
Rochus Rademacher/CZ