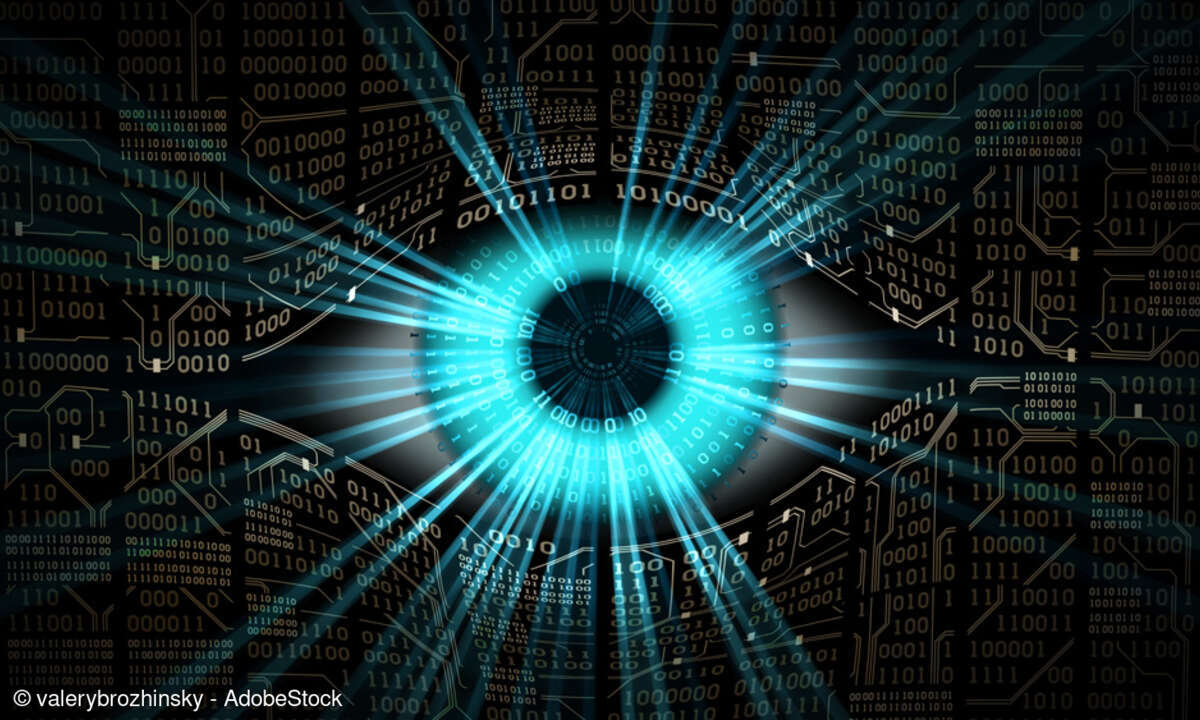Elektronisches Sozialmanagement
Elektronisches Sozialmanagement Erreichen Maßnahmen der Sozialhilfe, was sie anstreben? Oft genug lässt sich das schwer ermitteln. In Rheinland-Pfalz hilft dabei ein landesweites Web-basierendes System.

Moderne Sozialhilfepolitik soll jedem Leistungsberechtigten die Leistungen auszahlen, die ihm ein menschenwürdiges Leben als Teil der Gemeinschaft ermöglichen. Pauschale Leistungskürzungen nach dem Rasenmäherprinzip können nicht die Antwort auf steigende Sozialausgaben sein. Vielmehr geht es um die Optimierung der Leistungen im Einzelfall. Dafür müssen organisatorische und technische Voraussetzungen erfüllt werden:
1. ?ein flexibles Informations- und Auswertungssystem auf der Grundlage einer in Kommunen und Land einheitlichen Datenbasis,
2. ?ein einheitliches Zielsystem Soziales, das Ziele, Hilfearten und Kennzahlen einheitlich strukturiert abbildet,
3. ?ein System, mit dem die Wirkungen von Hilfeleistungen im Einzelfall erhoben und ausgewertet werden können. Diese Anforderungen setzt die integrative ziel- und wirkungsorientierte Steuerung konzeptionell und technisch um. Sie ist die konzeptionelle Grundlage für das Projekt »Elektronische Wirkungsanalyse in der Sozialhilfe (EWAS)«. Es wurde vom Land Rheinland-Pfalz in Kooperation mit ausgewählten Kreisen und kreisfreien Städten initiiert. Das EWAS-System basiert auf dem speziell für die Wirkungsmessung und Outcome-Steuerung entwickelten DV-Verfahren »elektronisches Planen Budgetieren und Navigieren (ePBN)« der auf E-Governance spezialisierten Unternehmensberatung Hauser, Furch & Partner. Um den Steuerungsmechanismus wie vorgesehen umzusetzen, ist ein spezielles DV-Verfahren erforderlich. Als erstes liest es die Sozialhilfedaten, also Stamm- und Transferausgaben der Leistungsberechtigten, aus den kommunalen Sozialhilfegewährungsverfahren einzelfallbezogen in eine zentrale Datenbank ein. Da jede kreisfreie Stadt, jeder Landkreis und jede Verbandsgemeinde selbstständig eine Software zur Sozialhilfegewährung auswählen kann und es am Markt etwa 30 etablierte Produkte gibt, müssen entsprechend viele Schnittstellen definiert werden. Innerhalb jeder der Schnittstellen muss man dann softwareabhängig bis zu 20000 Teil-Verknüpfungen für die Kodierung der Einzelbeträge je Hilfeart anlegen. Über die Schnittstellen werden die bereits auf den Clients pseudonymisierten Daten der Leistungsberechtigten monatsaktuell mittels des RLP-Netzes (Rheinland-Pfalz-Netz, das Verwaltungsnetz des Bundeslandes) zu einem zentralen, integrierten Datenbestand zusammengeführt. Diese Daten stehen jeden Monat aktuell für landesweite Auswertungen und Analysen zur Verfügung. Ad hoc sind Informationen über die Entwicklung der Gesamtkosten oder Fallzahlen auf allen beteiligten gebietskörperschaftlichen Ebenen abrufbar. Auch detaillierte Auswertungen, etwa nach Stadtteilen, sehr fein granulierten Teil-Hilfearten, Stammdatenmerkmalen wie Geschlecht, Alter, Familienstand und anderem mehr, lassen sich direkt am Bildschirm und als Excel-Bericht zur weiteren Bearbeitung bereitstellen. Das DV-Verfahren ist vollständig internetbasiert. Deshalb beantwortet es flexibel und umfassend Fragen aller Beteiligten: Kommunen erhalten die nötigen Daten für eine gesicherte Bedarfsplanung, das Land Informationen, mit deren Hilfe sich ein valides Instrumentarium für Zielgruppen-Benchmarks entwickeln lässt. Java-Clients eröffnen den Einblick in den konsolidierten Datenbestand. Sie können nach Prüfung der Zugriffsberechtigungen dezentral vom Server installiert werden. Je nach Erkenntnisinteresse sind im Rahmen eines Standard-Berichtswesens vorkonfigurierte, regelmäßige Berichte möglich.
Transparenz durch valide Daten Eine einheitliche Datenbasis schafft Transparenz. Das allein reicht aber nicht aus, um wirksam ein komplexes Politikfeld wie die Sozialhilfe zu steuern. Im Kern besteht die Steuerung darin, die Effektivität und Effizienz der staatlichen Leistungen real einschätzen zu können. Dann werden sie durch gezielte Vorgehensweisen systematisch verbessert. Im EWAS-Projekt wurde von den Fachleuten des Landes und der Kommunen auf der Grundlage der gesetzlich definierten Transferleistungen ein Zielsystem »Soziales« entwickelt. Es bildet das sozialpolitisch Gewollte, also die vom Gesetzgeber vorgegebenen Ziele, ebenso ab wie die einzelnen gesetzlich definierten Hilfearten, die für die Zielerreichung vereinbart wurden. Politische Ziele wie mehr Teilhabe behinderter Menschen am Leben der Gemeinschaft, untergliedert das Zielsystem feiner von der Zielgruppe bis zur einzelnen Transferleistung, etwa der Gewährleistung eines »Persönlichen Budgets«. Durch diese konsequente Strukturierung von Zielen und Maßnahmen entstehen Ursache-Wirkungs-Ketten, anhand derer sich prüfen lässt, ob angestrebte Ziele erreicht wurden. Diese Aufgabe übernimmt der kommunale Sachbearbeiter. Dafür sind sind zwei Schritte nötig, die innerhalb eines HTML-Client vorgenommen werden. Der Sachbearbeiter ordnet den Einzelfall zunächst einem bestimmten Ziel des Zielsystems zu. Dadurch bestimmen sich die zielspezifischen Wirkungsindikatoren. Im nächsten Schritt erfasst man die Wirkungsindikatoren, indem zunächst die Ausgangssituation erhoben und dann die Wirkungen erfasst werden.
EWAS setzt Ziele elektronisch in Wirkungsindikatoren um Dieser Prozess kann im Rahmen der individuellen Teilhabeplanung oder der Fallkonferenzen stattfinden. Dort verhandelt der zuständige Sachbearbeiter mit den Leistungsanbietern, etwa Heimen, über die individuellen Ziele für den Leistungsberechtigten. Das EWAS-System setzt dann die Ziele, die in den einzelnen Lebensbereichen vereinbart wurden, elektronisch in Wirkungsindikatoren um. Künftig könnte also der Träger oder Sachbearbeiter den gesetzlich vorgeschriebenen Aktionsplan für den Leistungsberechtigten elektronisch statt manuell und internetbasiert erfassen. Sogar die Eingabe in einen Laptop oder einen Pocket-PC direkt in der Fallkonferenz sind denkbar. Die Zielstruktur und die Kennzahlen selbst werden im Navigationssystem des ePBN abgebildet, wobei zu jedem Element des Zielsystems (Ziele und Hilfearten) ein eigener Kennzahlenbaum verwaltet wird. Zu einem einzelnen Element des Zielsystems können so verschiedene Kennzahlenarten, Ausgaben/Kosten, Mengen, Qualitäts- und Wirkungskennzahlen aus unterschiedlichen Sichten der Public-Value-Scorecard hinterlegt werden. Die Struktur der Ziele und Zielgruppen sowie alle Arten von Kennzahlen sind auf einen Blick sichtbar. Auswertungen sind jederzeit möglich. Wann immer erforderlich, lassen sich Zielsystemstruktur und Kennzahlen an die individuellen Anforderungen anpassen, ohne dass Daten aufwändig umgebucht werden müssen. Die bestehenden Strukturen werden so einfach ergänzt und nicht mehr erforderliche deaktiviert.
Detlef Placzek ist Vizepräsident beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung des Landes Rheinland-Pfalz.