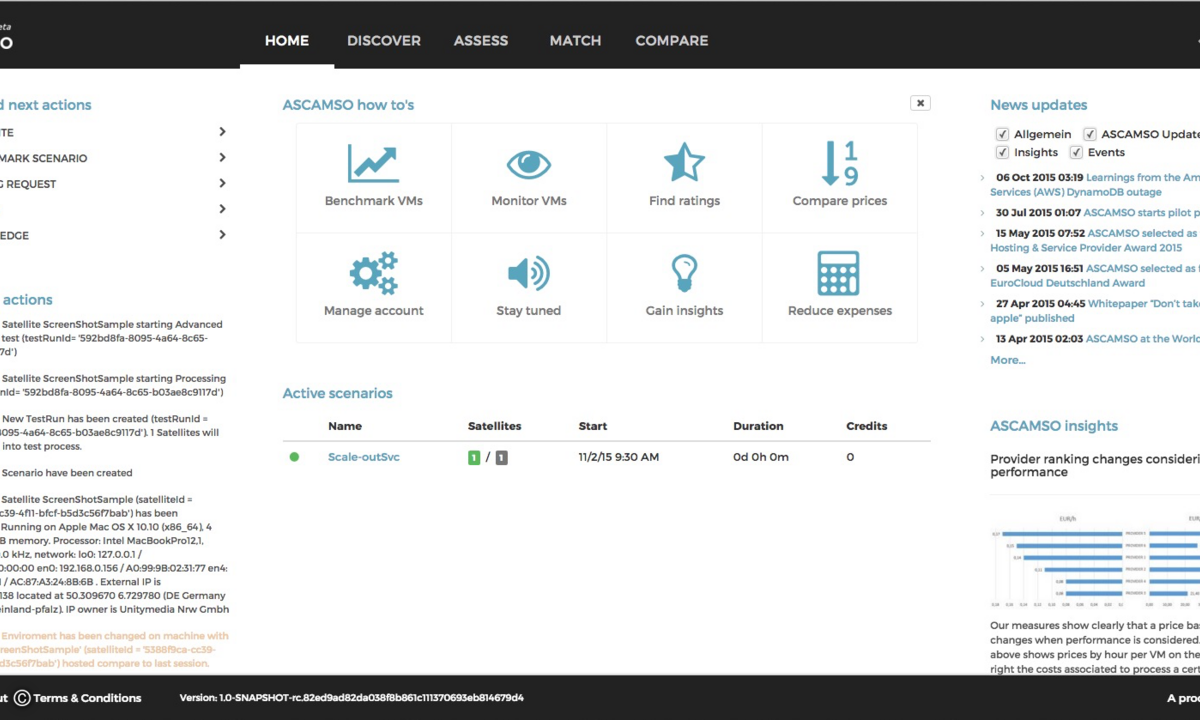Gut vorbereitet (Fortsetzung)
- Gut vorbereitet
- Gut vorbereitet (Fortsetzung)
ILV ? Interne Leistungsverrechnung
In vielen mittelständischen Unternehmen erfolgt die interne Verrechnung der IT-Kosten nach einem in der Budgetierung festgelegten Verteilschlüssel. Dies führt zu einer Intransparenz der Leistungen, die sich hinter den Kosten verbergen, und zu Unzufriedenheit bei den Leistungsnehmern. Ein weiterer, nicht unbedeutender Negativeffekt dieser Vorgehensweise könnte sein, dass die IT-Kosten höher als notwendig sind, weil die (internen) Kunden nur ihren festgelegten prozentualen Anteil bezahlen und bei Investitionen eher dazu neigen, größere Anschaffungen als notwendig zu tätigen. Nach der Einführung eines Direct Costing-Modells kann durch Eliminierung dieses Effektes allein ein Kostensenkungspotenzial von fünf bis zehn Prozent erreicht werden.
Als erste Stufe zur Vorbereitung eines Outsourcing-Projektes ist es ratsam, durch Einführung einer verursachungsgerechten internen Leistungsverrechnung für die notwendige Transparenz zu sorgen. Dazu definiert man in der Regel in einem Projekt-Team die Services, die von der hauseigenen IT angeboten und geleistet werden. Um die Komplexität in einem handhabbaren Rahmen zu halten, sollte die Anzahl der Services so gering wie möglich, aber so viel wie nötig sein. Als ?Best Practice?-Wert hat sich eine Anzahl der Services beim durchschnittlichen Mittelstand ergeben, die meist unter 50 liegt. Nach der Definition der Services folgt als nächster Schritt die Zuordnung der IT-Kosten zu diesen Leistungen. Hier hat es sich in der Praxis bewährt, die angefallenen Kosten in folgende Arten zu unterteilen:
- abzuschreibende Güter,
- Verbrauchsgüter,
- Personalkosten,
- sonstige Kosten.
Bei Kosten, die nicht direkt zugeordnet werden können, haben sich in der Praxis Kostensammler bewährt, die anschließend über Kennzahlen auf die einzelnen Services heruntergebrochen werden. Die meisten Mittelständler erreichen bei der Implementierung eine Genauigkeit der Zuordnung von 80 bis 90 Prozent ? in Abhängigkeit von der Kennzahlengüte bei den Kostensammlern. Diese Genauigkeit kann für die Vorbereitung eines Outsourcing-Projektes in dieser Phase auch als hinreichend angesehen werden. Allein die Einführung einer derartigen internen Leistungsverrechnung kann je nach Komplexität zwischen drei und acht Monaten dauern.
Einführung eines Service Level Managements (SLM)
Ein weiteres wichtiges organisatorisches Instrument für die IT-Abteilung ist die Einführung eines Service Level Management innerhalb der IT-Abteilung. Für viele Mittelständler ist dieses Thema Neuland, und man neigt dazu, die Bedeutung und den Aufwand zu unterschätzen. Im Idealfall wurde das SLM schon vor der Einführung des ILV implementiert. Das Service Management hat die Aufgabe, auf der Grundlage des Servicekataloges und der internen Leistungsverrechnung Service Level Agreements mit den Leistungsnehmern und Operations Level Agreements mit den Leistungsbringern abzuschließen. Nicht selten stößt das Service Management auf die Herausforderung, dass viele benötigte Kennzahlen nicht wie gefordert gemessen werden können. Dafür müssen nämlich erst geeignete Tools implementiert werden. Eine weitere Aufgabe des Service Managements ist die kontinuierliche Verbesserung der internen Leistungsverrechnung, damit anfallende IT-Kosten möglichst genau verursachergerecht dokumentiert werden können. Die Einführung eines SLM sollte nicht länger als sechs Monate dauern. Strukturierung des Serviceportfolios
Als nächste Vorgehensstufe hat das SLM gemeinsam mit dem IT-Management die Aufgabe, für die einzelnen Services drei Fragen zu beantworten:
- Welcher Service ist strategisch?
- Welcher Service ist geschäftskritisch?
- Welcher Service ist Commodity?
Die strategischen und die geschäftskritischen Services sollten in der Regel als Kernkompetenz betrachtet und daher nicht an einen Provider ausgelagert werden. Es ist aber in der Praxis durchaus üblich, Schnitte innerhalb der Services durchzuführen, so dass die Infrastruktur ausgelagert wird, die Applikation aber als Kernkompetenz erhalten bleibt. Zum Abschluss dieser Phase sollte man als Lieferobjekt ein Modell entwickelt haben, in dem festgelegt wird, welche Services oder Teil-Services nicht ausgelagert werden dürfen und welche man am Markt platzieren möchte. Parallel empfiehlt es sich für die Services, die die Hauptkostentreiber darstellen, Benchmarks einzuholen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, welches Optimierungspotenzial man im Hause vorhält.
Da viele Mittelständler kein ausgeprägtes Prozess Management vorhalten, empfiehlt es sich zur Vorbereitung des Outsourcings eine Ist-Analyse der bestehenden Prozesslandschaft durchzuführen und anhand einer Retained Organisation eine Soll-Struktur für die Prozesse zu planen. ITIL gibt zu diesem Thema viele Hilfestellungen und setzt sich als Leitfaden in der Praxis mit dem Best Practice-Ansatz immer mehr durch. Eine strategisch bedeutsame Frage ist es, ob das Service Management im eigenen Unternehmen betrieben oder dem Provider überlassen wird. Je wichtiger die IT insgesamt für die Geschäftsprozesse und die Kernkompetenz des Unternehmens ist, desto eher empfiehlt es sich, das Service Management selbst zu steuern und zu betreiben. Wird es nämlich ebenfalls dem Provider überlassen, so droht hier die Gefahr einer starken Abhängigkeit.
Der geeignete Provider
Nachdem sich Unternehmen durch eine gründliche Vorbereitung eine klares Bild vom Umfang des Outsourcings gemacht haben, stehen sie nun vor der Herausforderung, den für das Unternehmen geeigneten Provider zu finden. Hier hat sich in der Praxis ein Scoring-Modell bewährt, in welchem man zehn bis 20 Kriterien definiert, die ein Provider erfüllen muss. Die Kriterien werden je nach Bedeutung gewichtet (räumliche Nähe zum Provider, Prozesskompetenz usw.). Dabei werden viele Unternehmen bereits feststellen, dass nicht jeder Provider von seiner Ausrichtung her auf Kunden aus dem Mittelstand ausgerichtet ist.
In einem zweiten Schritt empfiehlt es sich, mindestens zehn bis 20 Provider mit Hilfe der Bewertungsmatrix zu analysieren und schließlich eine ?Shortlist? mit den am besten geeigneten fünf Providern zu erstellen.
Mit diesen fünf Providern können nun im Rahmen von getrennten Workshops erste Gespräche über den Umfang und über eine grobe Scope-Beschreibung des Outsourcing-Vorhabens geführt sowie eine Interessensbekundung des Providers eingeholt werden. In der Praxis hat es sich bewährt, die Provider schließlich aufzufordern, dem potenziellen Outsourcing-Nehmer einen Fragenkatalog zukommen zu lassen, damit dieser aufgrund der Antworten ein Angebot erstellen kann. Aus diesen fünf Fragekatalogen eliminiert man die doppelten Fragen und nimmt diese konsolidierte Version als Leitfaden für die Erstellung des Request for Proposal (RFP). Die Phase des RFI sollte in maximal drei Monaten abgehandelt sein.
Der RFP sollte einen Umfang von 50 bis 100 Seiten haben und sich an dem konsolidierten Fragenkatalog orientieren. Außerdem sollten die Ziele klar definiert sein, die mit dem Outsourcing-Vorhaben verfolgt werden (Qualitätssteigerung, Kostensenkung etc.), damit Provider in der Lage sind, ein maßgeschneidertes Angebot zu erstellen. Nach Möglichkeit strukturiert man den RFP in verschiedene Leistungspakete, die in sich geschlossen und abgegrenzt sind. Das ermöglicht dem Mittelstand, eine Multi Vendor-Strategie (bei ausreichender Verhandlungsmasse) aufzusetzen, und erlaubt eine höhere Transparenz über das Kalkulationsschema der Provider.
In einem Kapitel sollten die Provider-Spielregeln definiert werden, um eine Gleichbehandlung aller Provider zu gewährleisten. In den Spielregeln ist beispielsweise definiert, wie viel Zeit dem Provider für die Legung des Angebotes zugemessen wird und welche Kommunikationsschnittstellen es gibt. Ein Zeitraum von fünf bis sechs Wochen hat sich in der Praxis für die Erstellung des Angebotes bewährt. Zudem ist es sinnvoll, dass der Provider bis zum Ende der vierten Woche Fragen zum RFP schriftlich kommunizieren darf, die als Hilfestellung zeitnah beantwortet werden. Um die Auswertung des Angebotes zu erleichtern, sollte es neben den üblichen Anhängen wie SLA?s, Asset-Listen etc. auch einen Anhang »Fragenkatalog« geben, den jeder Provider im Rahmen des Angebotes beantworten muss.
Der Fragenkatalog sollte alle Fragen beinhalten, die entscheidend für die Providerauswahl sind. Diese Fragen müssen so gestellt sein, dass der einzelne Provider Sie nur mit »Ja« oder »Nein« beantworten kann, damit kein Interpretationsspielraum offen gelassen wird. Die Erfahrung zeigt, dass Provider, die man in Prosa antworten lässt, Ausschlüsse, Annahmen und Abgrenzungen formulieren, die sich nur mit erheblichem Arbeitsaufwand auswerten lassen. In dieser Phase bewährt sich auch ein Referenzbesuch bei Bestandskunden des Providers, wobei man Referenzkunden besuchen sollte, die einen ähnlichen Scope ausgelagert haben und in der selben Branche sind. Einen wichtigen Punkt sollten Firmen dabei nicht vergessen: Auch das Thema Beendigungsmanagement nach Ablauf des Outsourcing-Vertrages sollte im RFP unbedingt adressiert sein. Vorbereitung auf die Due Diligence
Nach Eingang der Angebote und der dazu gehörigen Abschlusspräsentation sollte anhand einer definierten Auswertungsmatrix und eines im Vorfeld definierten Prozesses jeder Provider bewertet werden. Der Fokus kann je nach Zielsetzung und Strategie auf der Wirtschaftlichkeit oder auf der Qualitätssteigerung liegen. Auf jeden Fall muss in der Bewertungsmatrix sichergestellt werden, dass der Provider die Kompetenzfelder mitbringt, die er benötigt, um den Umfang des Projektes abzudecken. Nach Abschluss der Providerauswahl bewährt sich der Ansatz, die Anzahl der Provider auf zwei Unternehmen für die Due Diligence zu begrenzen. Sollten Firmen sich in dieser frühen Phase vorschnell auf einen Provider festlegen, laufen sie Gefahr, in den Preisverhandlungen nicht mehr die benötigte Stärke gegenüber dem Provider zu haben. Mit den zwei selektierten Providern, so zeigt die Erfahrung, sollten in der Vorbereitung der Due Diligence initiale Workshops zum Inhalt und Ablauf der Due Diligence stattfinden. Ziel dieser Workshops ist es, die Erwartungshaltung der einzelnen Parteien und den Detailgrad zu definieren, der in der Due Diligence untersucht wird. In der Vergangenheit wurde dieser Punkt gerade im Mittelstand nicht hinreichend gewürdigt. Mit dem Ergebnis, dass in der Durchführung Punkte adressiert wurden, die nicht in der Kürze der Zeit beantwortet werden konnten.
Fazit
Outsourcing bietet auch Mittelständlern die Möglichkeit, ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu verbessern und sich ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren. Da der Organisations-Reifegrad in den Unternehmen des Mittelstandes in der Regel deutlich niedriger entwickelt ist als bei Großunternehmen, ist hier die Vorbereitung noch erfolgskritischer.
Stefan Schulenburg ist als Service Portfolio Manager bei eine
Finanzdienstleister beschäftigt.
Rolf Schröder ist CIO bei einem Finanzdienstleister
Wilfried Köhler-Frost ist Geschäftsführer und spezialisiert auf
Outsourcing-Consulting für den Mittelstand