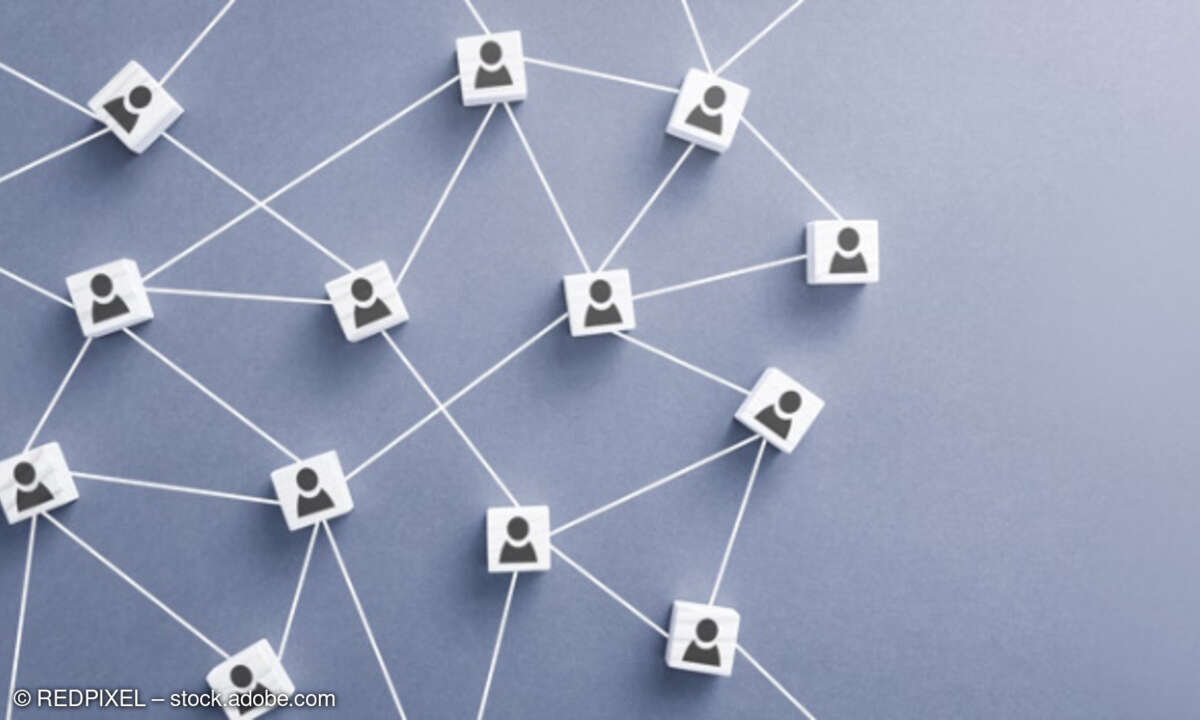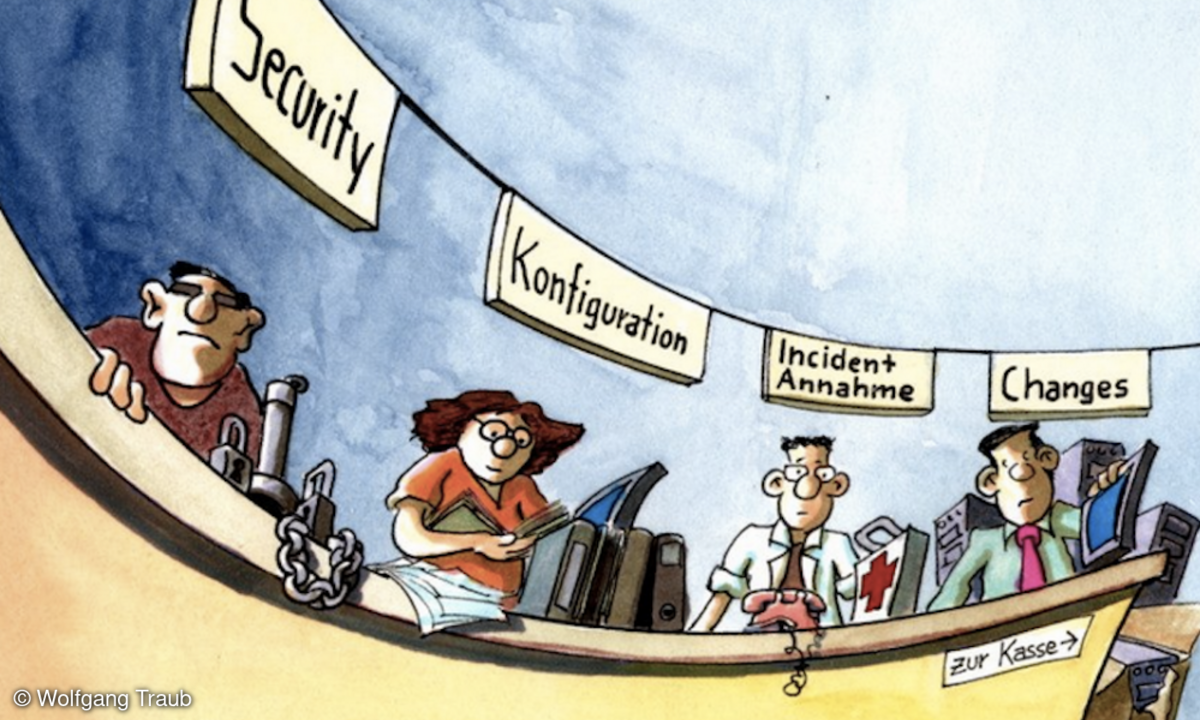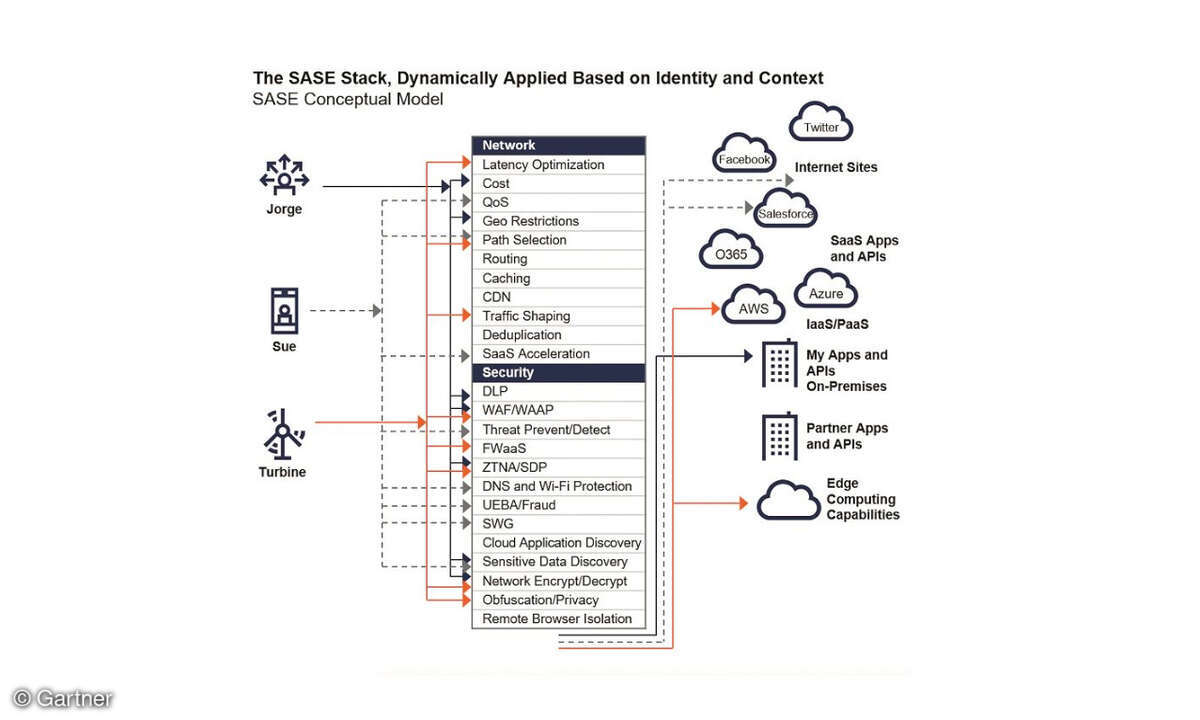IT- Leistungsverrechnung: Viele verrechnen sich
IT- Leistungsverrechnung: Viele verrechnen sich Mit dem anhaltenden Kostendruck wächst auch der Bedarf nach Transparenz in den IT-Ausgaben. Vor dem Hintergrund führen viele Unternehmen eine IT-Leistungsverrechnung ein, sind sich aber häufig der Tragweite dieser Entscheidung nicht bewusst.
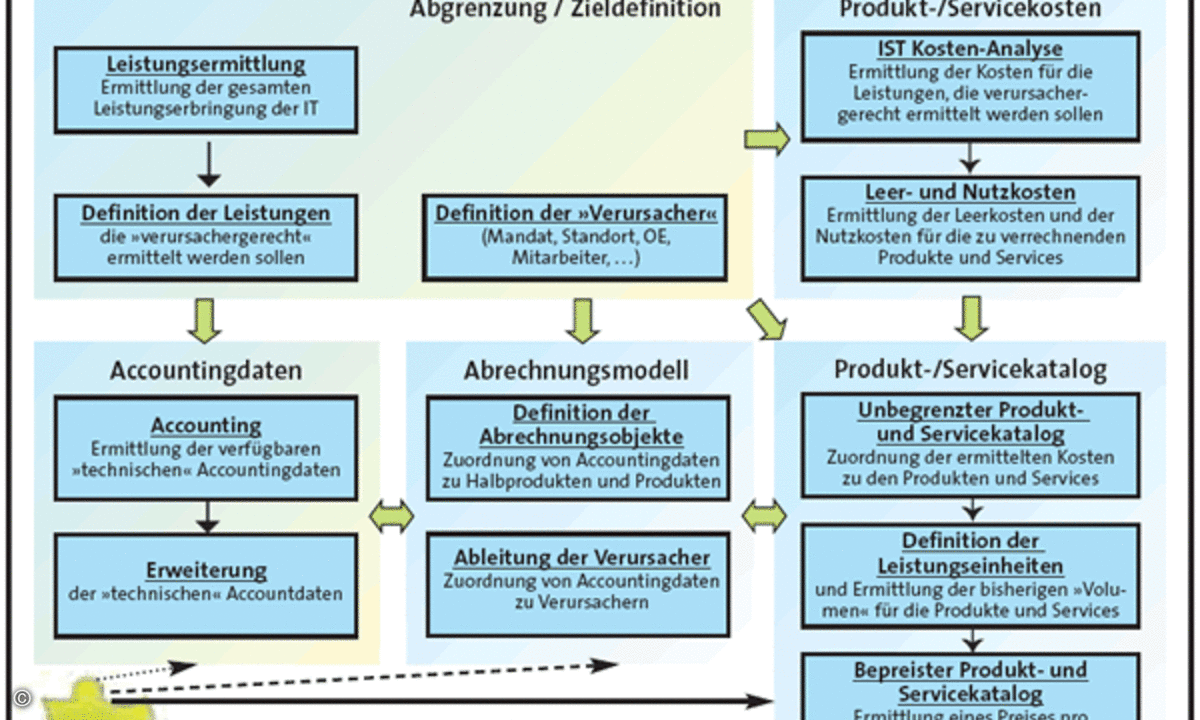
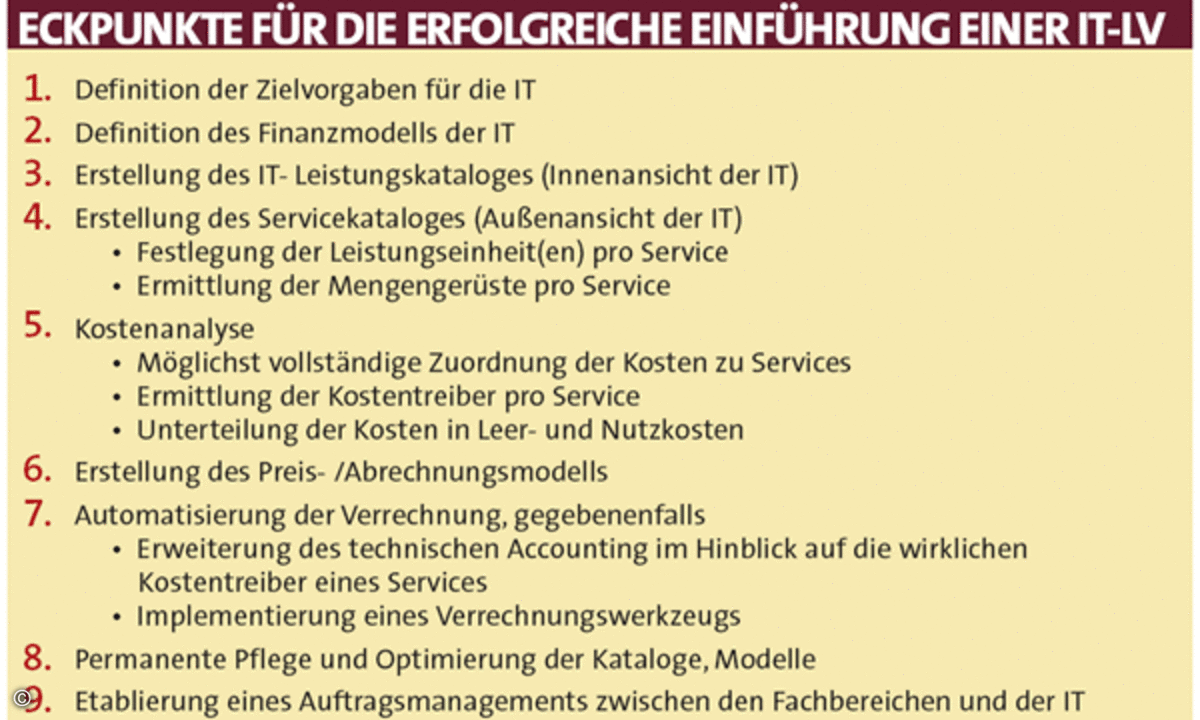
Die Einführung einer IT-Leistungsverrechnung (IT-LV) bedeutet für die IT-Abteilung nicht nur die Änderung der Abrechnungsmodalitäten: von überhaupt keiner Verrechnung oder pauschalen Umlage hin zu einer nutzungs- beziehungsweise verbrauchsorientierten Abrechnung. Letztlich entscheidend für den Erfolg ist aber eine andere Entwicklung, nämlich die konsequente Ausrichtung als Dienstleistungseinheit für die Fachbereiche des Unternehmens. Bereits vor Einführung einer IT-LV müssen grundlegende Entscheidungen getroffen werden. Die Erfahrung zeigt aber, dass in vielen Projekten schon am Anfang schwerwiegende Fehler gemacht werden. So versäumen es Unternehmen häufig klare Zielvorgaben beziehungsweise Zielvorstellungen zu formulieren. Diese sind jedoch zwingend erforderlich, damit sich die IT als Dienstleister für seine Fachbereiche positionieren kann. Zudem wird nicht selten eine IT-LV eingeführt, ohne vorher das Finanzmodell (beispielsweise Cost-Center, Profit-Center) eindeutig definiert zu haben, sodass ein solides Preismodell nicht zu erstellen ist. Neben diesen harten Fakten müssen bei den Einführungsüberlegungen einer IT-LV auch weiche Faktoren berücksichtigt werden. Einer davon ist die Wahrnehmung der IT durch die Fachbereiche. Ohne eine positive Wahrnehmung der IT als kompetenten und verlässlichen Partner wird die Einführung mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitern. Nur selten sind die Fachbereiche bereit, die geforderten Preise für die »gefühlte« Qualität der Leistungen zu zahlen.
IT-Kataloge
Sofern die ersten drei Punkte erfüllt sind, muss der IT-Leistungskatalog (Innenansicht der IT) erstellt beziehungsweise überarbeitet werden. Aus seinen Elementen resultiert der IT-Servicekatalog (Außenansicht der IT). Wird bei der Erstellung des Leistungskataloges die Frage beantwortet, welche Leistungen für die Fachbereiche mittelbar oder unmittelbar erbracht werden, muss beim Servicekatalog die Frage geklärt werden, welche Leistungen in welcher Kombination und Detaillierung als Service an den Kunden weiterverrechnet werden. Der Servicekatalog ist die Leistungsschnittstelle zu den Fachbereichen und damit ein strategisches Werkzeug für die IT. Insofern reicht es nicht aus, im Rahmen der IT-LV einmalig einen Servicekatalog zu erstellen. Im Gegenteil: Er sollte fortlaufend an die veränderte Leistungserbringung der IT und die Leistungsanforderungen der Fachbereiche angepasst werden. Nicht alle Leistungen, die der IT- Bereich für die Fachbereiche erbringt, müssen dabei im Katalog enthalten sein. Aus rein pragmatischen Gesichtspunkten gibt es in den meisten Servicekatalogen einen Service für individuelle Aufträge. Entscheidend dabei ist, alle wesentlichen Leistungen für die Fachbereiche diesen auch zu berechnen. Gelingt das nicht, werden sie wahrscheinlich auf die anderen Services im Katalog verrechnet und das führt zu einer Verzerrung der Kostensituation und widerspricht dem Ziel der Kostentransparenz.
Kostenoptimierung
In erster Linie gilt es, die für jeden einzelnen Service anfallenden Kosten zu ermitteln. Dabei ist es entscheidend, mit einer Analyse die jeweiligen Kostentreiber zu finden und zu ermitteln, wie sich der Gesamtaufwand des Services auf die Leer- und Nutzkosten verteilen. Diese Kenntnisse helfen bei der künftigen Kostenoptimierung und bei der Erstellung eines Preismodells für den Service. Typisch für die Kostenzusammenhänge in der IT ist, dass der überwiegende Teil der Servicekosten den Leerkosten zugeordnet werden muss. Zu den Leerkosten zählen beispielsweise. Softwarelizenzen, Hardwarekosten, Kosten für Wartungsverträge, Kosten aus dem Bereich Facility Management sowie der überwiegende Teil der Personalkosten. Dabei wird der Anteil der Personal- an den Leerkosten häufig unterschätzt. Zusätzliche Analysen und Überlegungen dienen dazu, den definierten Services im Katalog einen adäquaten Preis zuzuordnen. In der Regel werden dazu Preismodelle beziehungsweise Abrechnungsmodelle entwickelt. Dabei wird für jeden Service definiert, über welche Leistungseinheit die Abrechnung erfolgen soll, etwa Transaktion, Nutzer und Report. Anschließend werden für die Leistungseinheiten die Mengengerüste ermittelt, die häufig aus der Vergangenheit extrapoliert werden, sofern die Datenlage dies zulässt. Parallel zu diesen Überlegungen gilt es, die Kostenstruktur jedes Service detailliert zu betrachten. Die Definition des Preismodells für einen Service erfordert, dass der Service auch bei nur geringerer Inanspruchnahme seine Kosten abdeckt. Denn nichts ist für eine IT imageschädlicher als am Ende des Jahres eine nachträgliche Umlage einzufordern, besonders, wenn den Fachbereichen im Vorfeld eine verursachergerechte Leistungsverrechnung angekündigt wurde.
Nutzer-Definition
Für jeden Service muss definiert werden, wer der Nutzer sein soll, das heißt der einzelne Mitarbeiter, das Team oder die Abteilung. So kann zum Beispiel eine OLAP-Anwendung ausschließlich in einer Marketingabteilung von drei Mitarbeitern verwendet werden. In diesem Fall trägt die Anwendung die gesamten Leerkosten (Hardware, Software, Systemsmanagement, Facility Management) und Nutzkosten (beispielsweise das Laden der OLAP-Datenbank mit aktuellen Zahlen). Eine Einzelbepreisung von Abfrage pro Nutzer würde in diesem Beispiel keine zusätzlichen Steuerungsmöglichkeiten für die IT bieten. Stattdessen genügt eine monatliche Pauschale zur Deckung der Leerkosten sowie eine Einzelbepreisung pro Ladevorgang. Würde die OLAP-Anwendung hingegen von verschiedenen Unternehmensbereichen/Kostenstellenbereichen genutzt, müsste das Preismodell weiter differenziert werden. Die Höhe des Automatisierungsgrades trägt entscheidend zu einem wirtschaftlichen Arbeiten bei. Dies gilt besonders für den Abrechnungszyklus, da die konventionelle, manuelle Abrechnung nicht nur äußerst zeitintensiv und damit teuer ist, sondern langfristig auch die Akzeptanz der Lösung innerhalb der IT in Frage stellt. Eine wichtige Entscheidung, die in diesem Zusammenhang getroffen werden muss, betrifft das technische Accounting. Gemeint ist die Bereitstellung der technischen Informationen, also welcher Nutzer welchen Service wie oft in Anspruch genommen hat. Leider verrechnen die Unternehmen dabei die Größen, die sie messen können und messen nicht die Größen, die verrechnet werden sollen, zum Beispiel die erkannten Kostentreiber eines Services. Ein gewisser Pragmatismus ist hier von Nöten, denn der Versuch, einen Service zu 100 Prozent mittels Accounting zu erfassen ist nicht nur mit erheblichen Kosten verbunden, sondern wird auch häufig die Einführung einer IT-LV langfristig verhindern.
Dr. Rainer Pollak, Consultant für DataGlobal