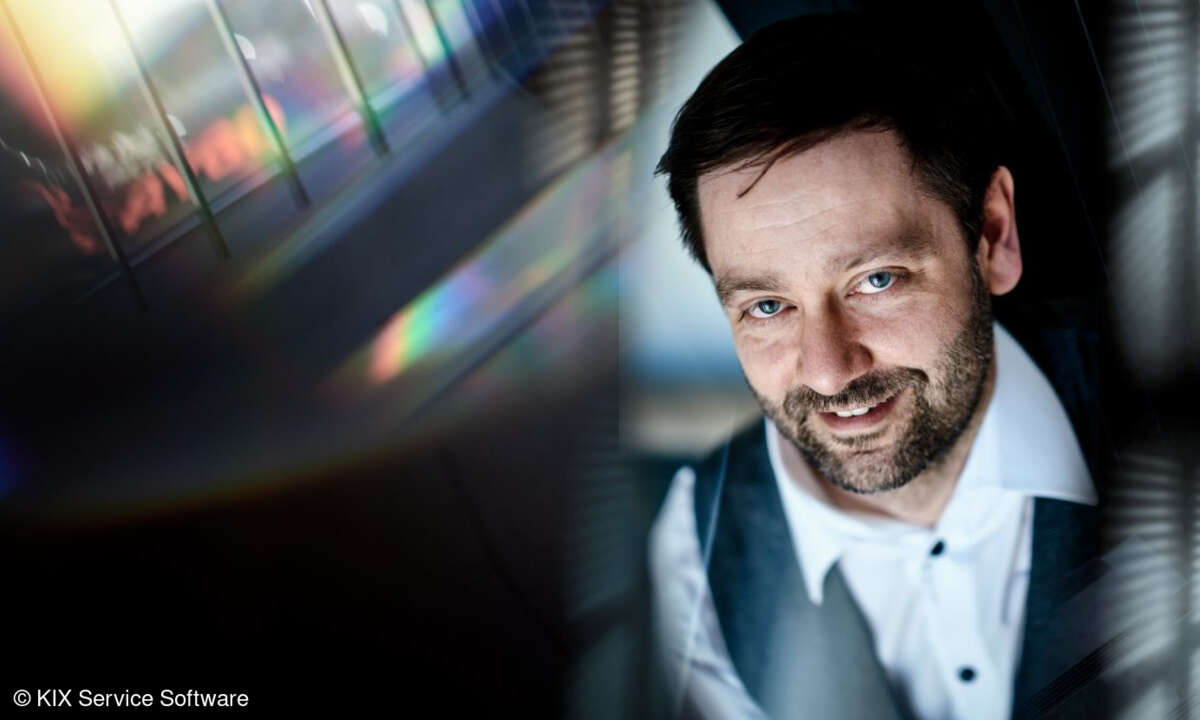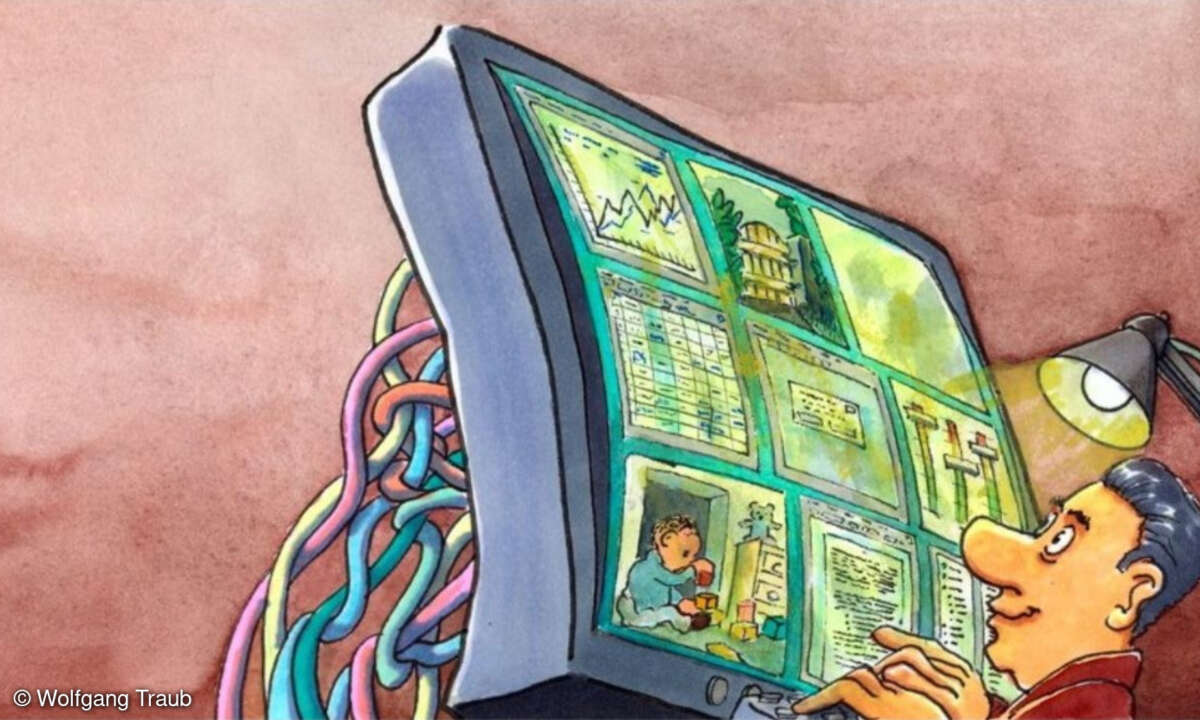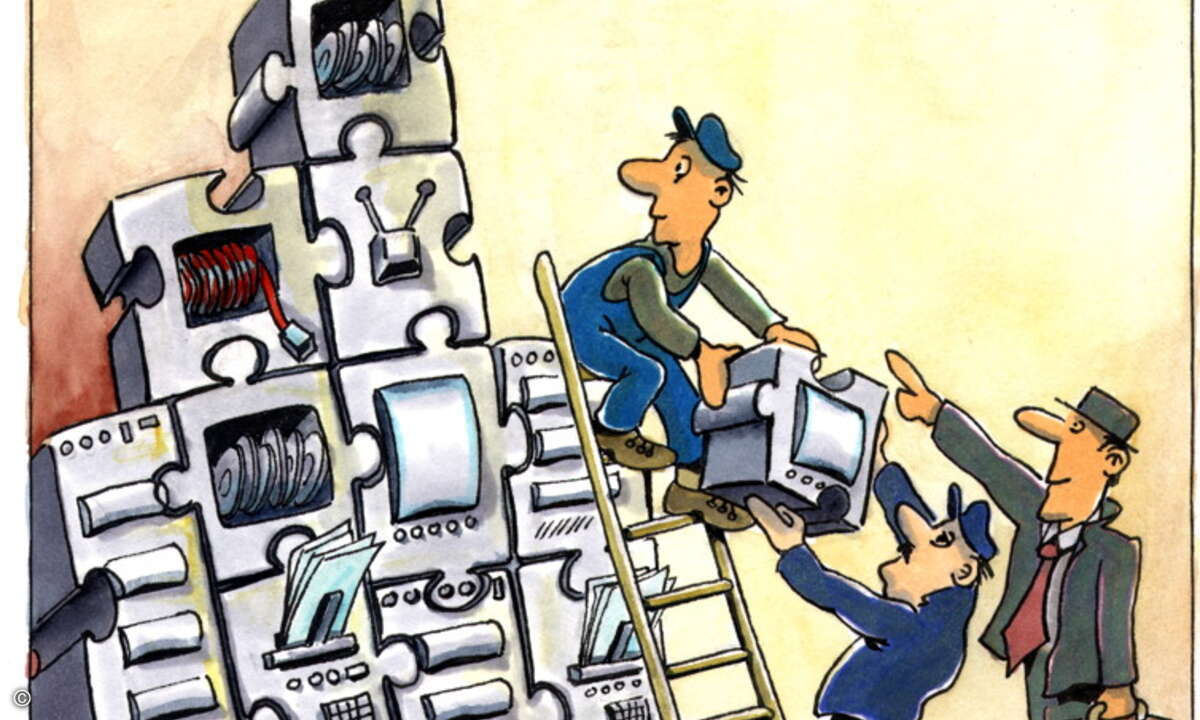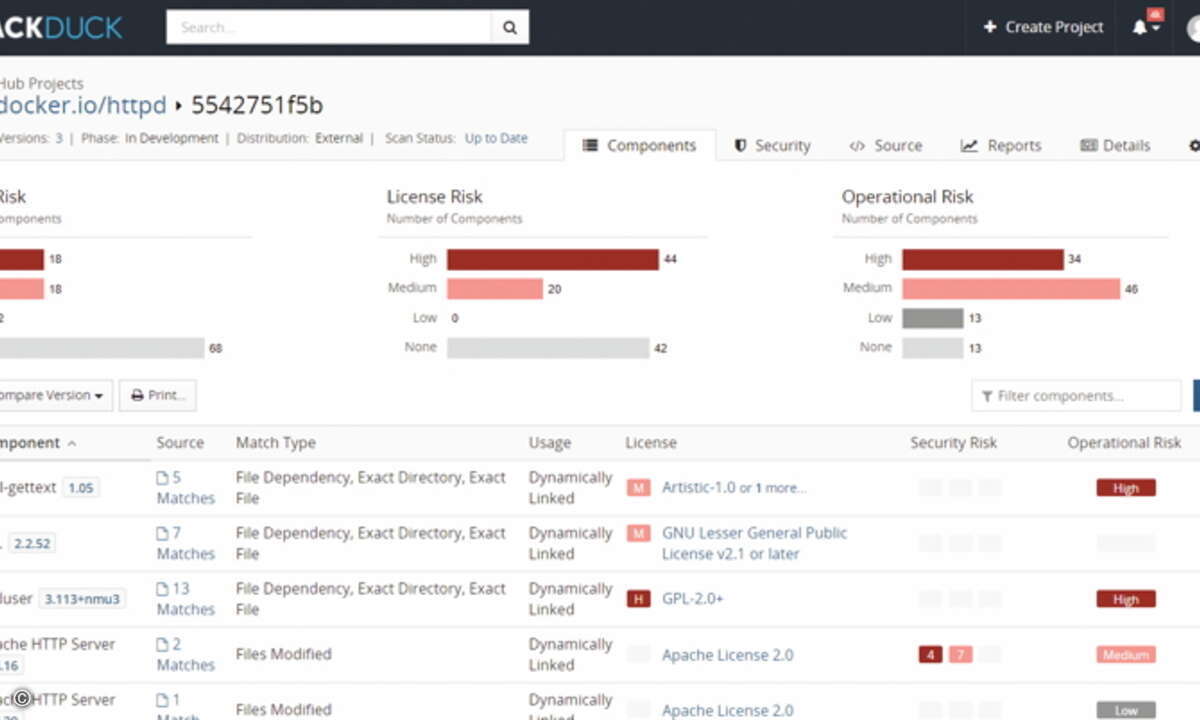Open Source oder kommerzielle Software? (Fortsetzung)
- Open Source oder kommerzielle Software?
- Open Source oder kommerzielle Software? (Fortsetzung)
Niedrigere Kosten
Bei der Konsolidierung bestehender Unix-Systeme von Herstellern wie IBM, Hewlett-Packard oder Sun kommen oftmals Linux-Plattformen zum Einsatz, da wegen der engen Verwandtschaft zu Unix das vorhandene Basiswissen auf Linux übertragbar ist. Der Anwender profitiert dadurch, dass es erheblich mehr Anbieter von Intel-basierten Servern gibt als beispielsweise von Solaris-Systemen. Dies schlägt sich im Vergleich der Hardware-Kosten nieder: »Ein Preisvorteil von Faktor zwei und größer ist hier durchaus realistisch«, schätzt Peter Ruckmann, Competence Manager Open Source bei dem IT-Dienstleister Siemens Business Services.
Auch die Hardware-Wartungskosten spielen eine große Rolle - schließlich können diese zwischen fünfzehn und dreißig Prozent der Gesamt-IT-Kosten ausmachen. Je weiter verbreitet eine Server-Plattform, desto günstiger sind die Ersatzteile und desto besser ist die Auslastung. Ein weiterer Punkt, in dem Linux gegenüber proprietären Systemen aufgeholt und gleichgezogen hat, ist der Bereich Support. Noch in den 90er Jahren mussten sich die Anwender notwendige Patches in Foren und Communities selbst zusammensuchen. Auf Grund des Zeitaufwands und der Testkosten war dies ein großer Kostenfaktor bei hohem Risiko, der die Unternehmen damals häufig abschreckte.
Über Linux hinaus
Betriebliche Anwendungen, häufig unternehmenskritische Applikationen, werden zunehmend mit Technologien der Java 2 Enterprise Edition (J2EE) entwickelt. Hier gibt es heute Entwicklungswerkzeuge und Middleware-Produkte aus dem Open-Source-Lager, die den Charakter von Industriestandards haben: Eclipse als Software-Entwicklungsumgebung, Struts als Framework für Model-View-Controller-Strukturen im Design, Apache als Web Server und Tomcat als Servlet Engine sind nahezu in allen Unternehmen anzutreffen. Eifrige Entwicklergemeinden tun das ihrige.
Ebenfalls im Kommen sind quelloffene Applikationsserver für die J2EE-Technologie: etwa Jonas von dem in Frankreich initiierten und angesiedelten Konsortium Objectweb oder JBoss von der profitorientierten Firma gleichen Namens, die gleichfalls aus Frankreich stammt. Wegen guter Stabilität und Skalierbarkeit stehen sie im Wettbewerb zu Produkten wie Weblogic von BEA oder Websphere von IBM, wenn die Anforderungen nicht zu hoch sind. Objectweb bietet über den Applikationsserver Jonas hinaus weitere quelloffene und lizenzkostenfreie Middleware an: etwa Joram, eine Implementierung des Java Message Service (JMS), und neuerdings den Enterprise Service Bus (ESB) Celtix für die Anwendungsintegration. Neben den Entwicklungskosten sinken durch quelloffene Software im Java-Bereich auch
die Betriebs- und Wartungsausgaben: Der Anwender zahlt keine zusätzlichen Lizenzgebühren, wenn die Leistungsanforderungen steigen und die Systeminfrastrukturen wachsen. Wartungs- und Upgrade-Kosten entstehen nur bei tatsächlichem Bedarf, das Unternehmen schlägt den Takt, nicht der Produkthersteller.
Auf der Datenbankebene dominieren kommerzielle Produkte, namentlich die von IBM, Microsoft und Oracle. Die Open-Source-Software MySQL des gleichnamigen gewinnorientierten IT-Unternehmens aus Schweden konnte sich im Lowend jedoch bereits etablieren. Durch den Einsatz von quelloffenen Datenbanken lassen sich unter Umständen bei geringem Aufwand beträchtliche Kostensenkungen erzielen. Es kommt jedoch sehr auf die Applikationen an. Bei unternehmenskritischen Transaktionsanwendungen führt an den herstellereigenen Datenbanksystemen derzeit kein Weg vorbei.
Auch bei Portalen gibt es inzwischen Open-Source-Lösungen. Einschränkungen bestehen jedoch, wenn Rechtezuteilungen, Rollendefinitionen, Single Sign-on und Authentisierung wichtig sind. Hier haben kommerzielle Produkte von Herstellern wie BEA, IBM, Plumtree oder SAP die Nase vorn.
Für die Fülle weiterer Open-Source-Produkte sei stellvertretend noch Samba erwähnt, ein Programm, das die Integration von File- und Print-Diensten ermöglicht. Im Bereich der Anmelde-, File- und Print-Server bietet Linux zusammen mit Samba und dem Verzeichnisprogramm OpenLDAP für zahlreiche Konfigurationen eine reale Alternative.
Open Source nicht überall
Für Anwendungen auf der Client-Ebene gibt es zwar ebenfalls ein beachtliches Angebot an quelloffener Software. Aber derzeit läuft noch auf mehr als 90 Prozent aller weltweit installierten PCs die Office-Software von Microsoft unter dem proprietären Betriebssystem Windows. Open-Source-Produkte bieten auch hier Alternativen. So ist quellcodefreie Office-Software unter KDE und Gnome vom Benutzer intuitiv zu bedienen; sie orientiert sich weitgehend an den Microsoft-Offerten. Ein umfassendes Büropaket mit Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentationen, Web-Browser oder Datenbank stellt Open Office dar, eine Open-Source-Variante von StarOffice, das Sun als kommerzielles Produkt mit erweitertem Leistungsumfang anbietet. Und mit Programmen wie dem Mail- und Workgroup-Client Evolution oder dem Mozilla-Browser gibt es auch für Web- und Mail-Anwendungen brauchbare Open-Source-Lösungen.
Wenig gibt es aus dem Open-Source-Lager indes bei den Applikationen, etwa für Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), Supply Chain Management (SCM), Web Shops oder Branchenlösungen. »Auf diesen Gebieten ist auch langfristig keine ernsthafte Konkurrenz im Open-Source-Umfeld zu erkennen«, stellt Peter Möllers, Leiter System Engineering and Multivendor Integration bei Siemens Business Services, klar.