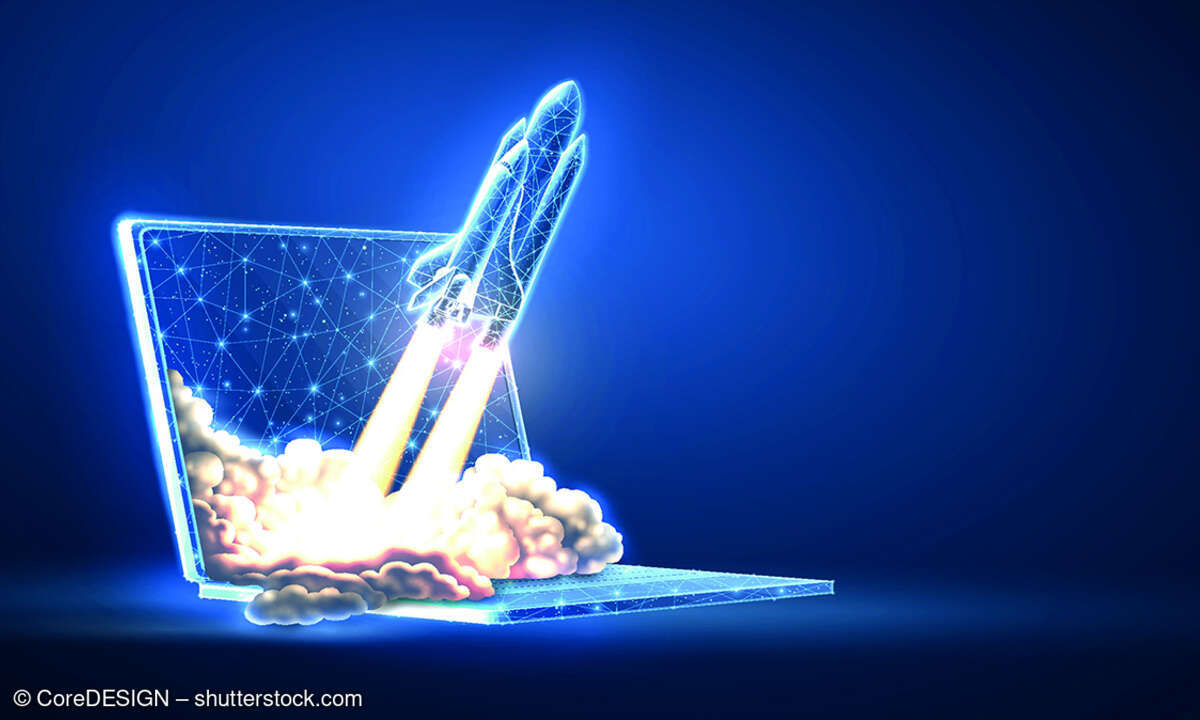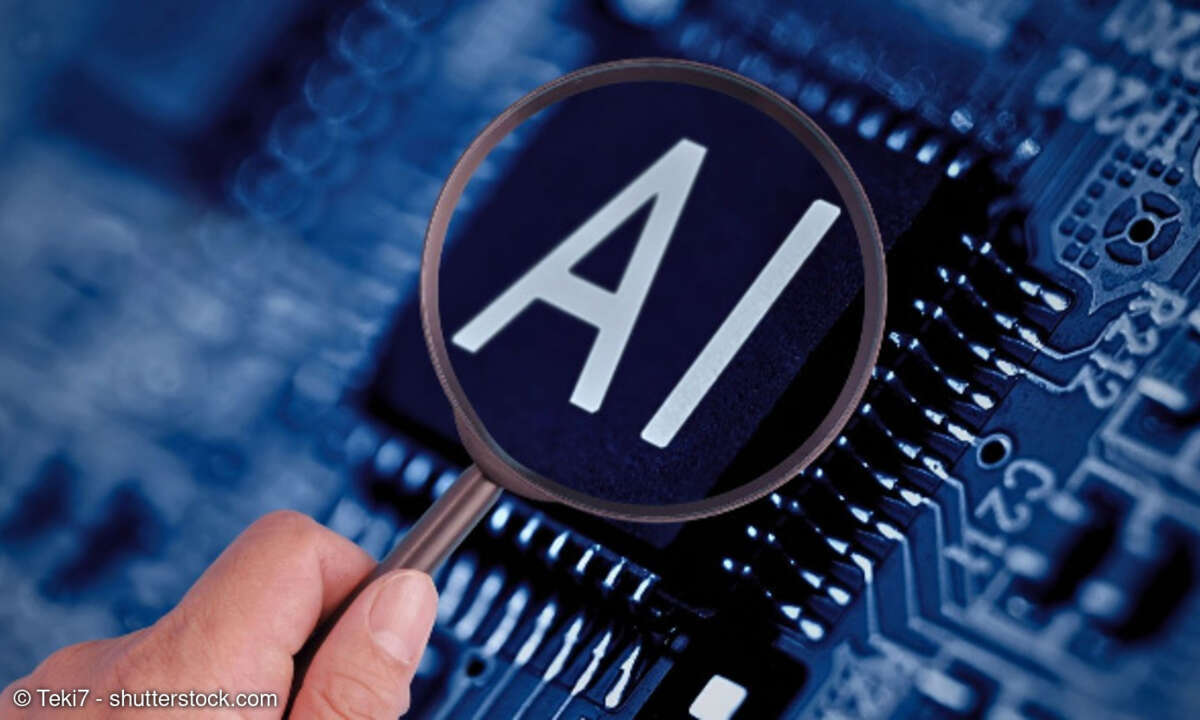Zwischen Tradition, Transformation und neuen Wachstumschancen
Scale-ups stehen in vielerlei Hinsicht zwischen Start-ups und etablierten Unternehmen; bei Finanzierungs- und Förderprogrammen fallen sie nicht selten durchs Raster. Um das Wachstumspotenzial deutscher Scale-ups voll auszuschöpfen, sollten Handlungsfelder wie Digitalisierung, Finanzierungszugang und Regulatorien gezielt angepasst werden.

Deutschland gilt seit Jahrzehnten als Land der Tüftler, Ingenieure und des Mittelstands. Doch im Zeitalter der Digitalisierung, Künstlichen Intelligenz und globalen Vernetzung sind es zunehmend Start-ups und Scale-ups, die als Impulsgeber für Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltiges Wachstum in Erscheinung treten. Während klassische Start-ups mit frischen Ideen und disruptiven Geschäftsmodellen den Markteintritt wagen, stehen Scale-ups bereits an einem anderen Punkt ihrer Entwicklung: Sie haben sich am Markt etabliert, wachsen rasant und stehen kurz davor, nationale oder internationale Champions zu werden. Derzeit zeigt sich das deutsche Ökosystem junger Unternehmen so vielfältig wie nie zuvor. Nach einem Tiefpunkt und einer Phase der Stagnation ist seit 2023/2024 wieder ein leichter Anstieg der Gründungsaktivität zu beobachten. Trotz der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen zeigen sich Gründerinnen und Gründern weiterhin optimistisch. 80 Prozent erwarten eine Verbesserung bis Ende 2025. Besonders dynamisch entwickeln sich dabei Branchen wie IT, grüne Technologien, Gesundheits- und Biotechnologie.
Gleichzeitig profitieren viele Start-ups von der engen Zusammenarbeit mit etablierten Mittelständlern und Konzernen, etwa im Rahmen von Accelerator-Programmen, Corporate Venture Capital oder gemeinsamen Innovationsprojekten. Scale-ups nehmen in diesem Ökosystem eine Schlüsselrolle ein. Sie sind nicht nur wichtige Arbeitgeber und Innovationstreiber, sondern wirken auch als Magneten für Talente und Kapital. Durch ihre Fähigkeit, neue Technologien zu verbreiten und ganze Wertschöpfungsketten zu transformieren, sind sie zentrale Akteure der digitalen und nachhaltigen Transformation. Doch ihr Weg ist steinig: Mit zunehmender Größe steigen die Anforderungen an Organisation, Finanzierung, Internationalisierung und Compliance. Dies sind Herausforderungen, denen sich viele Unternehmen oft ohne passgenaue Unterstützung stellen müssen.
Studienergebnisse zeichnen ein differenziertes Bild
Vor diesem Hintergrund liefert die kürzlich erschienene, europaweite Studie „Scaling for Growth“ von Sage empirische Einblicke in die Situation wachstumsstarker Unternehmen in Deutschland und Europa. Sie basiert auf der Befragung von mehr als 7.500 Scale-ups und Next-Generation-Scale-ups in 15 EU-Mitgliedstaaten und beleuchtet zentrale Erfolgsfaktoren, Hemmnisse und länderspezifische Besonderheiten.Im europäischen Durchschnitt verzeichnen Scale-ups demnach eine beeindruckende Umsatzsteigerung von 38 Prozent pro Jahr und wachsen damit fast doppelt so schnell wie der OECD-Benchmark für High-Growth-Unternehmen. Sie gelten somit als Schrittmacher für Innovation, Beschäftigung und wirtschaftliche Resilienz. Auch in Deutschland leisten sie einen substanziellen Beitrag zur Modernisierung der Wirtschaft, zeigen aber ein spezifisches Profil, das sowohl Stärken als auch Schwächen offenbart.
Industrielle Stärke trifft digitale Ambition
Das deutsche Scale-up-Ökosystem ist geprägt von einer industriellen Natur. Viele erfolgreiche Wachstumsunternehmen stammen aus klassischen Sektoren wie dem Maschinenbau, der Logistik oder den industriellen Dienstleistungen. Nur ein Drittel der befragten Scale-ups versteht sich als reines Tech-Unternehmen – europaweit der niedrigste Wert. Diese Verwurzelung sorgt für Stabilität und eine breite Diffusion von Innovationen, limitiert aber zugleich die Sichtbarkeit Deutschlands als Hotspot für digitale Innovation.Bemerkenswert ist die hohe Durchdringung mit digitalen Basistechnologien: 97 Prozent der deutschen Scale-ups setzen auf ERP-Systeme, die ihnen operative Vorteile und Effizienzgewinne verschaffen. 89 Prozent betrachten digitale Technologien als kritisch für ihren Geschäftserfolg. Dieser Wert liegt zwar leicht unter dem EU-Schnitt, unterstreicht aber die Bedeutung digitaler Enabler für traditionelle Branchen. Künstliche Intelligenz kommt bei 55 Prozent der Unternehmen zumindest teilweise zum Einsatz, wobei der Fokus meist auf Prozessoptimierung, Automatisierung und datengetriebenen Anwendungen liegt.
Für deutsche Scale-ups ist Nachhaltigkeit kein Lippenbekenntnis: 37 Prozent von ihnen haben ESG-Prinzipien fest in ihre Geschäftsmodelle integriert, vier Prozentpunkte mehr als im EU-Durchschnitt. Allerdings fehlt es häufig an digitalen Tools, um Nachhaltigkeitsziele messbar und transparent zu machen. Dies ist ein Aspekt, der angesichts neuer Berichtspflichten – Stichwort Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – zunehmend an Bedeutung gewinnt.Beim Gewinnen neuer Talente schneidet Deutschland im europäischen Vergleich überdurchschnittlich ab: 53 Prozent der Unternehmen sind mit der Verfügbarkeit digitaler Fachkräfte zufrieden. Hier zahlt sich das duale Ausbildungssystem ebenso aus wie die enge Verzahnung von Hochschulen und Wirtschaft. Dennoch bleibt der Wettbewerb um Top-Talente hart und die Anforderungen an digitale und KI-Kompetenzen steigen weiter.Mit einem Umsatzplus von 35 Prozent pro Jahr liegen deutsche Scale-ups wachstumstechnisch knapp unter dem europäischen Schnitt, bewegen sich aber weiterhin auf hohem Niveau. Besonders auffällig ist die starke Orientierung am Binnenmarkt: 74 Prozent sehen die EU-weite Integration als wichtigsten Wachstumstreiber – ein Spitzenwert unter den großen Volkswirtschaften.
Finanzierung, Regulierung und fragmentierte Digitalisierung als Herausforderungen
Die Studie identifiziert mehrere zentrale Barrieren, die das volle Potenzial deutscher Scale-ups hemmen. Am gravierendsten ist der Zugang zu Eigenkapital: Zwei Drittel der Unternehmen beklagen Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Wachstumskapital. Öffentliche Fördermittelgeber beziehungsweise -instrumente wie die KfW, der HTGF (High-Tech Gründerfonds) oder das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) bieten zwar eine solide Grundlage, werden aber als bürokratisch und wenig flexibel wahrgenommen. Gerade in der kritischen Phase zwischen Start-up und etabliertem Mittelstand fehlen maßgeschneiderte Unterstützungsangebote. Ein weiterer Stolperstein ist die regulatorische Komplexität.
Nationale Sonderwege, etwa beim Lieferkettengesetz, der CSRD oder bei geplanten Steuerreformen, erhöhen den administrativen Aufwand und schaffen Unsicherheit. Zudem fallen viele Scale-ups durch das Raster bestehender Förder- und Unterstützungssysteme, die entweder auf klassische Start-ups oder große Unternehmen zugeschnitten sind.Im Bereich der Digitalisierung zeigen sich sektorale Unterschiede. So werden ERP-Systeme zwar nahezu flächendeckend eingesetzt, doch gerade die Industrie- und Transportsektoren hinken bei fortgeschrittenen Lösungen wie KI, der elektronischen Rechnung (E-Invoicing) oder Prozessautomatisierung hinterher. Die Einführung des verpflichtenden E-Invoicing im Rahmen der EU-Initiative ViDA wird daher als Chance gesehen, weitere Digitalisierungsimpulse zu setzen – vorausgesetzt, sie wird nicht nur als Reporting-Tool, sondern auch als Türöffner für Automatisierung, Echtzeit-Zahlungsabwicklung und KI-basierte Compliance verstanden.
Wege zu mehr Wachstum und internationaler Wettbewerbsfähigkeit
Um das Wachstumspotenzial deutscher Scale-ups voll auszuschöpfen, gibt es mehrere Handlungsfelder. Zunächst sollte die Digitalisierung konsequent vorangetrieben werden – nicht nur durch die Einführung neuer Tools, sondern durch die Entwicklung ganzheitlicher Digitalstrategien, die auch KI, Automatisierung und nachhaltige Geschäftsprozesse umfassen. E-Invoicing kann hierbei als Katalysator dienen, wenn es intelligent mit weiteren Technologien verknüpft wird.Zudem ist eine Reform der öffentlichen Förderlandschaft notwendig. Ein zentrales digitales Portal, das bundes- und landesweite Programme bündelt, sowie flexiblere Co-Finanzierungsmodelle könnten den Zugang zu Kapital erleichtern. Die Förderangebote sollten stärker auf die Bedürfnisse von Scale-ups zugeschnitten sein und die Lücke zwischen Start-up-Förderung und klassischer Mittelstandsfinanzierung schließen.
Darüber hinaus ist der Ausbau maßgeschneiderter Talentprogramme essenziell. Die bewährten Strukturen der dualen Ausbildung und universitären Partnerschaften sollten gezielt weiterentwickelt werden, um Kompetenzen in Zukunftsfeldern wie KI, Cloud Computing und ESG-Reporting systematisch auszubauen. Workforce-Programme, die auf die spezifischen Anforderungen wachstumsstarker Unternehmen in verschiedenen Sektoren eingehen, können dabei helfen, den bestehenden Vorsprung im Talentbereich zu sichern und auszubauen.Und zu guter Letzt muss die regulatorische Harmonisierung im europäischen Binnenmarkt vorangetrieben werden. Ein „Single Digital Gateway for B2B Scaling“, das Rechnungsstellung, Besteuerung und HR-Compliance europaweit vereinheitlicht, könnte den Weg für eine neue Generation digitaler Vorreiter ebnen. Darüber hinaus sollten Exportförderprogramme künftig auch digitale Dienstleister adressieren und sich nicht ausschließlich auf klassische Industrieexporte fokussieren.
Deutschlands Scale-ups – zwischen Beharrlichkeit und Aufbruch
Die Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, dass deutsche Scale-ups über enorme Stärken verfügen, zugleich aber auch vor spezifischen Herausforderungen stehen. Ihre industrielle Verankerung, ihre breite Fachkräftebasis und ihre ausgeprägte Nachhaltigkeitsorientierung bilden ein solides Fundament. Um jedoch im internationalen Wettbewerb nicht ins Hintertreffen zu geraten, ist ein entschlosseneres politisches und wirtschaftliches Engagement in den Bereichen Digitalisierung, Finanzierungszugang und der regulatorischen Vereinfachung erforderlich. Gelingt es, diese Stellschrauben zu justieren, kann Deutschland seine Rolle als Innovationsmotor Europas nicht nur behaupten, sondern weiter ausbauen und so die nächste Generation globaler Innovationstreiber hervorbringen. Denn die Zukunft der deutschen Wirtschaft entscheidet sich nicht nur in den Werkshallen des Mittelstands, sondern auch in den digitalen Labors und Wachstumszentren der Scale-ups.
Christian Mehrtens ist Geschäftsführer der Region Central Europe bei Sage