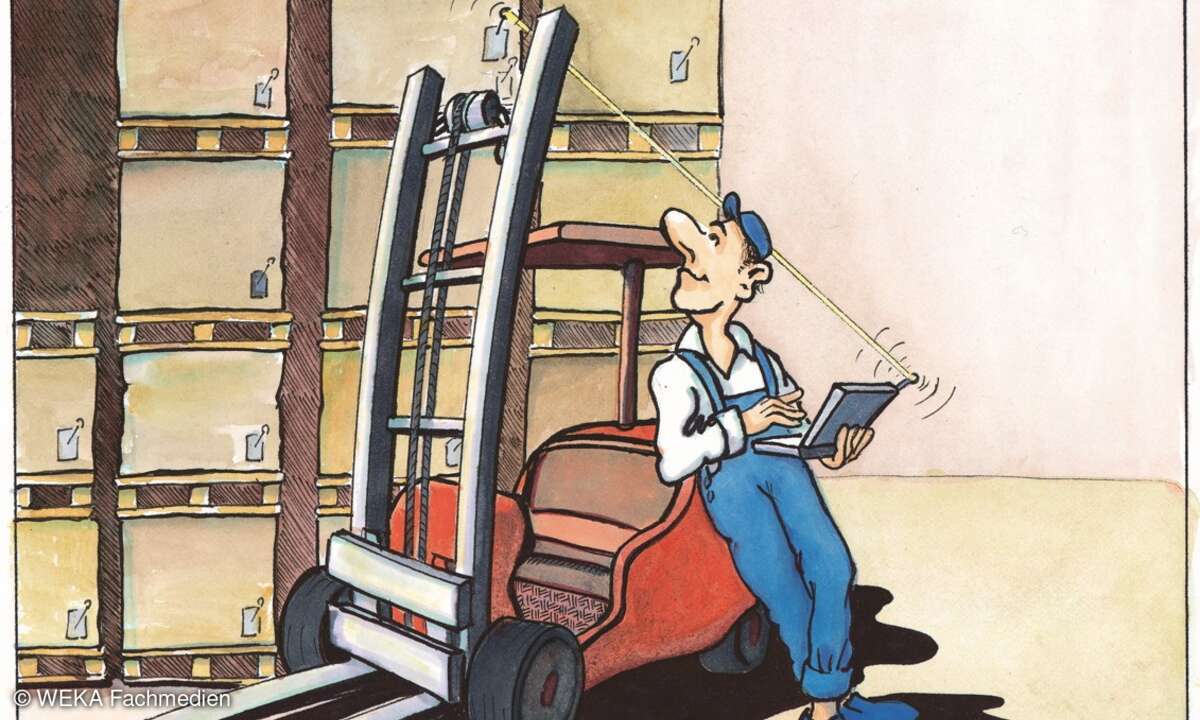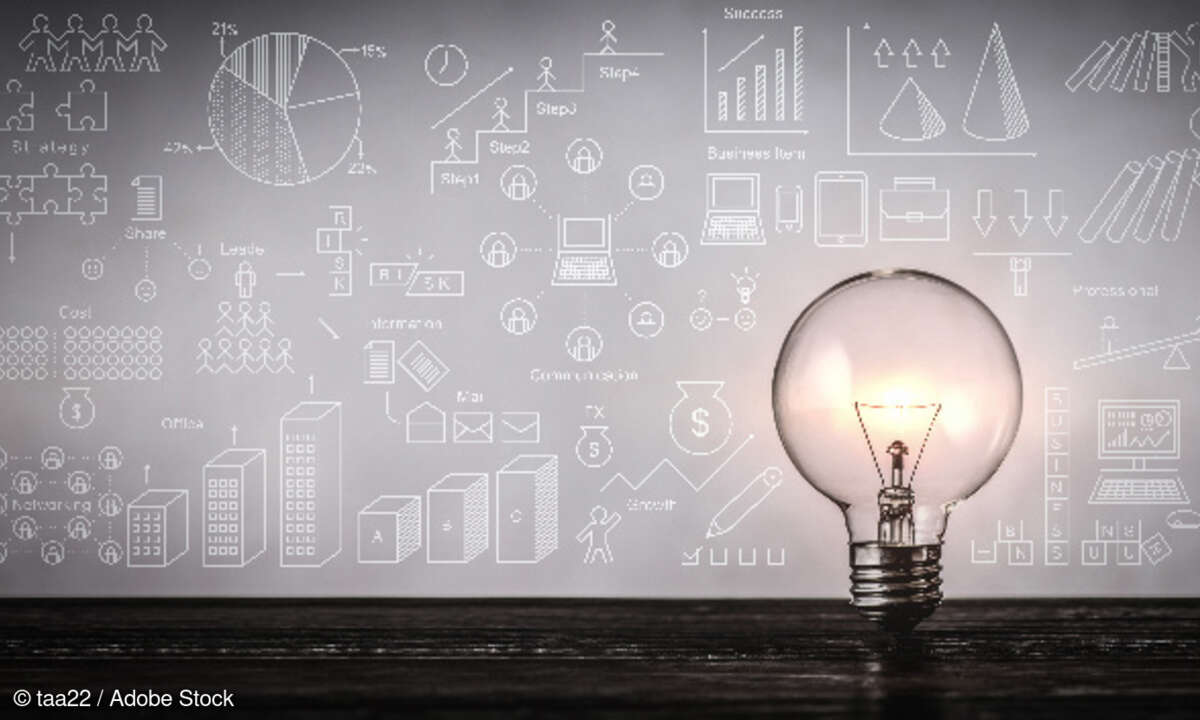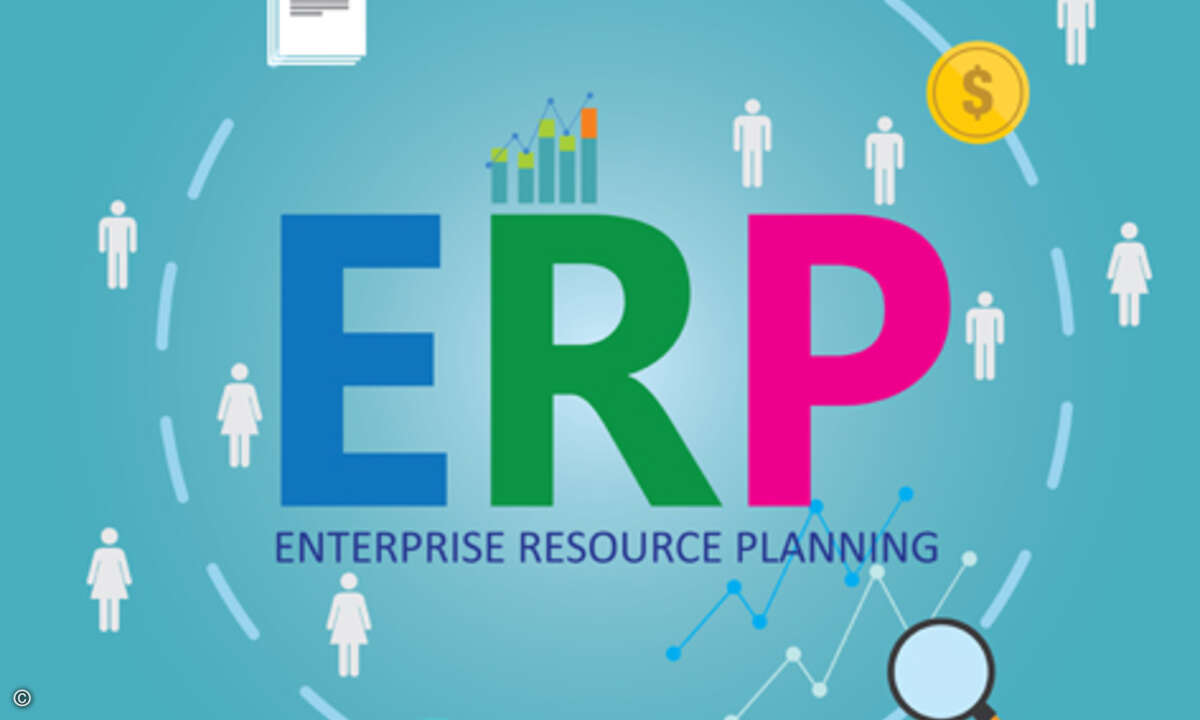Tipps und Tricks für eine gute ERP-Systemauswahl (Fortsetzung)
- Tipps und Tricks für eine gute ERP-Systemauswahl
- Tipps und Tricks für eine gute ERP-Systemauswahl (Fortsetzung)
Gute Wahl
Ein gutes Beispiel dafür, wie man strukturiert und systematisch nach einer Lösung suchen kann, zeigt das Unternehmen Bau mit Bayosan aus Bad Hindelang. Der bundesweit tätige Markenanbieter für Saniersysteme begab sich in 1998 auf die Suche nach einem neuen ERP-System für das Unternehmen. Von Juli bis Dezember dieses Jahres hat man ein Grob-Pflichtenheft definiert. Anschließend und bis März 1999 fanden Inhouse-Präsentationen von zehn verschiedenen Herstellern statt. Nur zwei davon kamen in die engere Wahl. Sie wurden mit dem Aufbau eines kostenpflichtigen Prototyps - mit der Abbildung der Kernprozesse - für das Unternehmen beauftragt. Ein Monat später stand die Entscheidung fest: die Oracle-Lösung machte das Rennen.
»Wir hatten ein sehr enges Zeitfenster für das Projekt, und die Jahr 2000 Problematik kam noch hinzu«, erläutert Ingo Bachmann, IT-Leiter der Firma Bau mit Bayosan. »Wir haben uns bewußt Zeit für eine sorgfältige Auswahl gelassen, weil uns wichtig war, unsere Geschäftsprozesse nicht wegen der neuen Software zu ändern«, erklärt der Fachmann.
Bachmann, der im Unternehmen das Projekt leitete, ist mit der Lösungswahl und mit dem Anbieter heute noch sehr zufrieden. Dank dem neuen System werden die zehn Standorte der Firma sehr flexibel verwaltet und das Personal für die Auftragsbearbeitung konnte fast um die Hälfte reduziert werden. Der Return On Investment ist dabei längst erreicht und die jährlichen IT-Kosten sind deutlich gesunken.
Die Entscheidung alles auf eigene Faust zu machen war für ihn auch genau das richtige, da »kein ERP- oder EAI-Anbieter kann die Prozesse eines mittelständischen Unternehmens auf die Schnelle optimieren, ohne Schaden anzurichten«, betont er.
Klein aber oho
Im ERP-Lösungs-Markt ist der größere Anbieter aber nicht immer automatisch der bessere oder der geeignetere für ein bestimmtes Unternehmen. Systeme von eher kleineren Anbietern und branchenspezifische Lösungen, haben sich als durchaus beliebt bei kleineren und mittelständischen Unternehmen herausgestellt.
»Man muß anstreben, immer ein A Kunde für den jeweiligen Anbieter zu sein. Nur so wird man wirklich intensiv und gut betreut. Dieses Ziel wird man nicht immer erreichen, indem man als kleine Firma, mit zum Beispiel 30 Mitarbeitern, bei SAP oder anderen sehr großen Herstellern anklopft«, betont Dr. Erich Scherer, Gründer und Geschäftsführer der anbieterunabhängigen Beratungsfirma i2s.
Dr. Scherer ist der Initiator der ERP-Zufriedenheitsstudie, die in 2003 nur in der Schweiz und 2004 auch in Deutschland durchgeführt wurde. Zielgruppe der Umfrage waren hauptsächlich mittelständische Unternehmen und deren Empfinden was die eigene Softwaresuche und -Implementierung betraf.
Wie schon im Vorjahr sind die Anwender im allgemeinen zufrieden mit den von ihnen eingesetzten Systemen. Nichts desto trotz ergab die Umfrage, dass das Maß an Zufriedenheit beim Kunden sehr stark von der Leistung des jeweiligen Anbieters abhängt. In diesem Aspekt gibt es große Unterschiede. Software-Lösungen für kleinere Unternehmen schneiden sogar besser ab als Lösungen für große Firmen. Bemerkenswert ist, dass Branchenspezialisten allgemein besser abschneiden als Generalisten. Prozesse und Rollen klar definieren
Einmal die passende Software gefunden, geht es darum, dass die Einführung der neuen Lösung im Unternehmen so reibungslos wie möglich verläuft. Ein sehr wichtiger Erfolgsfaktor bei einem solchen Vorhaben ist eine genaue Planung und Zielsetzung.
»Unternehmen müssen wissen, was sie erreichen wollen, und das sowohl auf der IT- als auch auf der Geschäftsseite. Es ist unheimlich wichtig, dass die Teams aus beiden Bereichen sehr eng zusammenarbeiten, da eine ERP-Systemeinführung immer Prozessveränderungen mit sich bringt«, betont Jürgen Helmle, Vertriebsleiter ERP bei SAP und ehemaliger Berater bei dieser Art von Projekten. Meistens gibt es bei einer ERP-Implementierung - sofern die Resourcen vorhanden sind - einen IT- und einen Business-Leiter. Eine klare Rollen- und Aufgabenverteilung ist da die beste Versicherung gegen Missverständnisse und Rivalität, die das Projekt nur unnötig belasten würden.
Um interne Prozesse abbilden und steuern zu können, müssen Firmen sie erst einmal genau kennen. Das scheint aber nicht so selbstverständlich zu sein, wie man es vermuten könnte.
»Nur wenige Firmen sind sich von Anfang an im Klaren, was sie für interne Kernprozesse haben und was das besondere an dem jeweiligen Unternehmen ist«, kritisiert Dr. Scherer.
Der gleichen Meinung ist Jürgen Helmle. Er erinnert sich an eine Situation, die er bei einem Großkunden erlebt hat: »Die Firma hatte im ERP-System um die hundert Reports für verschiedene interne Auswertungen. Das Unternehmen hat sich die Frage gestellt, wie viele davon tatsächlich notwendig wären. Wir haben anschließend mehr als die Hälfte dieser Reports abgeschaltet und abgewartet, bis sich die entsprechenden Fachabteilungen aufgrund der nun fehlenden Informationen meldeten. Die böse Überraschung lies nicht lange auf sich warten: keiner vermisste diese Auswertungen«, erklärt Helmle.
Rolle der Geschäftsleitung
Ein anderer wesentlicher Faktor für den Erfolg jeder ERP-Einführung ist die nötige und quasi bedingungslose Unterstützung der Geschäftsleitung. Es ist nicht damit getan, dass die Vorstandsetage die Initiative lediglich abzeichnet und deren Vorteile für das Unternehmen einsieht. Die Entscheider in jedem Betrieb müssen hinter dem Projekt und Projektleiter stehen. Nur so kann man schließlich die Mitarbeiter von dem Nutzen der neuen Lösung überzeugen, und als Folge dessen, eine möglichst hohe Akzeptanz erreichen.
»Ohne den ausdrücklichen Support und Willen der Geschäftsleitung ist eine erfolgreiche ERP-Einführung nicht gegeben. Die Chefetage muß dem Projekt die notwendige Rückendeckung geben und - ebenso wichtig - selbst verstehen, was die Einführung einer solchen Lösung mit sich bringt«, betont Jürgen Helmle. Da gehe es um das Verständnis, welchen Veränderungen eine Prozesskette im Unternehmen unter Umständen ausgesetzt ist.