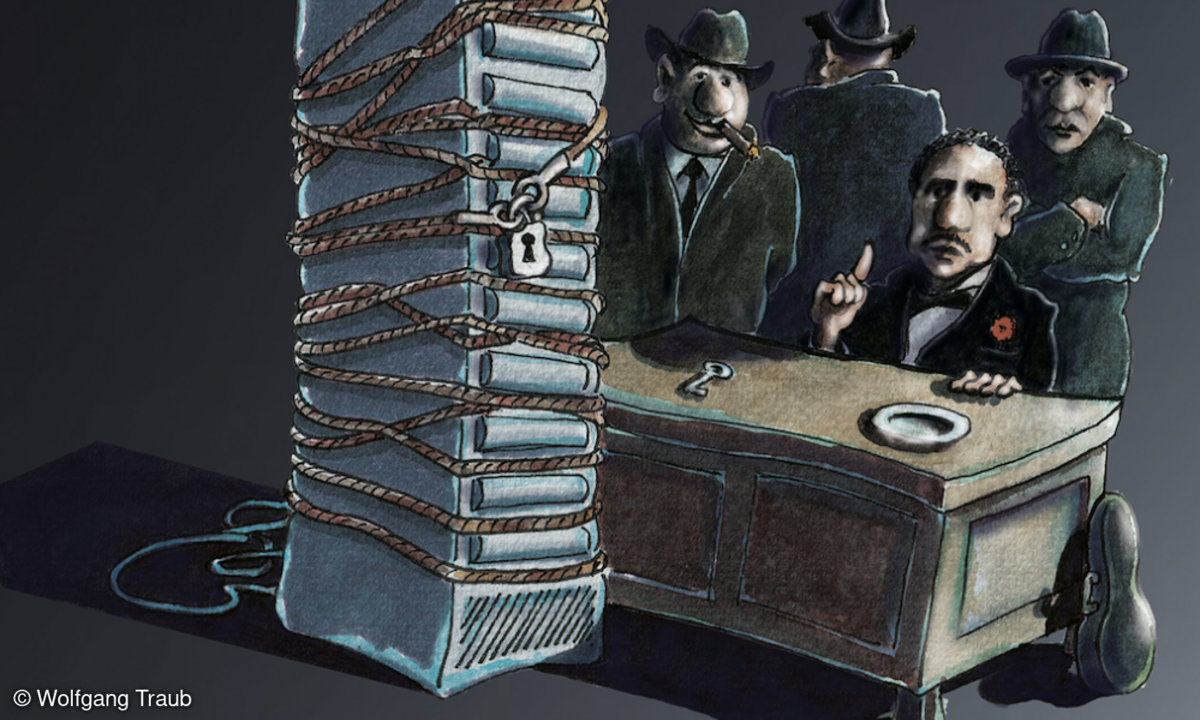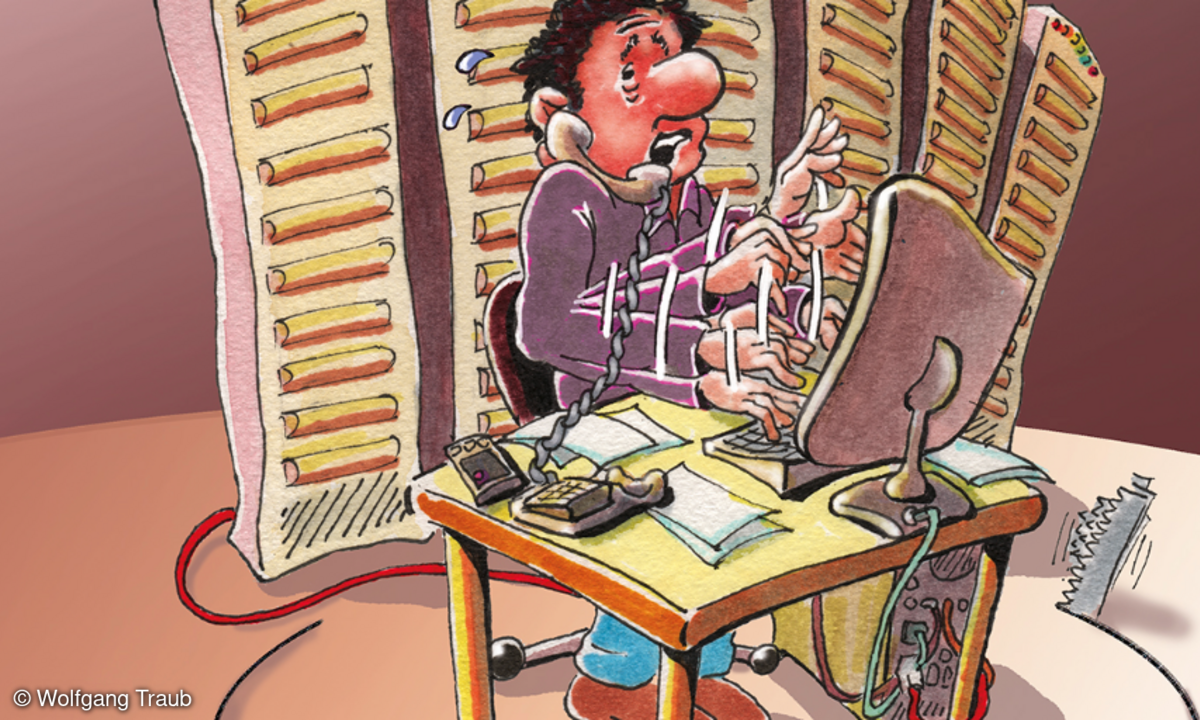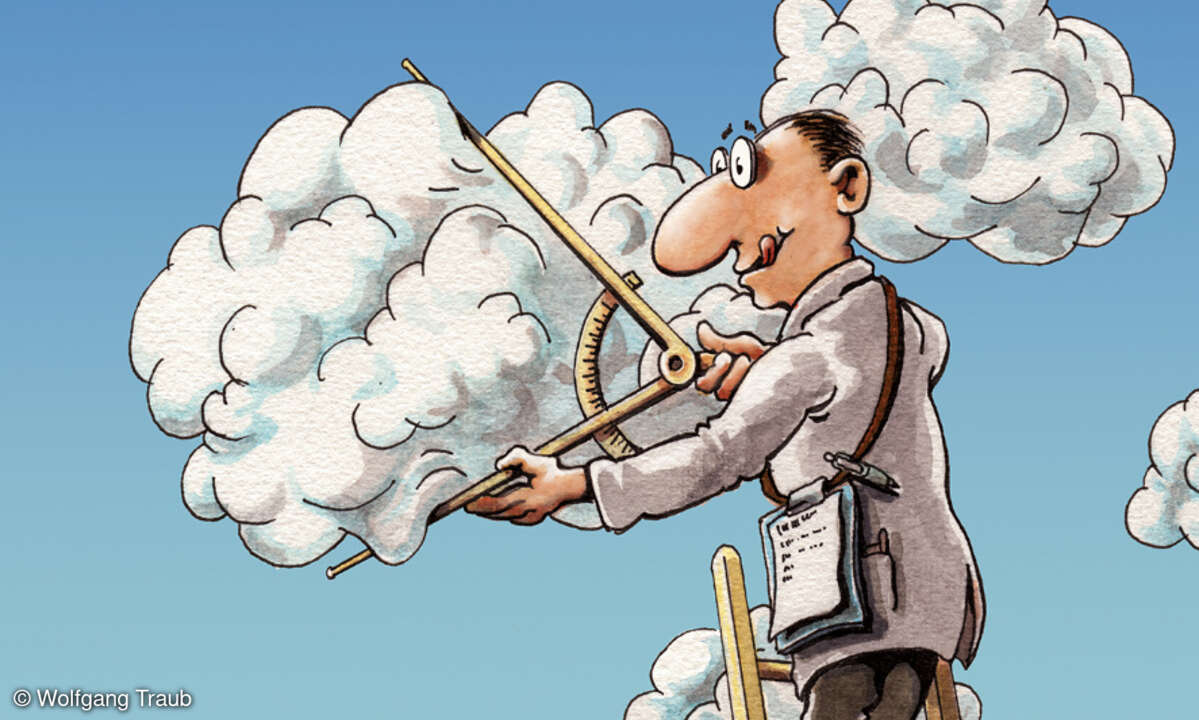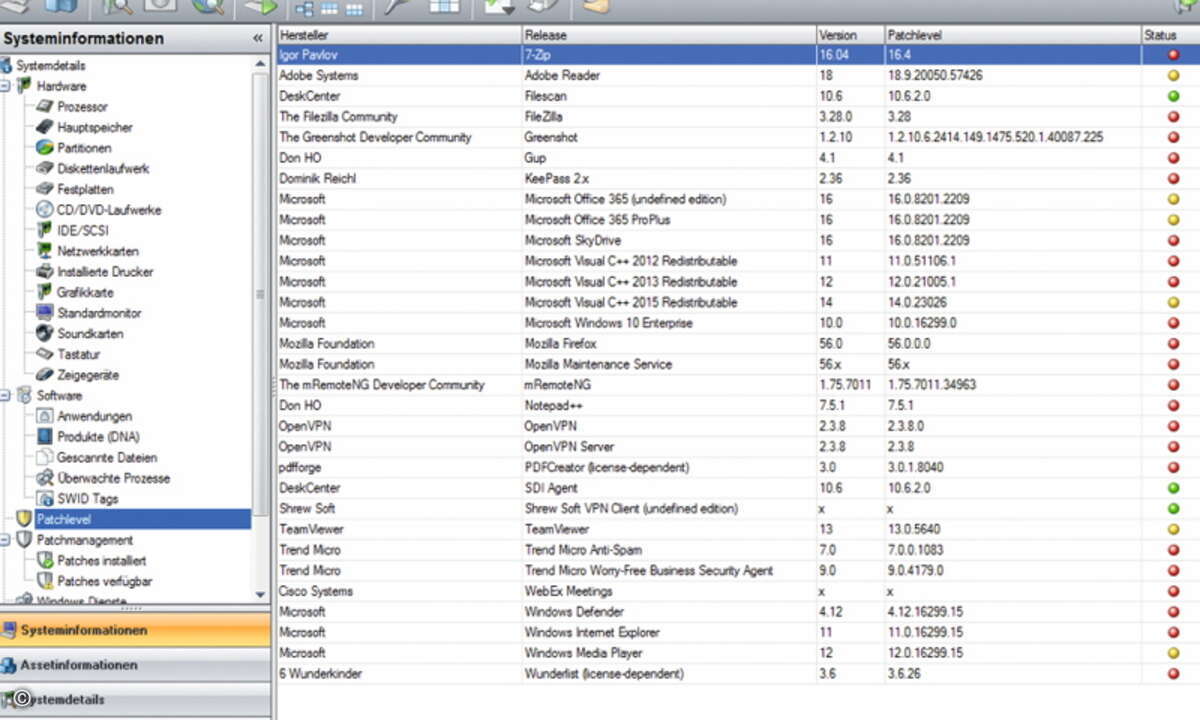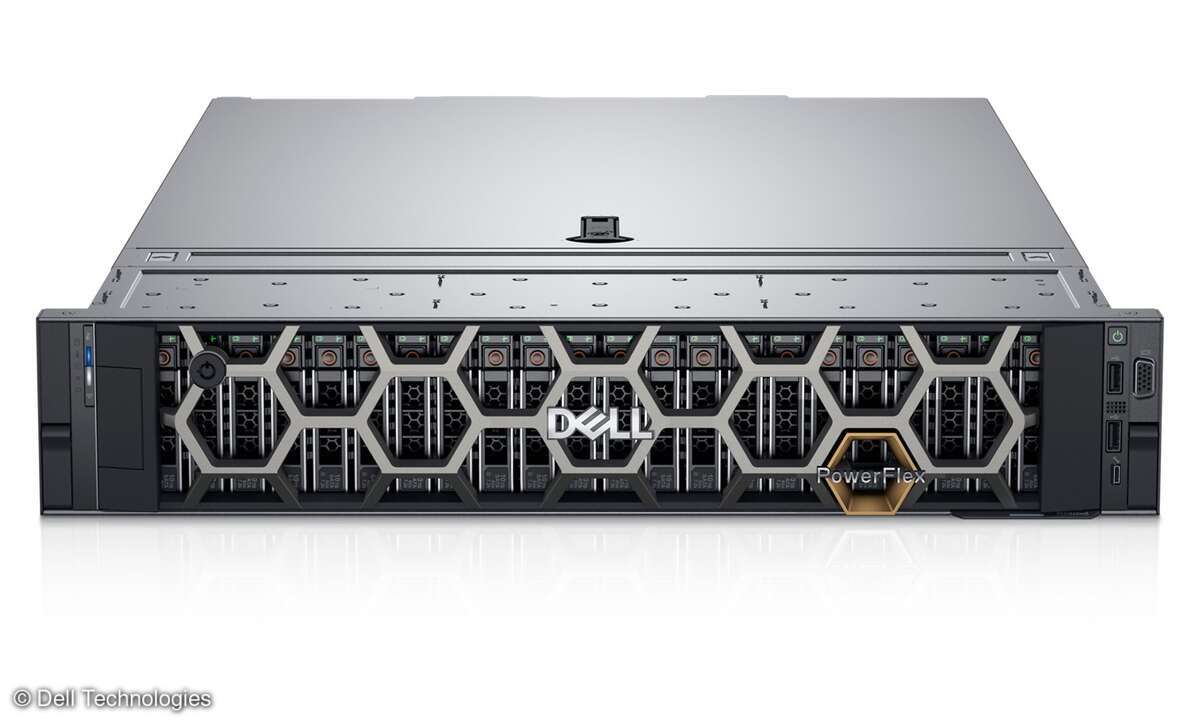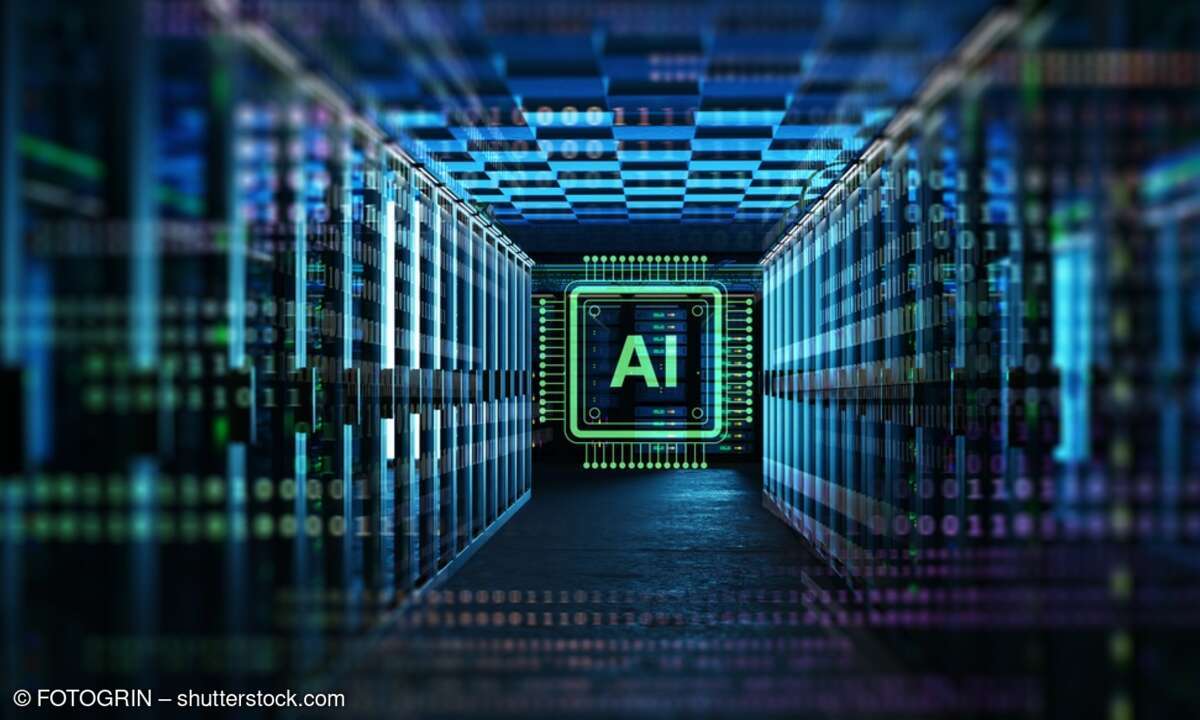Bladeserver auf dem Vormarsch
Bladeserver boomen. Bei der Konsolidierung von IT-Infrastrukturen erscheinen sie unentbehrlich. Gerade in Zeiten knapper Kassen weisen Blade-Infrastrukturen gegenüber traditionellen Rackservern viele Vorteile für die Anwender auf. Allerdings existieren auch einige Nachteile, die die IT-Verantwortlichen einkalkulieren sollten.
Die Zahlen des Marktforschungsunternehmens IDC sprechen für sich: So wuchs der Umsatz mit
Bladeservern 2007 gegenüber dem Vorjahr weltweit um 48,3 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar. Im
ersten Quartal 2008 stieg laut IDC ("IDCs Worldwide Quarterly Server Tracker", August 2008) der
Blade-Umsatz ab Fabrik gegenüber dem Vorjahr um 30,3 Prozent. Blades machten in diesem Zeitraum 9,5
Prozent des weltweiten Servermarktes aus. Der Grund für diesen Erfolg: Konventionelle Serverwelten
stoßen an ihre Grenzen. Immer mehr heterogene Serversysteme zu verwalten, ist schlicht zu teuer.
Dazu kommen die Kosten für den Energieverbrauch. Blades helfen, umfangreiche und zum Teil
unübersichtliche Serverlandschaften wirkungsvoll zu (re-)zentralisieren und zu konsolidieren. Hier
liegt ihr Charme, der das rasante Marktwachstum erklärt.
So sinkt beim Einsatz von Blade-Architekturen der Platzbedarf im Rack und im Rechenzentrum:
Verglichen mit konventionellen Servern als Konsolidierungsplattform benötigen Bladeserver erheblich
weniger Raum. Zehn Blade-Systeme verbrauchen nicht zehn bis 20 Höheneinheiten, sondern kommen je
nach Produktkonzept mit bis zu sieben aus, und während normale Serverschränke einen Meter und mehr
tief sind, messen Blade-Chassis in der Regel nur etwa 80 Zentimeter. Zu eng sollten die Systeme
allerdings auch nicht gepackt werden. Denn sonst gibt es Probleme mit der Wärmeabfuhr.
Große Redundanz- und Einspareffekte ergeben sich bei betriebswichtigen Komponenten wie Lüftern
oder Netzteilen. Beispielsweise lässt sich ein ganzes Bladeserver-Chassis nebst allen darin
enthaltenen Systemen über nur zwei Netzteile mit Strom versorgen. Selbst mit doppelter Redundanz,
wenn also in einem Blade-Chassis vier Netzteile statt zwei vorgehalten werden, lassen sich noch
immer viele Netzteile gegenüber einem voll besetzten konventionellen Serverrack sparen. Denn jeder
konventionelle Rackserver bringt sein eigenes Netzteil (oder aus Redundanzgründen zwei davon) mit.
Der Lohn kompakterer Stromversorgung: bis zu 20 Prozent Energieeinsparung bei Blade-Systemen.
Mehr Redundanz bei weniger Komponenten
Ein ähnliches Bild bietet sich hinsichtlich der Lüfter: Optimierte, größere Aggregate, die
gleichzeitig für mehrere Bladeserver zuständig sind, besitzen größere Räder. Dies bedeutet nach den
Prinzipien der Aerodynamik auch eine höhere Durchströmkraft bei geringeren Drehzahlen und damit ein
geringeres Ausfallrisiko. Da weniger Lüfter, die langsamer drehen, auch weniger Strom verbrauchen,
sparen Blade-Architekturen hier weitere zehn bis 13 Prozent Energie. Die Lüfter in konventionellen
Serverracks sind zudem in der Regel kleiner, deshalb weniger effizient, drehen schneller und fallen
daher öfter aus. Sind die Lüfter im Luftstrom horizontal doppelt vorhanden, sorgen sie auch hier
für Redundanz und damit höhere Betriebssicherheit. Im Unterschied zu Rackservern kann die
Administration im Blade-Chassis alle aktiven Komponenten im laufenden Betrieb austauschen. Dies
gilt für die Frontseite der Serverblades, ebenso wie für die Lüfter-, Netzteil-, Switch- oder
Management-Blades auf der Rückseite.
Königsweg Virtualisierung
Besonders vorteilhaft sind Blade-Systeme in Kombination mit
Hypervisor-Virtualisierungstechniken. Dies gilt zunächst für die Server selbst. Hier sind heute
durchaus Konsolidierungsgrade von 10:1 realisierbar, manchmal sogar noch höher. Ein zweiter
Virtualisierungsschritt betrifft die Ein-/Ausgabeschnittstellen, die serverübergreifend im
Blade-Chassis vorgehalten werden. Der Administrator hinterlegt auf den Management-Boards für jeden
Server eine virtuelle MAC- und WWN-Adresse (World Wide Names), die nicht mit der Adresse des
physischen Serverblades identisch ist. Letztere wird gekapselt. Auch der Lizenzserver bezieht sich
auf die virtuellen MAC- und WWN-Adressen statt auf die der physischen Systeme. Dabei gibt es für
die virtuellen Adressen separate Adressräume, sodass insgesamt die Systematik nicht
durcheinandergerät.
Dadurch lässt sich das Management der Infrastruktur erheblich vereinfachen. Der Administrator
kann problemlos Hardware austauschen, ohne dass dies direkte Auswirkungen auf das Management von
LAN-/SAN-Verbindungen, Speicherzuordnungen oder Lizenzen hätte. Gerade das Neu- und Umverteilen von
Adressen war bisher mühsam, fehleranfällig und überaus zeitintensiv. Diese Adressänderungen beim
Austausch von Serverhardware verlangten traditionell eine enge Kommunikation der
Serververantwortlichen mit den LAN- und Storage-Administratoren. Bei virtualisierten
Ein-/Ausgabeschnittstellen erhalten die jeweils Zuständigen nach der primären Konfiguration
einmalig die betreffenden MAC- und WWN-Adressen. Diese verändern sich später nicht mehr, selbst
wenn die Hardware mehrfach wechselt. Die Managementbereiche sind wieder unabhängiger voneinander.
Dies spart Zeit bei der täglichen Arbeit und verringert Reibungen. Das Einrichten neuer Server
erfolgt einfach durch das Aufspielen von Boot-Images aus den Serverbibliotheken auf die
Hardware.
Eine dritte Möglichkeit besteht darin, Virtualisierung in Blade-Architekturen auf übergeordnete
Prozesse, etwa Arbeitslasten, zu beziehen. Dann lassen sich Server leistungs- und
belastungsabhängig flexibel und ad hoc bestimmten Aufgaben zuordnen. Damit liegen Ressourcen nicht
mehr brach, wenn sie eigentlich für andere Applikationen der Infrastruktur dringend benötigt
würden. Hersteller wie etwa Fujitsu Siemens Computers bieten heute eine breite Palette von
Blade-Designs an, die unterschiedliche Prozessor- und Speicherkapazitäten kombinieren. Anwender
können beispielsweise mit den Primergy-Servern ganz nach ihren individuellen Anforderungen
ausgewogene, leistungsfähige speicher- oder prozessorlastige Blades in ihre Systeme integrieren.
Sie erhalten so eine aus mehreren, meist zwei Klassen bestehende Serverarchitektur, auf die sie die
anfallenden Lasten dann je nach den Ansprüchen der Applikationen verteilen können. Damit auch
speicherintensive Systemkonfigurationen nicht zu einem Hotspot im Rechenzentrum führen, hat das
Blade-Chassis eine mehr als doppelt so große Lufteinlassfläche als sonst üblich und lässt sich so
sehr effizient und gleichzeitig kostengünstig kühlen.
Kein Licht ohne Schatten
Ungeachtet der vielen Vorzüge existieren in der heutigen Blade-Welt auch einige Nachteile. So
ist die Midplane mit ihren neuartigen Aufgaben und Funktionen eine weitere Komponente, die
abgesichert werden muss. Schließlich ist sie, sofern mit aktiven Funktionen versehen, ein System,
das ausfallen kann. Damit die Midplane bei einem Systemversagen nicht das gesamte Chassis lahmlegt,
ist diese Komponente doppelt auszulegen oder anderweitig abzusichern.
Eine zweite Herausforderung liegt in der hohen Verdichtung von Blade-Systemen: Deren
Energieverbrauch und damit auch Abwärme pro Fläche ist größer als bei traditionellen Servern. Dies
zwingt Anwender eventuell, über eine neue Auslegung ihrer Energieversorgungs-, Kühl- und
Klimatisierungsanlagen nachzudenken. Allerdings sollte dieses Thema wegen der steigenden
Stromkosten ohnehin auf der Agenda stehen – verbrauchen Rechenzentren doch häufig mehr als die
Hälfte der Betriebskosten nicht fürs eigentliche Rechnen, sondern für den Energieaufwand.
Hinsichtlich der Abwärmeprobleme helfen einige inzwischen anerkannte Methoden. Der wichtigste
Schritt besteht in der gründlichen Analyse der gesamten Umgebung mit Vor-Ort-Messungen. Weitere
bewährte Maßnahmen sind die Trennung sowie Einhausung von kalten und warmen Gängen und das Abdecken
freier Slots, um die Luftzirkulation auf den vorgesehenen Wegen zu halten. Oft ist auch die freie
Kühlung, also die Zuführung von Außenluft zur Temperierung des Rechenzentrums, eine gute
Alternative, um Kosten zu sparen. Der Trend geht zu Systemen, deren Komponenten bei Nichtbenutzung
automatisch herunterfahren.
Noch etwas gilt es zu beachten: Die Blade-Welt basiert zwar auf x86-Designs, lässt aber deren
Kompatibilität missen. Serverblades von Hersteller A passen nicht zu den Chassis von Hersteller B,
Managementfunktionen und Midplanes sind inkompatibel. Wer sich für ein System entscheidet, bindet
sich enger an einen Hersteller als Anwender, die konventionelle x86-Rackserver wählen. Standards
hinsichtlich der Formate der Einschübe, der im System vorgehaltenen Switches oder der Funktionen
und des Aufbaus der Backplane gibt es (noch) nicht. Diesbezügliche Bemühungen stehen ganz am
Anfang. Dennoch können sich Anwender von Bladeservern schon jetzt hochentwickelten Gesamtlösungen
zuwenden, um die Vorteile monolithischer Lösungen – wie zum Beispiel ein einheitliches Management
der gesamten Serverumgebung – vollends auszuschöpfen.