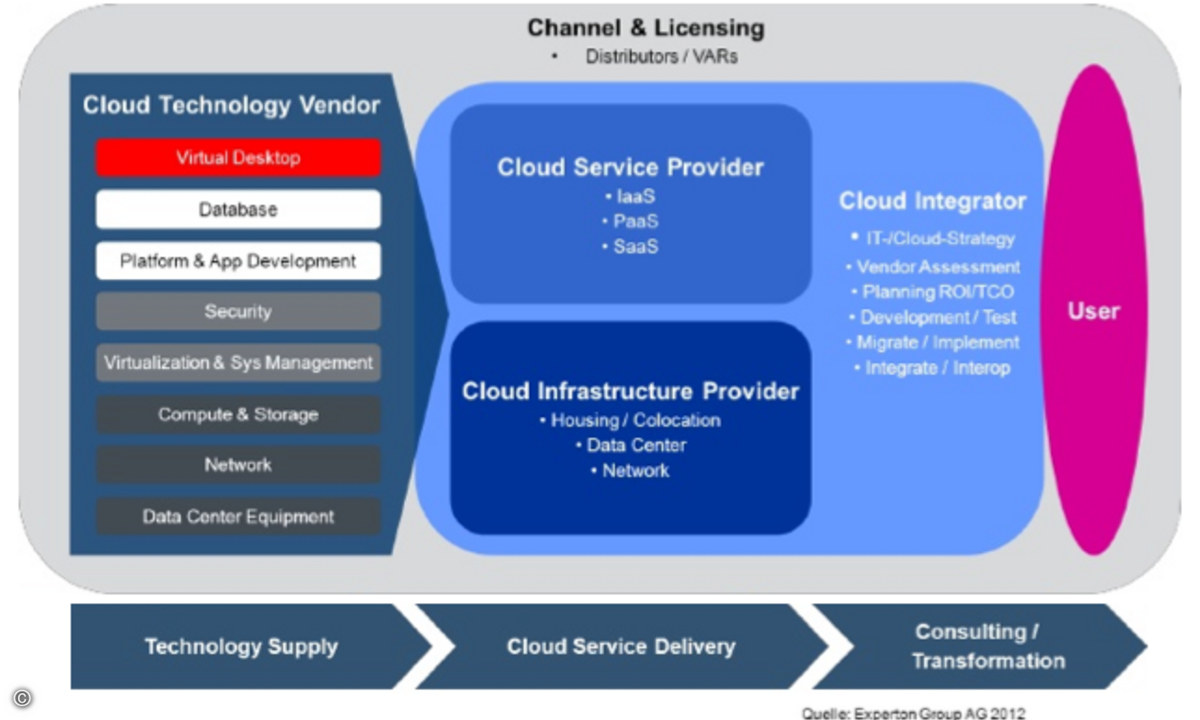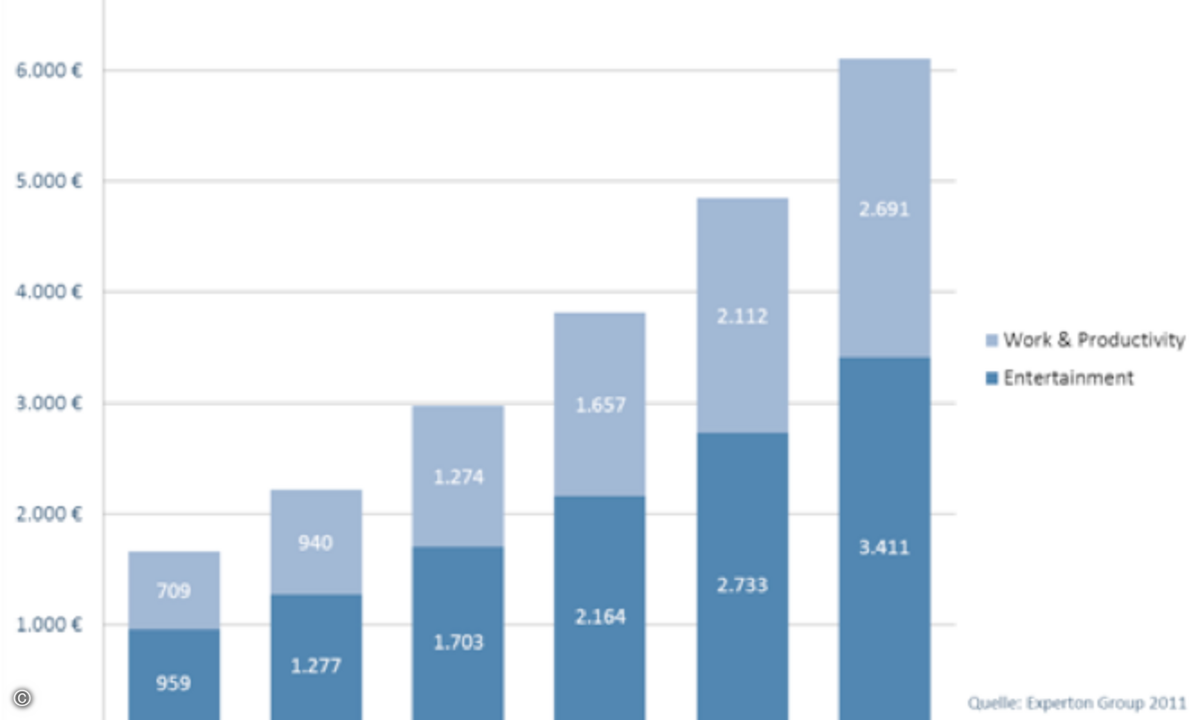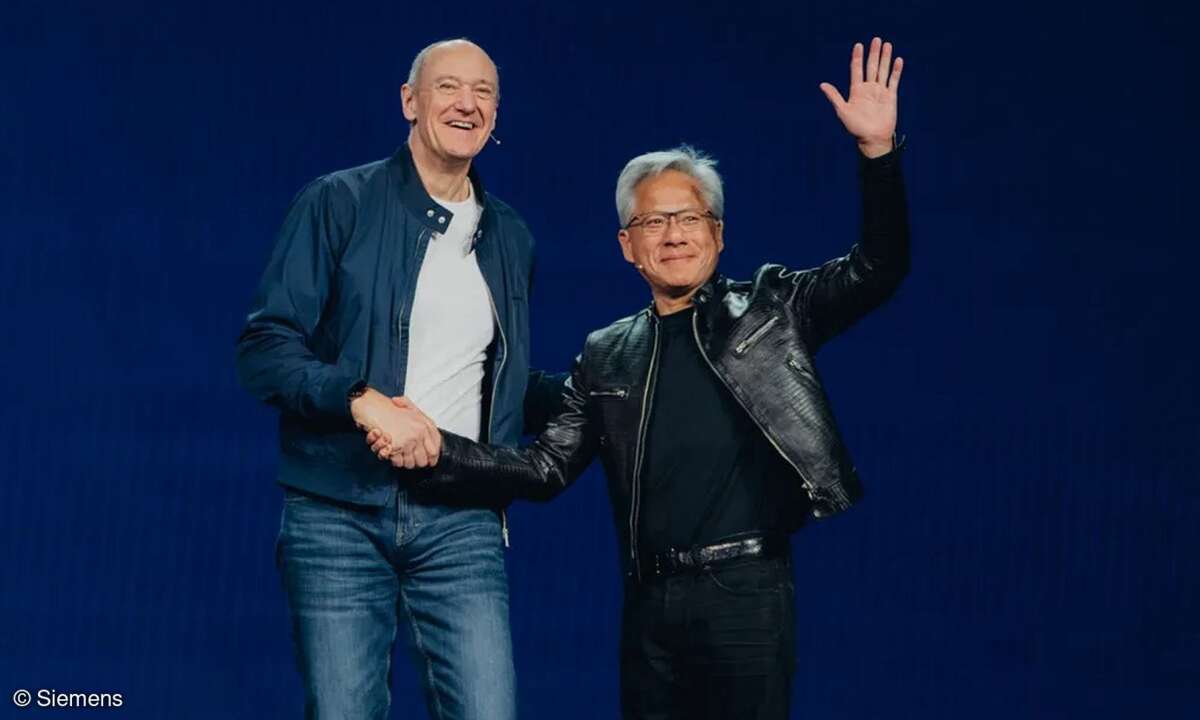Experton Group: Trotz Krise in grünes RZ investieren
Das Analystenhaus Experton Group empfiehlt, trotz Wirtschaftskrise in nachhaltige, umweltfreundliche IT zu investieren. Denn die somit erreichte Energieeffizienz spart nicht zuletzt auch Stromkosten. Neben der Client-Seite ist das RZ ein geeigneter Ansatzpunkt für solche grünen Kostensenkungsmaßnahmen.
Im Rechenzentrumsumfeld stelle sich für viele CIOs jedoch die Frage, wo sie mit ihren
Green-IT-Überlegungen beginnen sollen, so die Experton Group. Eine Möglichkeit der Priorisierung
sei die Betrachtung des Energiebedarfs im Rechenzentrum (Bild). Hier gebe sich drei
Hauptverbrauchergruppen:
* Klimatechnik mit einem Anteil von zusammen 45 Prozent des gesamten Energiebedarfs des
Rechenzentrums,
* IT-Ausrüstung, also Server, Storage und Netzwerk, mit einem Anteil von "nur" 30 Prozent
und
* die USV-Anlagen mit einem Anteil von 18 Prozent.
Wolfgang Schwab, Senior Advisor der Experton Group, empfiehlt, zunächst diese wichtigen drei
Themenkomplexe zu adressieren. Denn die übrigen Bereiche spielten eine eher untergeordnete
Rolle.
Zunächst gelte es, die Anzahl der betriebenen Rechenzentren auf ein notwendiges Maß zu
reduzieren. Der einfache Umzug von IT-Equipment in ein zentrales RZ sei aber meist nicht ohne
Weiteres möglich. Hierzu müsse das zentrale Rechenzentrum zunächst vorbereitet und optimiert sowie
zusätzlich auch der IT-Betrieb angepasst werden.
Die Experton Group empfiehlt deshalb folgende Schritte: CIOs, Rechenzentrumsleiter und
Facility-Manager sollten die Klimatechnik als erstes betrachten. Denn hier ließen sich oft mit sehr
einfachen Maßnahmen deutliche Verbesserungen erzielen. Zu den einfachen Sofortmaßnahmen zählt
Schwab:
* Richtiges Aufstellen der Racks, also Einführung eines Warm- und Kaltgangkonzepts, und
* Abdichten von doppelten Böden an Kabeldurchlässen und zu den Racks.
In einem zweiten Schritt sollten Verbesserungen durchgeführt werden, die zwar gewisse
Investitionen darstellen, in ihrer Größe aber marginal im Vergleich zu den
Betriebskosteneinsparungen sind:
* Befreien der Doppelböden von Daten- oder Stromleitungen, um einen gleichmäßigen Luftstrom und
Druck im Doppelboden zu erreichen,
* Kaltgangeinhausungen, um eine Vermischung von kalter und warmer Luft zu verhindern,
* Warmluft an besonders kritischen Racks (Blade-Server, Netzwerkkomponenten und einige
Storage-Einheiten) direkt abführen.
In einem dritten Schritt sollten laut Schwab Verbesserungen geprüft werden, die deutliche
Investitionen erfordern, in der Regel aber auch die Betriebskosten deutlich senken. Hier empfiehlt
Schwab, immer Wirtschaftlichkeitsanalysen im Vorfeld durchzuführen:
* Nutzung von freier Kühlung. Insbesondere in der kühlen Jahreszeit lasse sich ein Großteil der
Energie für die Klimatechnik so einsparen. Bei einer geplanten Rechenzentrumskonsolidierung sollten
die durchschnittlichen Außentemperaturen bei Standortüberlegungen mit einbezogen werden.
* Nutzung von kaltem Grundwasser, kalten Gewässern, etc.
* Nutzung von direkter Gerätekühlung, sodass Kälte direkt zu den Geräten geleitet und die
erwärmte Luft wieder abgesaugt wird. Das Rechenzentrum an sich wird nicht klimatisiert. Dies sei
insbesondere in Rechenzentren sinnvoll, die in eher ungünstigen Räumen untergebracht sind, zum
Beispiel Räume mit Fenstern und direkter Sonneneinstrahlung.
* Wasser statt Luft zur Kühlung nutzen. Wasser transportiert wesentlich höhere Energiemengen pro
Volumeneinheit und lässt sich wesentlich gezielter Steuern, birgt aber auch grundlegende
Risiken.
Als zweites empfiehlt Green-IT-Experte Schwab, die IT-Ausrüstung zu betrachten. Einfache
Sofortmaßnahmen seien in diesem Bereich eher schwierig zu identifizieren, da praktisch alle
Eingriffe gewisse Investitionen bedeuten, teilweise massiver interner Abstimmung bedürfen und auch
einen gewissen Einfluss auf die Überlegungen im Bereich der Klimatechnik haben können. Trotzdem
sollte man Schwabs Ansicht nach die folgenden Bereiche untersuchen:
* Virtualisierung von Servern und Storage-Systemen mit dem Ziel, die eingesetzten
Hardwareressourcen optimal zu nutzen. Intern seien derartige Projekte kaum zu meistern, sodass
externe Hilfe durch Dienstleister notwendig sei, die oft von sehr unterschiedlicher
Leistungsfähigkeit sind, warnt Schwab. Andererseits werde so Platz geschaffen, um in einem
bestehenden Rechenzentrum andere Rechenzentren konsolidieren zu können. Gleichzeitig reduzierten
virtuelle Umgebungen den Administrationsaufwand oft deutlich, sodass häufig deutlich weniger
Ressourcen für reine Admin-Aufgaben benötigt werden.
* Bei Ersatzinvestitionen sollte der reale Energieverbrauch ein wesentliches
Entscheidungskriterium darstellen, so Schwab. Da es nach wie vor an vergleichbaren
Herstellerangaben zum Energieverbrauch mangele, könnten nur konkrete Messungen an Testgeräten
weiterhelfen.
* Abschaltung von Altsystemen, die nicht oder nur minimal genutzt werden. Problematisch sei hier
die interne Abstimmung und letztlich die finale Entscheidung, welche Systeme abgeschaltet
werden.
Als dritten wichtigen Punkt rät der Green-IT-Experte, die USV-Geräte zu untersuchen. In diesem
Bereich gibt es primär zwei Techniken:
* Batterie oder Akkumulatorenpuffer, die das Rechenzentrum für zehn bis 30 Minuten mit Strom
versorgen. Diese Zeiten reichen in jedem Fall um Spannungsstörungen (Drops) zu überbrücken und bei
tatsächlichem Ausfall der externen Stromversorgung entsprechende Notstromaggregate zu starten und
langsam anzufahren.
* Rotationslösungen, in denen genügend Rotationsenergie gespeichert ist, um das Rechenzentrum
zehn bis 30 Sekunden mit Strom zu versorgen und die Notstromaggregate zu starten. Aufgrund der
geringen Überbrückungszeiten habe man hier ein Risiko, dass weitere Maßnahmen erforderlich sind.
Hier werden zum Beispiel zusätzliche Akku-Puffer und Vorheizung der Notstromaggregate (Diesel oder
Gasmotoren) eingesetzt, damit diese sofort anspringen und schnell "rundlaufen".
Für Rotationslösungen spricht laut Schwab der deutlich höhere Wirkungsgrad, da praktisch nur die
Reibungsverluste in den Kugellagern eine Rolle spielten. Andererseits müssten die Notstromaggregate
ständig auf Temperatur gehalten werden, die Rotationsmassen seien extrem schwer und drehten relativ
schnell, entsprechend massiv müssten die Fundamente sein.
Für Batterien spreche die relative lange Überbrückungszeit, die es ermöglicht, die
Notstromaggregate langsam anzufahren. Jedoch sei der Wirkungsgrad schlechter als bei
Rotationsmassen und die Herstellung und Entsorgung der Batterien (mit einer Lebensdauer von selten
über fünf Jahren) sei aus Umweltgesichtspunkten eher problematisch.
"Rotationslösungen stellen dann eine reale Lösung dar, wenn die Wärmeenergie zum Vorheizen der
Notstromaggregate durch Abwärme (aus der IT oder der Produktion) bereitgestellt werden kann", so
Schwab.
LANline/wg