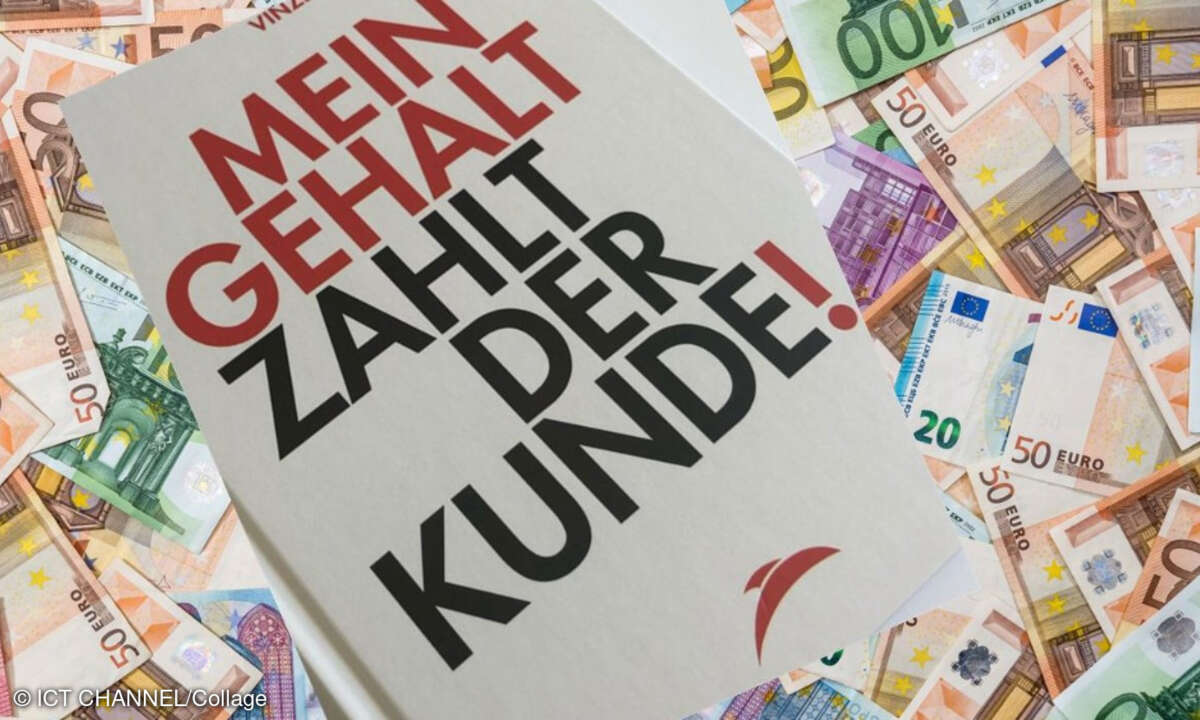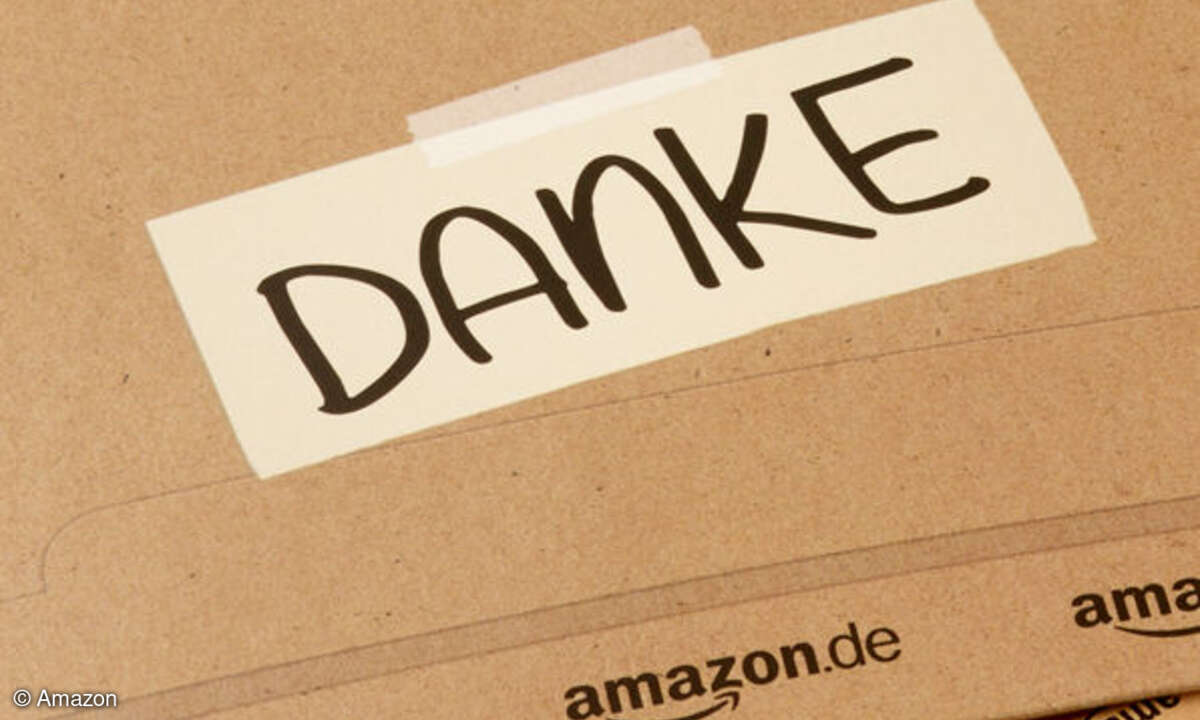Abpfiff oder Verlängerung?
Abpfiff oder Verlängerung?. Viele Outsourcing-Verträge »laufen aus«. Kunden, die sich entscheiden müssen, ob sie das Abkommen mit ihrem Dienstleister verlängern, neu verhandeln oder kündigen, sollten rechtzeitig einen Blick auf die Vertragsklauseln werfen, um böse Überraschungen zu vermeiden.
Abpfiff oder Verlängerung?
Wenn momentan vor allem über den Neuabschluss großer Outsourcing-Projekte berichtet wird, täuscht dies darüber hinweg, dass viele Unternehmen gerade jetzt über das Schicksal ihrer bestehenden Outsourcing-Verträge nachdenken. Auch wenn viele dieser Projekte durchaus erfolgreich waren, gibt es oft Verbesserungspotenzial. Der Kunde steht vor der Entscheidung, ob er den Vertrag verlängern und die notwendigen Anpassungen über die im Vertrag vorgesehenen Verfahren umsetzen will. Alternativ kann er eine Neuverhandlung des Vertrages einleiten ? entweder bezogen auf ausgewählte Punkte oder insgesamt. Schließlich ist auch eine Beendigung des Vertrages denkbar, wenn die mit dem Outsourcing verfolgten Ziele nicht erreicht wurden, sich die Strategie des Kunden verändert hat, oder sich ? etwa über einen Providerwechsel ? attraktivere Lösungen anbieten. Im Vordergrund der Prüfung steht die Frage, ob die kommerziellen und technischen Ziele des Projektes erreicht wurden. Dabei spielen naturgemäß Kosteneinsparungen, der erreichte Grad an Flexibilität und die Qualität der erbrachten Leistungen die zentrale Rolle. Wichtig ist aber auch die vertragliche Situation. Sie muss analysiert werden, bevor der Kunde sich für eine Vertragsverlängerung, Neuverhandlungen oder eine Kündigung entscheidet. Dabei sind jeweils unterschiedliche Themen bedeutsam:
Vertragsverlängerung
Eine Verlängerung des Vertrages kommt nur in Betracht, wenn sie im Vertrag vorgesehen ist. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn der Vertrag sich automatisch verlängert, solange keine der beiden Parteien kündigt. Sieht der Vertrag hingegen eine feste Laufzeit ohne eine automatische Verlängerung oder eine Verlängerungsoption vor, gibt es eine Verlängerung nur dann, wenn sich die Parteien über eine solche einigen. Bei einer Verlängerung ist von hoher Bedeutung, ob sich die Preise verändern. Enthält der Vertrag einen regelmäßigen Preisanpassungsmechanismus oder ein Benchmarkingrecht des Kunden, besteht kein Handlungsbedarf. Andernfalls riskiert der Kunde, dass ihm durch eine schlichte Verlängerung ohne Neuverhandlung von Preisen Preissenkungen entgehen, die er sonst möglicherweise durchsetzen könnte. Die Verlängerung ist die zumindest auf kurze Sicht wirtschaftlich günstigste Handlungsoption und spart die Zusatzkosten, die mit einer ausführlichen Neuverhandlung oder gar einer Kündigung verbunden sind.
Neuverhandlung
Eine Neuverhandlung des Vertrages ist dann sinnvoll, wenn zwar wesentliche Anpassungen vorzunehmen sind, die Zusammenarbeit insgesamt aber nicht in Frage steht. Themen, die typischerweise während der Laufzeit des Vertrages zu Kontroversen führen können und die deshalb häufig in Neuverhandlungen behandelt werden, sind zum Beispiel folgende:
-Leistungsbeschreibung
Leistungsbeschreibungen erweisen sich im praktischen Betrieb häufig als unvollständig. Es folgen Diskussionen, ob bestimmte, nicht ausdrücklich beschriebene Leistungen vom vereinbarten Entgelt umfasst sind oder nicht. Die während der Vertragslaufzeit gesammelten Erfahrungen ermöglichen es, bei Neuverhandlungen eine passendere Leistungsbeschreibung zu vereinbaren.
-Service Levels Agreements (SLAs)
Oft stellt sich heraus, dass die vereinbarten SLAs nicht den tatsächlichen Bedürfnissen entsprechen. Ein häufiges Beispiel ist unzureichende Detailtiefe: Eine auf den Monat gemessene Mindestverfügbarkeit kann sich beispielsweise in der täglichen Praxis als ungenügend herausstellen, wenn sie nicht durch weitere Parameter (etwa Höchstdauer oder Höchstzahl von Einzelausfällen) ergänzt wird. Neuverhandlungen bieten die Gelegenheit, auf der Grundlage der gewonnenen Erfahrungen SLAs sowie die dazugehörigen Mess-, Reporting- und Sanktionsmechanismen zu überarbeiten.
-Governance und Service Management
Bei komplexen Projekten ist das Management der Vertragsbeziehung (Beispiel: Change Requests) meist aufwändiger als erwartet. Dann ist es sinnvoll, die vereinbarten Strukturen, insbesondere das Service-Management, an die tatsächlichen Bedürfnisse anzupassen.
-Providerfreiheit
Während der Vertragslaufzeit zeigt sich oftmals, dass der Dienstleister mit mehr Gestaltungsfreiheit größere Synergien und weitere Kostensenkungen realisieren könnte. Bei Projektbeginn neigt der Kunde oft dazu, dem Provider auch dort Vorgaben zu machen, wo eine Steuerung durch den Kunden weder rechtlich noch technisch notwendig ist. Sofern die Qualität der Leistungen durch angemessene Service Level abgesichert ist, kann man die Freiheit des Providers beim »Wie« der Leistungserbringung bei Neuverhandlungen oft zum beiderseitigen Nutzen erhöhen.
Kündigung
Eine Kündigung des Vertrages ist die ultima ratio und nur dann sinnvoll, wenn die Vertragsbeziehung auch durch Neuverhandlungen nicht mehr gerettet werden kann (oder konnte). Vor der Kündigung sollte der Kunde jedoch einen Blick in den Vertrag werfen. Sind die Kündigungsfolgen unzureichend geregelt, erhöht sich das mit der Kündigung verbundene Risiko.
Wichtig aus Kundensicht ist vor allem die vertragliche Verpflichtung des Dienstleisters, den Kunden beim Transfer der Leistungen zurück an den Kunden oder an einen anderen Dienstleister zu unterstützen. Je detaillierter die Unterstützungsleistungen und die dafür zu zahlende Vergütung geregelt sind, desto weniger Diskussionen gibt es später. Ergänzend ist ein Exit-Plan sinnvoll, den der Dienstleister während der Vertragslaufzeit erstellt und pflegt.
Eine Rückführung der IT ist nur dann denkbar, wenn der Kunde über das für den Weiterbetrieb notwendige Personal und Know-how verfügt. Gute Outsourcing-Verträge geben dem Kunden die Möglichkeit, durch Übernahme ausgewählten Personals oder über Unterstützungsleistungen des Dienstleisters das eigene Know-how wieder aufzubauen. Prüfen sollte man auch die Regelungen über den Transfer von Hardware und Software sowie die damit verbundenen Kosten. Für die vom Dienstleister eingesetzte Software gilt: Wenn der Kunde sie nach dem Vertrag nicht ohne weiteres einsetzen darf, um den Betrieb selbst fortzuführen, wird die Kündigung dadurch verteuert, dass der Kunde noch die für den Weiterbetrieb notwendigen Lizenzen erwerben muss.
In jedem Fall ist es wichtig, die Bestandsaufnahme und den Entscheidungsprozess frühzeitig einzuleiten. Outsourcing-Verträge haben regelmäßig Kündigungsfristen von mindestens einem Jahr. Kündigt der Kunde, beginnt üblicherweise ab dem Ausspruch der Kündigung die schrittweise Übertragung der Leistungen auf den Kunden oder auf einen anderen Anbieter. Gerade im letzteren Fall sollte aber der Vertrag mit dem neuen Dienstleister im Zeitpunkt der Kündigung des Altvertrages schon unterzeichnet sein. Da bei komplexen Projekten die fachlichen und rechtlichen Verhandlungen durchaus sechs Monate bis ein Jahr dauern können, muss der Kunde, um sicher zu gehen, etwa ein Jahr vor dem spätesten Kündigungstermin die vorläufige Entscheidung über das weitere Vorgehen treffen. Nur so kann er sinnvoll und ohne unnötigen Zeitdruck mit dem potenziellen neuen Anbieter verhandeln. Ähnliches gilt, wenn der Kunde zwar grundsätzlich mit dem bestehenden Dienstleister weiter zusammenarbeiten, aber wesentliche Themen neu verhandeln will. Dann müssen diese Verhandlungen so rechtzeitig eingeleitet werden, dass der Kunde im Falle ihres Scheiterns immer noch einen neuen Anbieter aussuchen, mit ihm verhandeln und den Altvertrag fristgerecht kündigen kann.
Viele Outsourcing-Verträge nähern sich dem Ende ihrer Laufzeit. Die Vertragsparteien stehen vor der Wahl zwischen einer Vertragsverlängerung, einer Neuverhandlung des Vertrages und einer Kündigung. Diese Entscheidung setzt gerade aus Kundensicht eine sorgfältige Analyse nicht nur der technischen und personellen, sondern auch der vertraglichen Situation voraus. Diese Prüfung muss frühzeitig erfolgen, damit genügend Zeit bleibt, auf der Grundlage des Prüfungsergebnisses die notwendigen Verhandlungen mit dem aktuellen oder einem möglichen neuen Dienstleister zu führen, oder ein Insourcing zu planen.
Dr. Florian Schmitz ist Rechtsanwalt und Partner der Sozietät Clifford Chance.