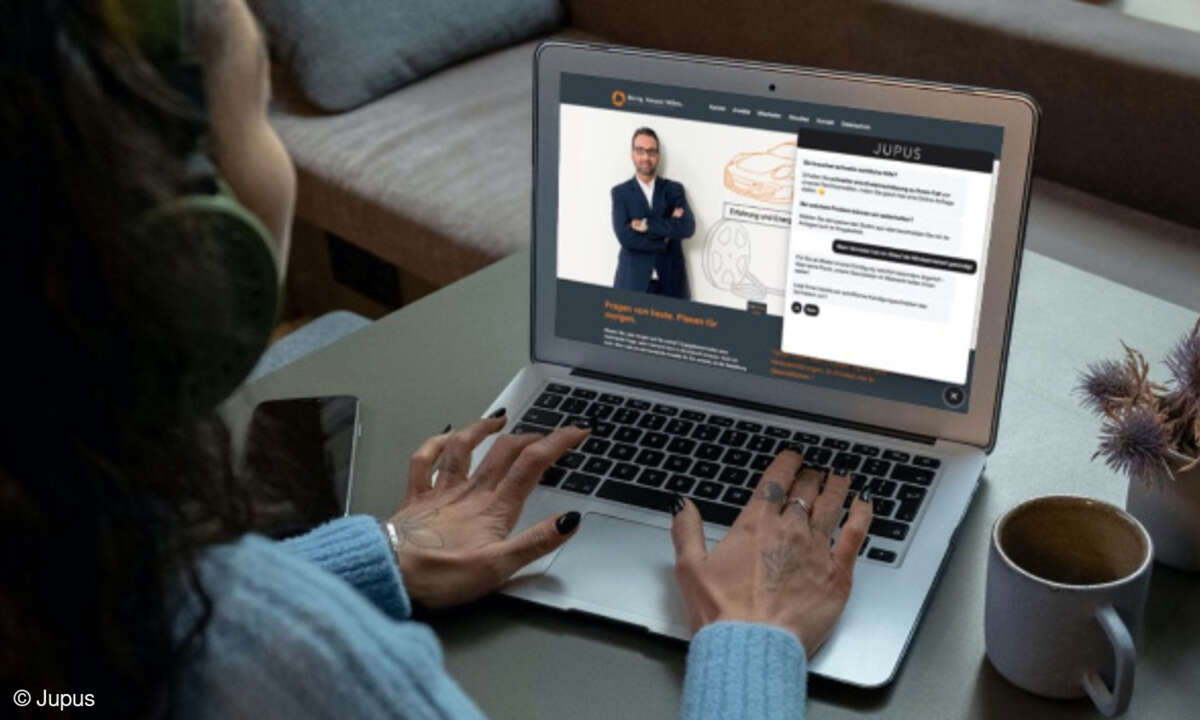Bessere Software
Bessere Software Die Burton Group empfiehlt den Unternehmen, serviceorientierte Architekturen aufzubauen und den gesamten Lebenszyklus der Software ins Visier zu nehmen.

Das amerikanische Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Burton Group hat Mitte Oktober auf seiner Europa-Konferenz in Barcelona aktuelle Analysen zur Infrastruktur-Software vorgestellt. »Der Hauptzweck der Software ist es, das Geschäft zu unterstützen«, schickt Anne Thomas Manes, Vice President und Research Director bei dieser Firma, voraus. Dazu gehört die Verwaltung geschäftsrelevanter Informationen ebenso wie die Automatisierung von Geschäftsprozessen. Die Entwicklung von Anwendungssoftware für die Unternehmen stehe indes vor großen Herausforderungen: neue Architekturen und Technologien, Entwicklung in verteilten Teams, mühselige Wartung von Altanwendungen, zunehmende Bedrohungen der Sicherheit, sich rasch wandelnde geschäftliche Anforderungen und nicht zuletzt knappe Finanzmittel. Um damit zurechtzukommen, gelte es, bessere Software zu bauen. Dazu gehört, den kompletten Software-Lebenszyklus auf den Prüfstand zu stellen. Ferner sollten die Unternehmen die Möglichkeiten quelloffener Software nutzen, wobei freilich Lizenzkostenfreiheit nicht schon durch sich selbst zu niedrigeren Gesamtkosten führe. Den Aufbau einer serviceorientierten Architektur (SOA) schreibt sie den Unternehmen groß auf die Agenda und fordert im Zuge dessen zu einem anderen »Lebensstil« auf, der sich auf Wiederverwendung stützt und Business und IT näher zusammenbringt. Effizientere Nutzung der IT-Infrastruktur und bessere »Benutzererfahrungen« seien weitere Etappen auf diesem Weg. Im Lebenszyklus der Software ist die Programmierung nur eine Phase. Davor müssen die Anforderungen erfasst und Modelle entworfen werden, danach folgen der Test, der Betrieb, Änderungen und Erweiterungen und irgendwann die Stilllegung. Eine Strukturierung des Lebenszyklus solle den Entwicklungsprozess kontrollieren, aber nicht behindern. Insbesondere gilt es Manes zufolge, die Risiken im Blick zu behalten.
Modellierung wird unterschätzt
Der Status quo sei dadurch gekennzeichnet, dass die Anforderungen oft nur dürftig erfasst sind, das Modellieren gering geschätzt wird und das Testen zu kurz kommt. Aspekten der Verwaltung und der Sicherheit versuche man meist erst nachträglich Rechnung zu tragen. Unternehmensweite Regularien gebe es kaum. An einer Verbesserung des Software-Lebenszyklus führe deshalb kein Weg vorbei. Portfoliomanagement könne helfen, die Lage bei der Anwendungsentwicklung zu überblicken und in den Griff zu bekommen. Zur besseren Kontrolle empfiehlt die Analystin, Metriken zu definieren und die entsprechenden Werte systematisch zu erheben. Nur so lassen sich fundierte Aussagen über den Return on Investment, die Auslieferung und die Qualität machen. Für eine wahrhafte »Governance«, die sicherstellt, dass die Leute tatsächlich so arbeiten, wie sie dies aus übergeordneten Gesichtspunkten sollten, werden Manes zufolge zusätzlich noch feste Verfahrensweisen, Abläufe und Organisationsformen gebraucht. Für bestimmte Themen wie SOA oder Open Source empfiehlt sie separate Governance-Verfahren, um Wildwuchs zu verhindern. Was die Entwicklungswerkzeuge im engeren Sinn anlangt, mit denen solche bessere Software zu erstellen ist, hält die Burton Group bei der Java Enterprise Edition (JEE) die Komplexität mittlerweile für zu groß und empfiehlt bei geringeren Anforderungen leichtgewichtigere Tools und Frameworks wie Spring, Struts, Hibernate, Perl, Python, PHP oder Ruby, die im Open-Source-Bereich entstanden sind, oder bei Beschränkung auf die Windows-Welt auch Microsofts .Net-Umgebung. Bei hochvolumigen Transaktionsanwendungen sei die JEE allerdings unverzichtbar.
SOA-Standards noch unreif
Um bei einer SOA Interoperabilität zu erreichen, hält Manes die Web-Services-Standards zwar für wesentlich. Doch weil die Anzahl der einschlägigen Spezifikationen inzwischen mehr als 50 beträgt und viele davon noch im Fluss sind, rät sie, nur diejenigen zu implementieren, die konkret gebraucht werden. Weiterhin nicht reif für den Praxis-Einsatz sind den Experten der Burton Group zufolge die Business Process Execution Language (BPEL) sowie die diversen Vorschläge für das Management von Web Services. Zunächst einmal macht die Entscheidung für eine SOA das Leben nicht einfacher. Und die Kosten sinken nicht, sondern steigen, wie Chris Haddad betont, Practice Manager bei der Burton Group. Die erforderliche Infrastruktur kostet Geld und muss erst einmal angeschafft werden. Programme als wiederverwendbare Services zu konzipieren, erfordert ebenfalls Extra-Aufwand. Auf lange Sicht zahlen sich die Investitionen jedoch aus, meint er.