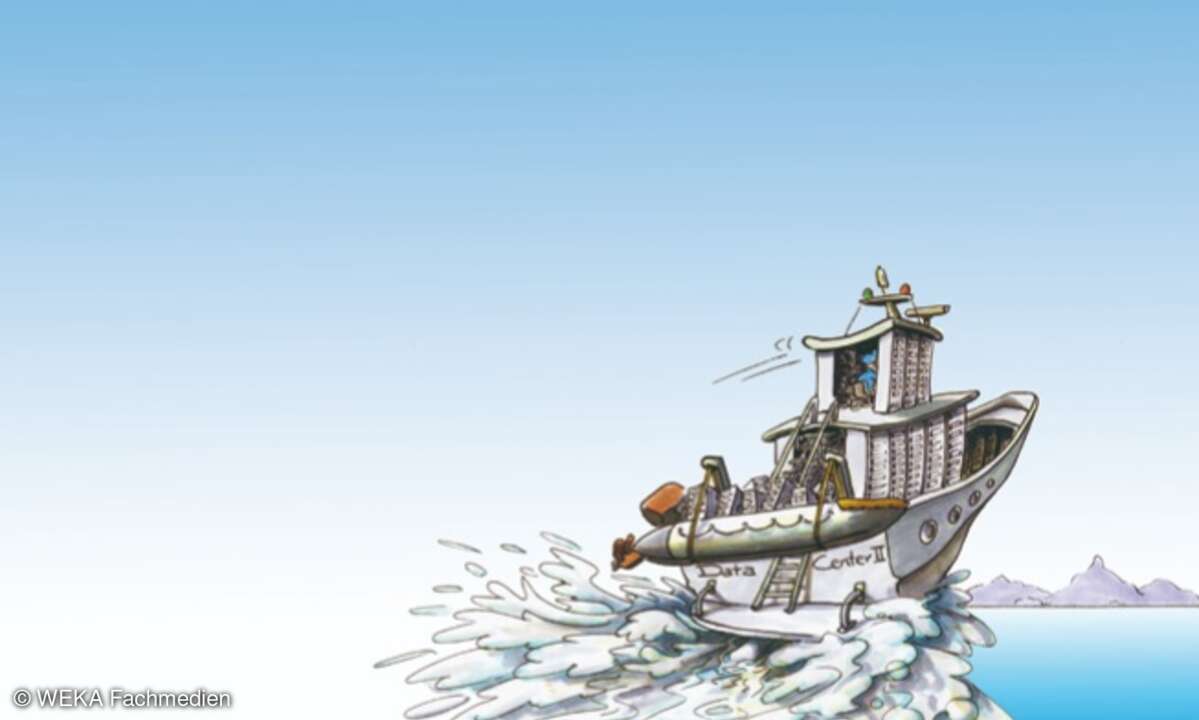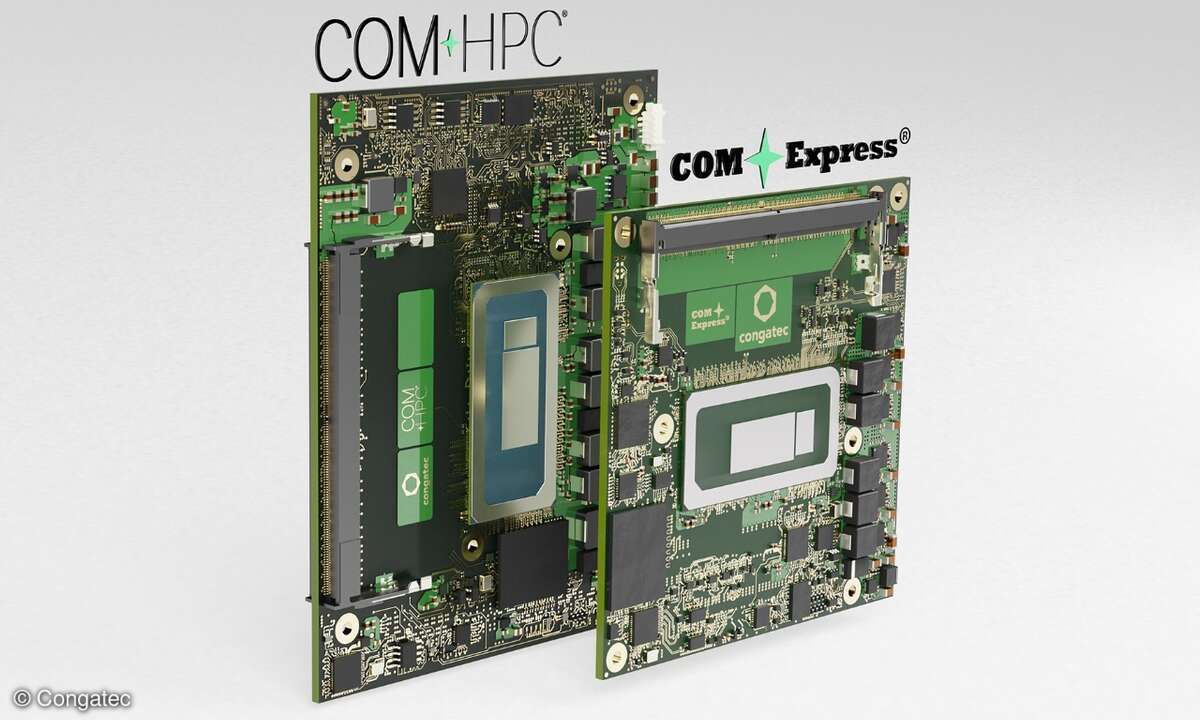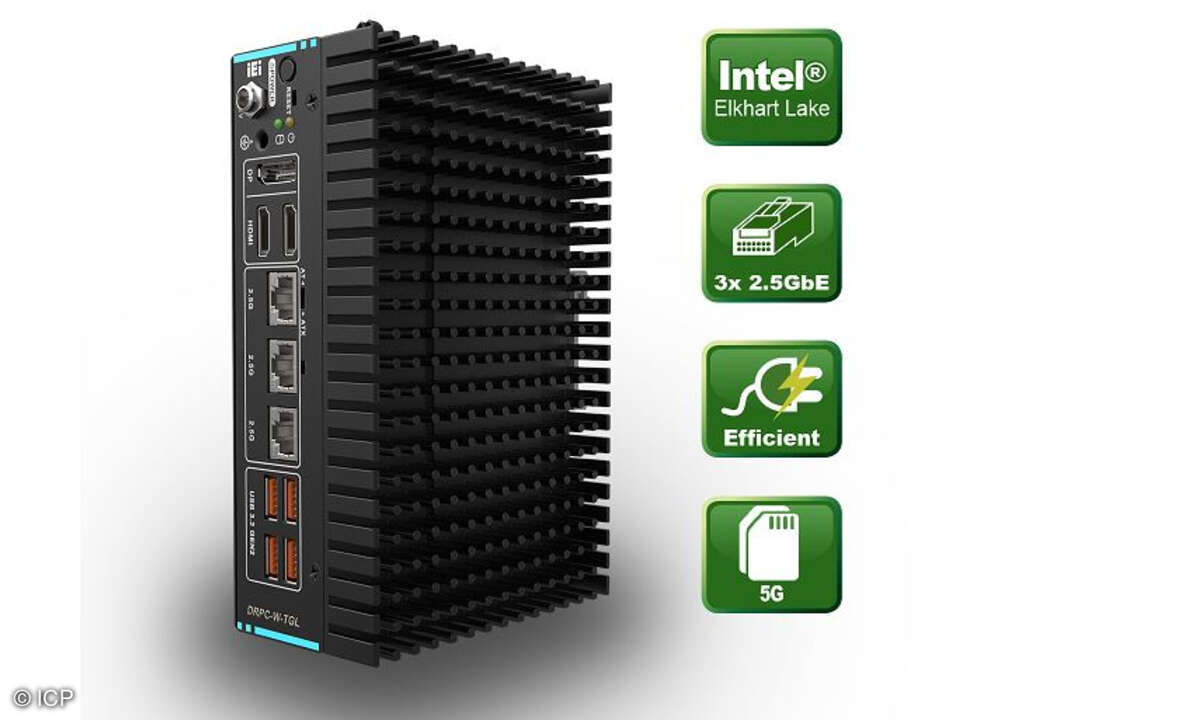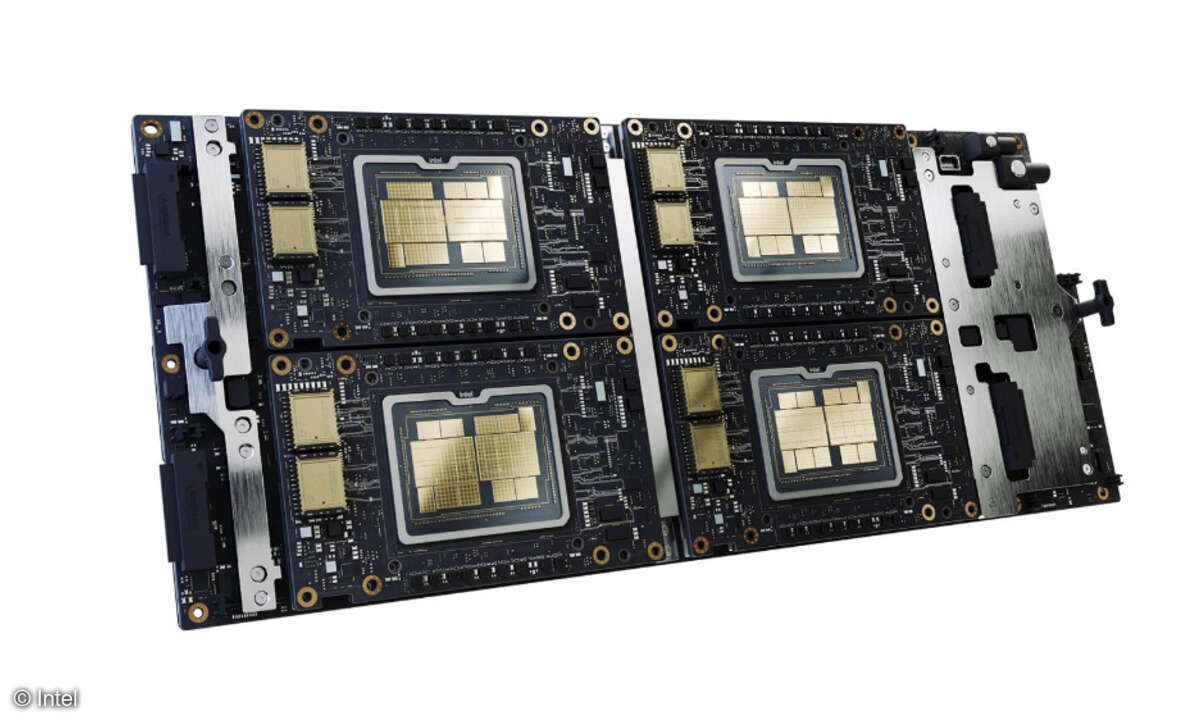Bricht Moores Law?
Bricht Moores Law?. Prozessoren werden immer kleiner und leistungsfähiger: Doch die Miniaturisierung wird in Zukunft zunehmend durch wirtschaftliche Faktoren gebremst werden. IT-Abteilungen und Entscheider werden sich aber dennoch auf neue Herausforderungen einstellen müssen.
- Bricht Moores Law?
- Bricht Moores Law? (Fortsetzung)
Bricht Moores Law?
Die Entwicklung der Prozessoren in der Mikroelektronik ließ sich bisher durch Moores Law vorhersagen. Gordon Moore, einer der Gründer der Firma Intel, sagte im April des Jahres 1965 die Verdoppelung der Integrationsdichte der Transistoren alle anderthalb Jahre voraus. Dies stimmt bis heute ungebrochen. Doch wie lange wird Moores Law noch gelten?
Die heutige Planung der Halbleiterindustrie basiert auf dem Einsatz von Silizium in der CMOS-Technologie. Die Minimalabmessungen der Transistoren betragen heute 50nm (im sogenannten 90 nm Technologie Node). Diese Abmessungen werden nach den Roadmaps der Halbleiterhersteller bis circa zum Jahre 2017 auf 10 nm zusammenschrumpfen (im 20 nm Technologie Node). In den Forschungslaboratorien liegen bereits dementsprechende Demonstratoren vor. Erst danach werden alternative Ansätze wie Quantenelektronik, Photonik, Bio- und Mo-lekularelektronik oder gar Supraleiter genutzt werden. Die Integrationsdichte der Transistoren wird sich also die nächsten fünf bis sechs Jahre weiter gemäß Moores Law entwickeln.
Keine Miniaturisierung um jeden Preis
Doch ein Abremsen oder gar der Abbruch von Moores Law ist prinzipiell denkbar - aus Gründen der Finanzierbarkeit, der gesellschaftlichen Akzeptanz, der Komplexität der Prozessoren oder durch harte physikalische Grenzen. Wobei eine Verlangsamung von Moores Law aufgrund physikalischer Grenzen sehr viel unwahrscheinlicher ist als aus ökonomischen Gründen.
Eine neue Halbleiterfabrik für den nächsten Technologie Node wird über 3 Milliarden US-Dollar kosten. Eine Miniaturisierung darüber hinaus wird noch kostspieliger sein. Zusätzlich müssen Halbleiterhersteller jährlich etwa eine halbe Milliarde US-Dollar für Forschung und Entwicklung investieren, um den Anschluß an den Wettbewerb nicht zu verpassen. Solche Investitionen trauen Finanzexperten nur noch den weltweit fünf größten Halbleiter-Herstellern wie zum Beispiel Intel und Infineon zu. Auch führende Firmen auf dem Gebiet der Reinraumplanung beobachten seit Jahren eine Abnahme neu zu errichtender Leading Edge Fabs. Moores Law soll vorraussichtlich nur bis 2010 gelten. Danach teilt sich eine mögliche Entwicklung in drei Szenarien auf (siehe Grafik unten).
Darüberhinaus wird es in Zukunft keine einheitliche Architektur für Prozessoren geben, sondern je nach Bedarf und Anwendung stehen entweder Flexibilität oder Höchstleistung einer bestimmten Anwendung im Vordergrund (siehe Grafik Seite 40). Eine Entwicklung, die sich zum Beispiel bereits heutzutage im Bereich der mobilen Prozessoren abzeichnet.
In den nächsten Jahren werden also weiterhin immer leistungsfähigere Prozessoren auf den Markt kommen und der Preisverfall für dann überholte Generationen wird sich weiter verschärfen. Einerseits wird sich damit das Bedürfnis nach mehr bezahlbarer Rechenleistung, wie andererseits auch die Forderung nach kostengünstigeren Prozessoren in einer nicht zu hohen Leistungsklasse befriedigen lassen. Generell wird sich die Anzahl von Prozessoren weiter drastisch erhöhen. Während sich vor zwanzig Jahren noch mehrere oder gar viele Anwender die Rechenleistung eines Prozessors teilten, werden künftig immer mehr Prozessoren im Dienste einzelner Anwender stehen.