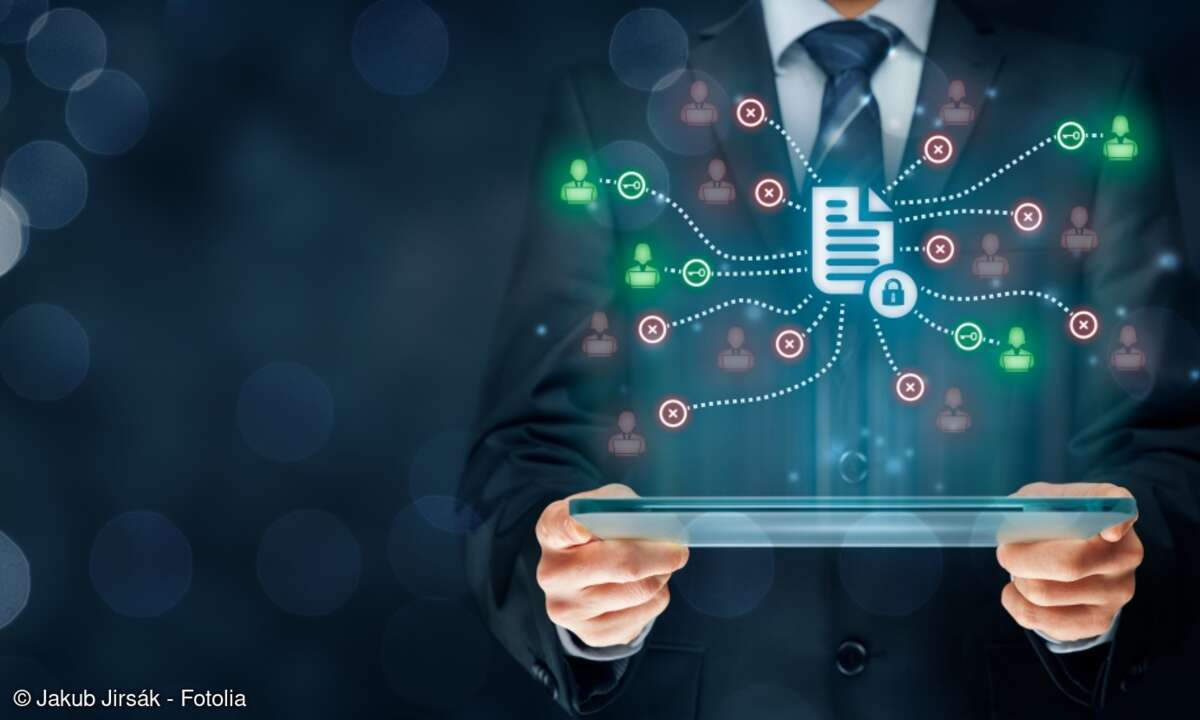Entscheidung gegen Vorratsdatenspeicherung vermutlich haltlos
Europäischer Gerichtshof soll einige Regeln der EU zur Vorratsdatenspeicherung kippen. Ein Erfolg ist jedoch zweifelhaft. Damit hätte die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Wiesbaden in einem konkreten Fall nicht die große Bedeutung.

- Entscheidung gegen Vorratsdatenspeicherung vermutlich haltlos
- Entscheidung gegen Vorratsdatenspeicherung vermutlich haltlos (Fortsetzung)
Die Vorratsdatenspeicherung gehört sicher zu den umstrittenen Gesetzen in Moment. Auf Grund eines konkreten Falls hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden (VG) dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) einige Fragen unter anderem zur Vorratsdatenspeicherung zur Klärung vorgelegt. Denn das VG hält sie nicht für vereinbar mit europäischem Recht. Der Arbeitskreis zur Vorratsdatenspeicherung kommentiert diese Entscheidung so: Erstmals habe ein deutsches Gericht »die flächendeckende Aufzeichnung der Telefon-, Handy-, E-Mail- und Internetnutzung der gesamten Bevölkerung (so genannte Vorratsdatenspeicherung) als unverhältnismäßig bezeichnet.« Allerdings gibt es nach Ansicht des Rechtsanwalts Niko Härting der Kanzlei Härting einige Punkte, dass die Begründung »juristisch in mehrfacher Hinsicht unhaltbar«, auch wenn sie gut gemeint sei.
Hinzu kommt, das nach Auffassung von Härting, Unternehmen wie Opel oder Hypo Real Estate konkret davon profitieren würden: Sie könnten auf Grund des Beschlusses des VG Wiesbaden »Rechtmittel gegen eine Online-Veröffentlichung von gezahlten oder geplanten Subventionen einlegen«. Dies trage nicht zu einer Transparenz bei.
In dem konkreten Fall hatte ein landwirtschaftlicher Vollerwerbsbetrieb dagegen geklagt, dass der Name auf der Website »www.agrar-fischerei-zahlungen.de« der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung veröffentlicht wird. Dort werden Unternehmen eingetragen, die Mittel aus dem Europäischen Garantiefond für Landwirtschaft dem Europäischen Landwirtschaftsfond für Entwicklung des ländlichen Raumes erhalten. Diese Website speichert nun bei Besuch der Website gewisse Daten wie IP-Adresse des Internet-Service-Betreibers für eine bestimmte Zeit. Außerdem bemängelt die Klägerin, dass die Site über eine Suchfunktion verfüge, mit der sich Subventionsempfänger nach Postleitzahlen suchen ließen.