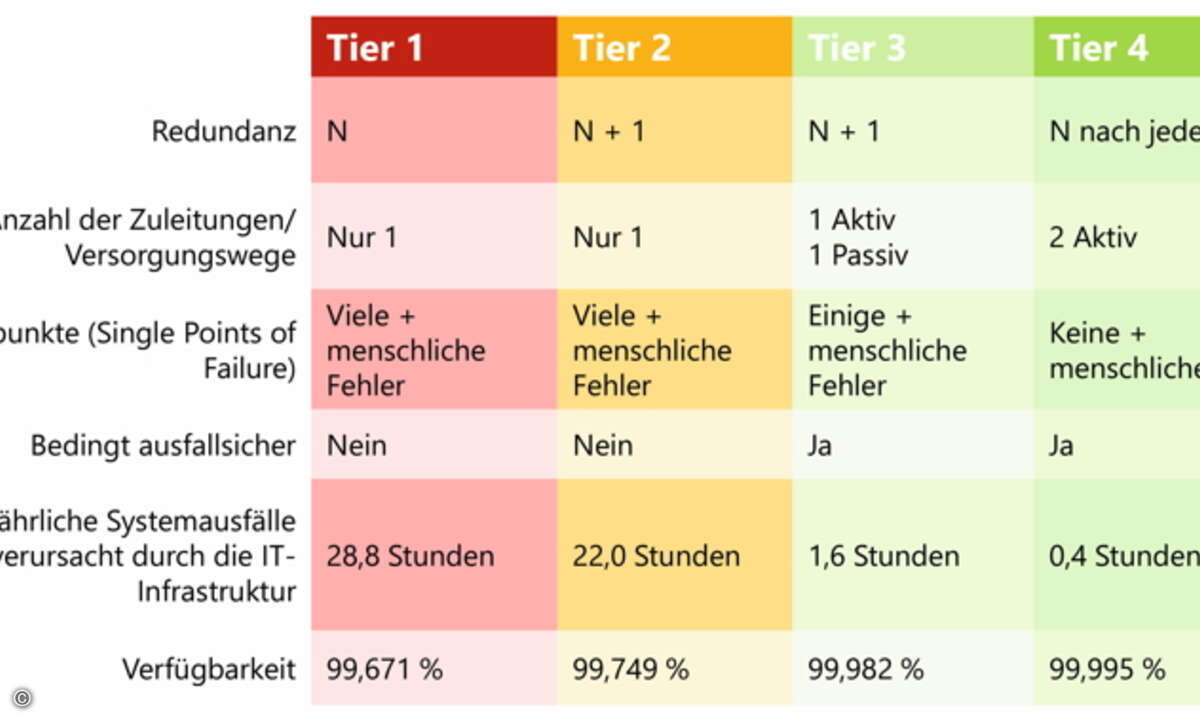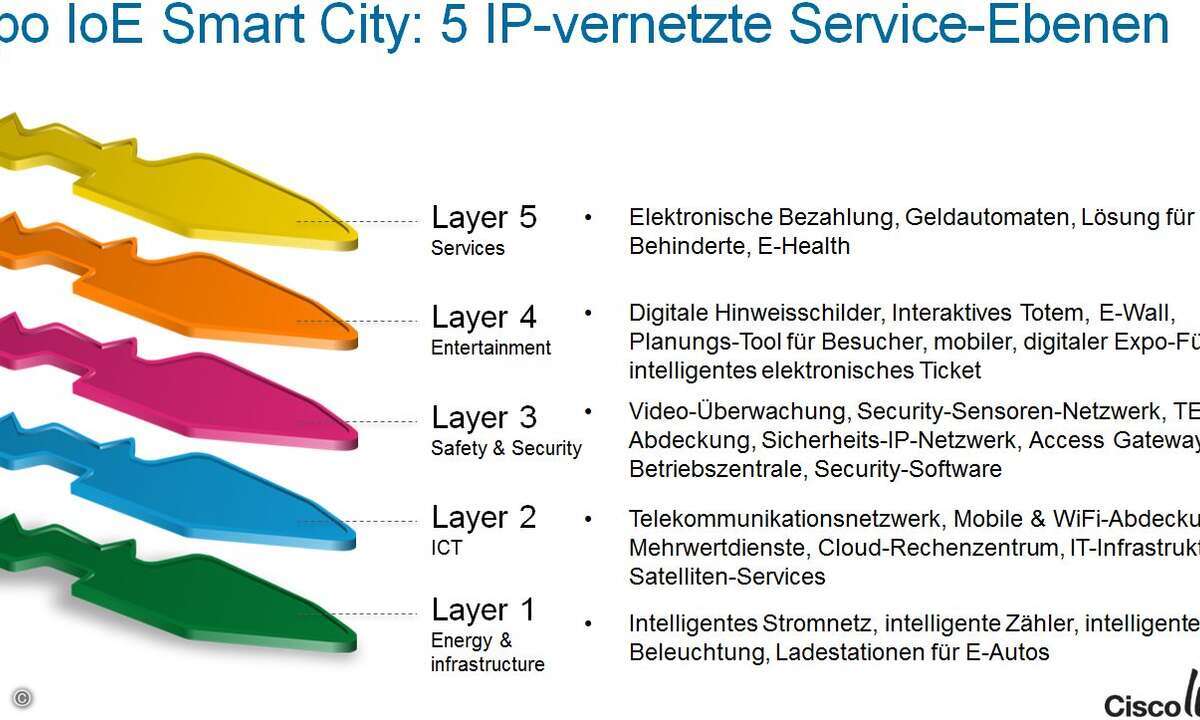Facility-Management im Rechenzentrum
Ende letzten Jahres fand in Frankfurt am Main ein Tech Forum "Computer Aided Facility-Management" (CAFM) unter der Federführung der Konradin-Fachzeitschriften LANline und Building Control statt. In der Ausgabe 12/2008 berichtete die LANline über CAFM-Software. Jetzt geht es um CAFM im Rechenzentrum.
Facility-Management im Rechenzentrum betrifft IT-Abteilungen häufig sehr direkt. Denn hier reicht die Gebäudeklimaanlage meist nicht zur Kühlung der Server-Schränke aus, die Stromversorgung muss mit Konzept verteilt werden. Außerdem spielen Zugangskontrolle, Überwachung der Umgebungsparameter oder computerfreundliche Brandlöschvorrichtungen eine wichtige Rolle. Viele RZ-Ausrüster oder Schrankhersteller bieten entsprechende Überwachungssysteme an.
Jörg Schultheis, Vertriebsleiter für elektronische Schließsysteme bei Emka Beschlagteile, stellte auf der Veranstaltung in Frankfurt Funktionsumfang und Einsatzszenarien von Schranküberwachungen vor. Diese bieten Verschlussmechanismen und eine Zutrittskontrolle via Transponder oder Biometrie inklusive Protokollierung an. Je nach eingesetzten Sensoren (beispielsweise für Temperatur, Feuchte, Rauch, Strom) und Steuerungsmechanismen können diese Lösungen nicht nur Klima- oder Verbrauchswerte erfassen, sie erlauben auch die Ausgabe von abgestuften Warnmeldungen bei Überschreiten von Grenzwerten oder sogar eine automatische Klimaregelung, Feuerlöschung sowie sonstige vorab definierte automatische Abläufe bei bestimmten Ereignissen. Wichtig ist, dass der Administrator über eine abgesicherte Remote-Verbindung und parallel dazu vor Ort ohne Netzanbindung oder Energieversorgung auf die Lösung zugreifen kann. Neben dem Funktionsumfang können bei der Auswahl von Schranküberwachungssystemen auch Kriterien wie die Skalierbarkeit oder Schnittstellen zum Gebäudeleitsystem oder zur CAFM-Lösung entscheidend sein.
Energie-Management
Da im Rechenzentrum das elektrische und thermische Energie-Management besonders kritisch ist, ging Dr. Manfred Siegl, Geschäftsführer des österreichischen Unternehmens Citem, in seinem Vortrag auf der CAFM-Tagung speziell auf das Monitoring in diesem Bereich ein. Er wies dabei auf die problematischen Punkte generell bei Überwachungsaufgaben hin. So seien in vielen Systemen Fehler oder Defekte latent vorhanden, die zunächst nicht erkennbar oder vernachlässigbar erscheinen und erst nach einiger Zeit zu Ausfällen führten. Und selbst wenn Systeme redundant ausgelegt sind, müsse der Administrator im Fehlerfall eine Übernahmeverzögerung einkalkulieren. Das heißt, der Mitarbeiter im Monitoring muss den gemessenen Systemzustand qualifiziert interpretieren und das Zeitfenster für Reaktionen realistisch abschätzen können, um dann im Problemfall auch schnell eine Entscheidung treffen zu können. Das Monitoring-System soll ihn dabei unterstützen und ihn auf die wichtigen Tendenzen und Ereignisse hinweisen. Da das menschliche Gehirn nur beschränkt aufnahmefähig ist, sollte der RZ-Leiter bei Überwachungslösungen generell darauf achten, dass nur die wichtigsten Funktionen und Kenngrößen überwacht werden und zur Bewertung - etwa der Brisanz - mit deutlich unterscheidbaren Farben gearbeitet wird.
Beim Thema Energie-Management im RZ ist vielen Verantwortlichen noch nicht bewusst, welche nichtlineare Lasten in einem Dreiphasenwechselstromsystem auftreten und zu Lasten auf dem Neutralleiter N führen können. Laut Dr. Siegl kann der Nullleiterstrom in der Praxis bis auf den doppelten Wert eines einzelnen Phasenstroms ansteigen. Da in der Regel Oberschwingungen diesen Effekt hervorrufen, würden hier zum Beispiel Filter oder Oberschwingungskompensatoren für Abhilfe sorgen. Außerdem seien die Phasen in der Praxis nicht symmetrisch belastet. Das heißt, der Elektriker oder Techniker vor Ort sollte darauf achten, dass Geräte nicht bevorzugt auf eine Phase gelegt werden, sondern dass sich die elektrischen Verbraucher möglichst gleichmäßig auf alle drei Phasen verteilen.
Setzt das Unternehmen ein Energie-Management-System ein, kann der Anwender genau erkennen, welche Verbraucher in welchem Schrank an welchem Stromkreis und idealerweise auch an welcher Phase angeschlossen ist. So ist es für den Administrator mit wenigen Mausklicks möglich, herauszufinden, in welchem Schrank oder welchem Stromkreis er noch ein Gerät anschließen kann, ohne dass es zu einer Schieflast der Phasen oder zu einem Hotspot im Schrank kommt. Grundsätzlich sollte es mit jeder Energie-Management-Lösung zum Beispiel möglich sein, durch ein definiertes Hochfahren der Systeme Anschaltspitzen zu minimieren. Überwacht der Anwender neben den Verbrauchswerten auch noch die Temperatur im Umkreis der Verbraucher, hat er auch die Verlustleistungen unter Kontrolle. Doch sollte der Anwender berücksichtigen, dass Wärme nicht automatisch Abwärme bedeutet. Die Raumtemperatur kann bei Ausfall der Raumklimaanlage oder bei einem Brand generell ansteigen.
Physical-Infrastructure-Management
Ebenfalls ein wichtiger Aspekt beim Facility-Management im RZ ist die Datenverkabelung: Dazu zählen zum Beispiel alltägliche Routinen, etwa bei internen Umzügen oder sonstigen Veränderungen im Netz. Hier muss ein Techniker in der Regel zunächst einmal mithilfe von schriftlichen Dokumentationen oder CAD-Plänen im Verteilerschrank die betroffenen Ports herausfinden und diese vielleicht zusätzlich noch über ein Leitungsprüfgerät eruieren. Erst dann kann er umstecken. Diese Vorgehensweise ist umständlich, fehleranfällig und kaum noch mit dem ITIL- und Eurosox-Richtlinien vereinbar. Dennoch endet in den meisten Unternehmen die automatische Echtzeitüberwachung bei den aktiven Komponenten. Patch-Felder und Verkabelung bleiben außen vor.
Einige Hersteller haben hier Abhilfe geschaffen und bieten Physical-Infrastructure-Management-Lösungen an. Rolf Reinhardt, Global Account Manager bei Panduit EEIG, stellte in seinem Vortrag auf dem Tech Forum die Arbeitsweise und Vorteile eines solchen Systems vor.
In der Regel arbeiten diese Lösungen mit einem zusätzlichen Kontakt pro Port auf dem Patch-Feld. Dieser Zusatzkontakt erkennt, ob ein Stecker in der Buchse steckt oder nicht. Damit ist eine Port-Überwachung in Echtzeit möglich, die zudem mit der logischen Adressierung korreliert werden kann. Das System erkennt unautorisierte Zugriffsversuche und kann dann eine entsprechende Alarmmeldung ausgeben. Es ist möglich, standortbezogen das Inventar zu verfolgen oder zum Beispiel VoIP-Verbindungen bis zum Physical Layer nachzuvollziehen. Generell erhöhen diese Systeme die Nachvollziehbarkeit von SLAs. Ferner bieten fast alle ein Work-Order-Management an. Das heißt, bei Umpatchungen wird dem ausführenden Personal signalisiert, welche Ports es wie umstecken soll. Damit sinkt die Fehlerwahrscheinlichkeit deutlich, außerdem ist dafür kein geschultes Personal mehr nötig.
Fazit
Alle vorgestellten CAFM-Varianten für das Rechenzentrum sollen dem IT-Leiter und Administrator mehr Überblick verschaffen, Fehlerquellen minimieren und Abläufe soweit wie nötig und möglich standardisieren und automatisieren - insbesondere bei Störungen. Außerdem ermöglichen sie eine ITIL-konforme Ende-zu-Ende-Dokumentation und Überwachung des Netzwerks. Wenn diese Überwachungslösungen zudem in eine übergeordnete CAFM-Lösung eingebunden sind, haben auch andere Unternehmensbereiche die Möglichkeit, darauf zuzugreifen und können zum Beispiel beim Umzugs-Management oder bei Verhandlungen mit dem Energieversorger darauf zugreifen.
Info: Emka Tel.: 02051/2730 Web: www.emka.com
Info: Citem Tel.: 0043/2616/634283 Web: www.citem.at
Info: Panduit EEIG Tel.: 069/95096129 Web: www.panduit.com