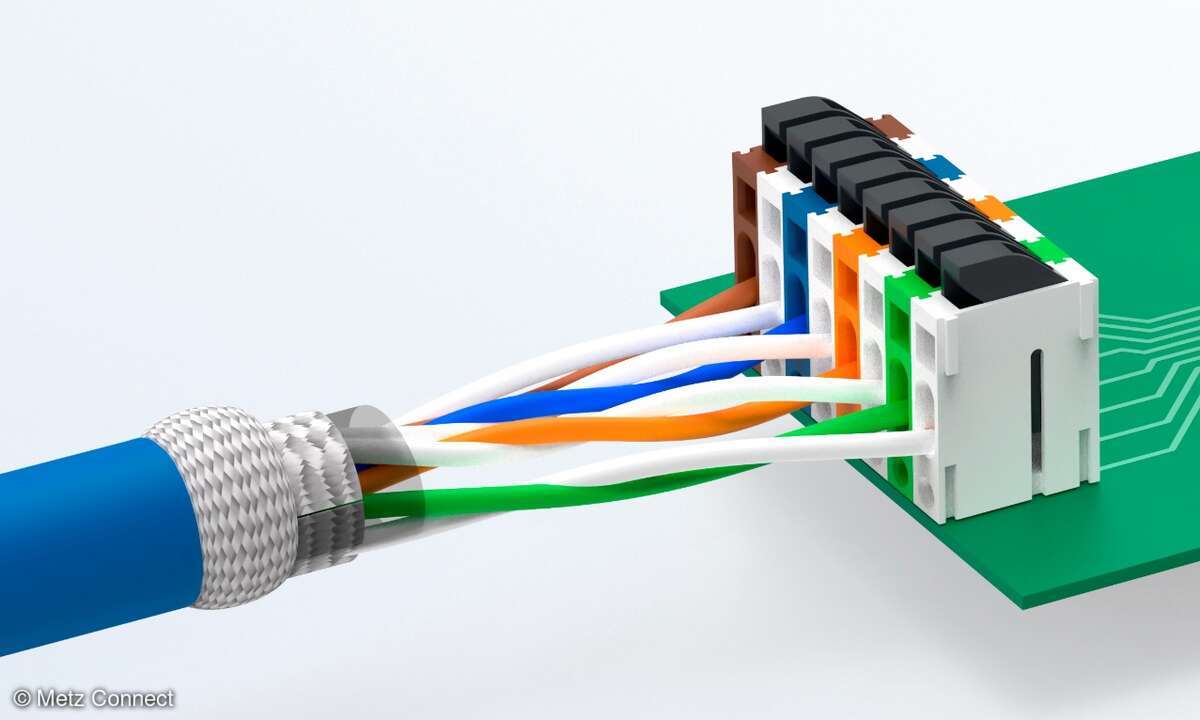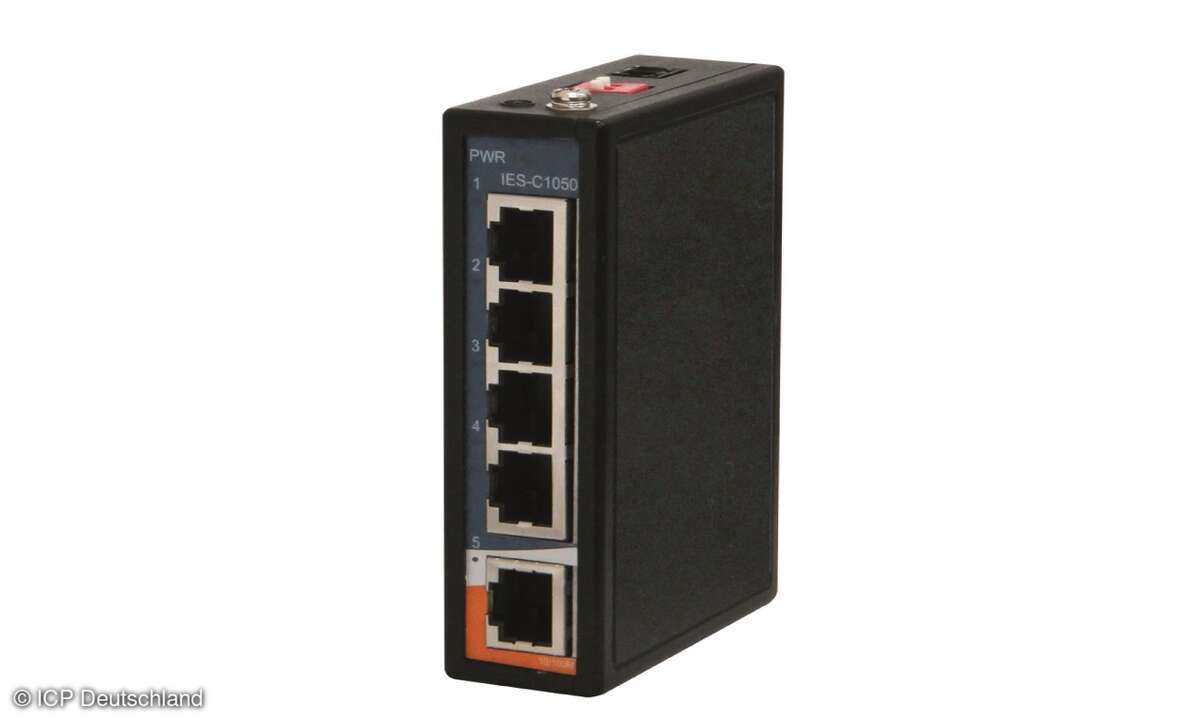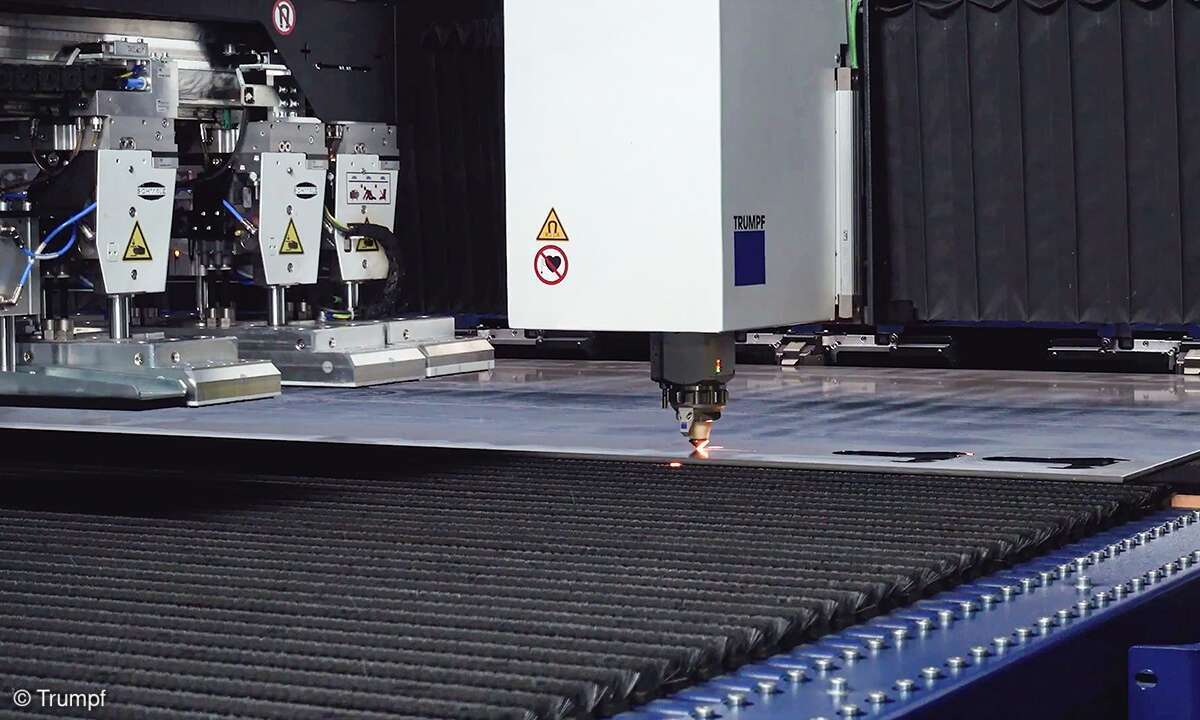Glänzende Pionierarbeit
Das Stadtnetz soll Vorbildfunktion übernehmen, indem es Ethernet bis zum Unternehmensnetz durchschleust. Die Unternehmen jedenfalls fordern diese ihnen gut bekannte Technik. Die Netzbetreiber müssen ihre Infrastruktur entsprechend umrüsten, um den Dienst zu liefern.
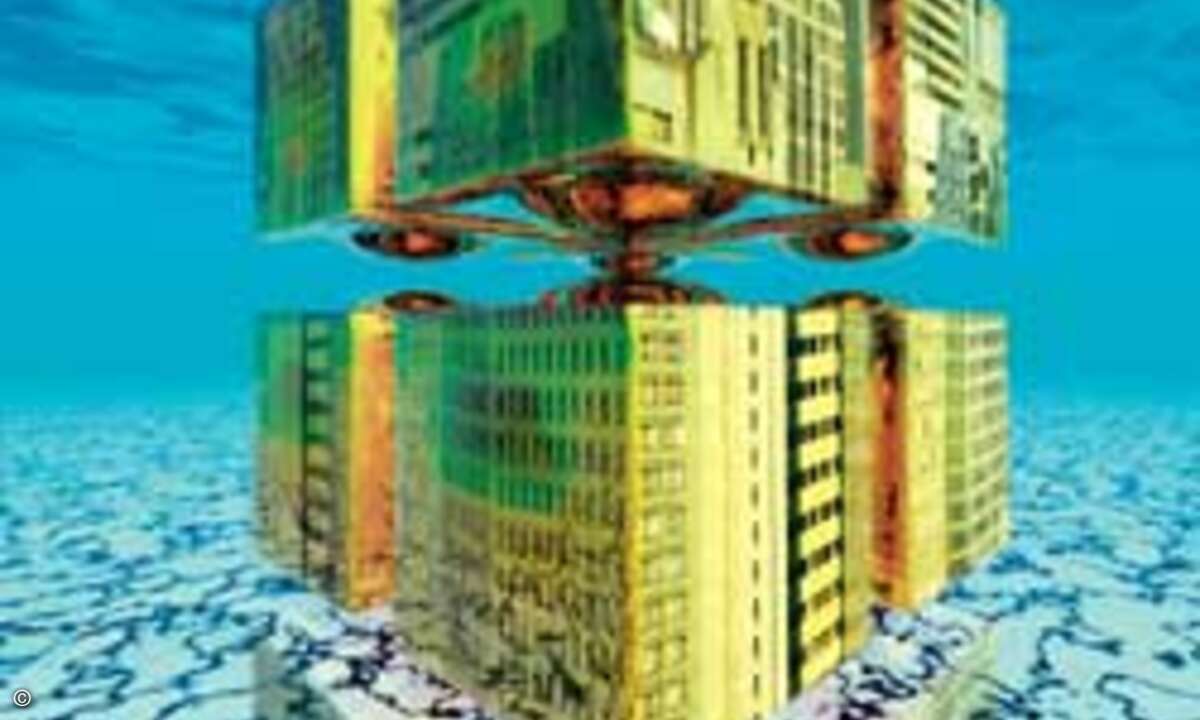
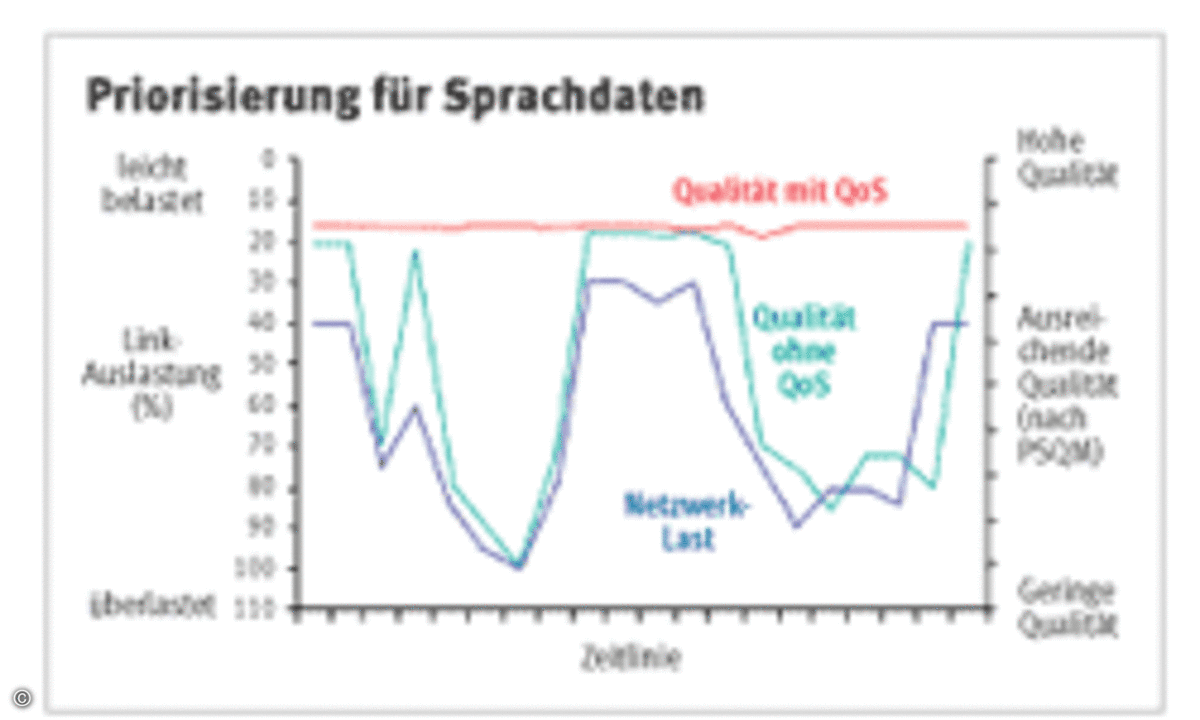
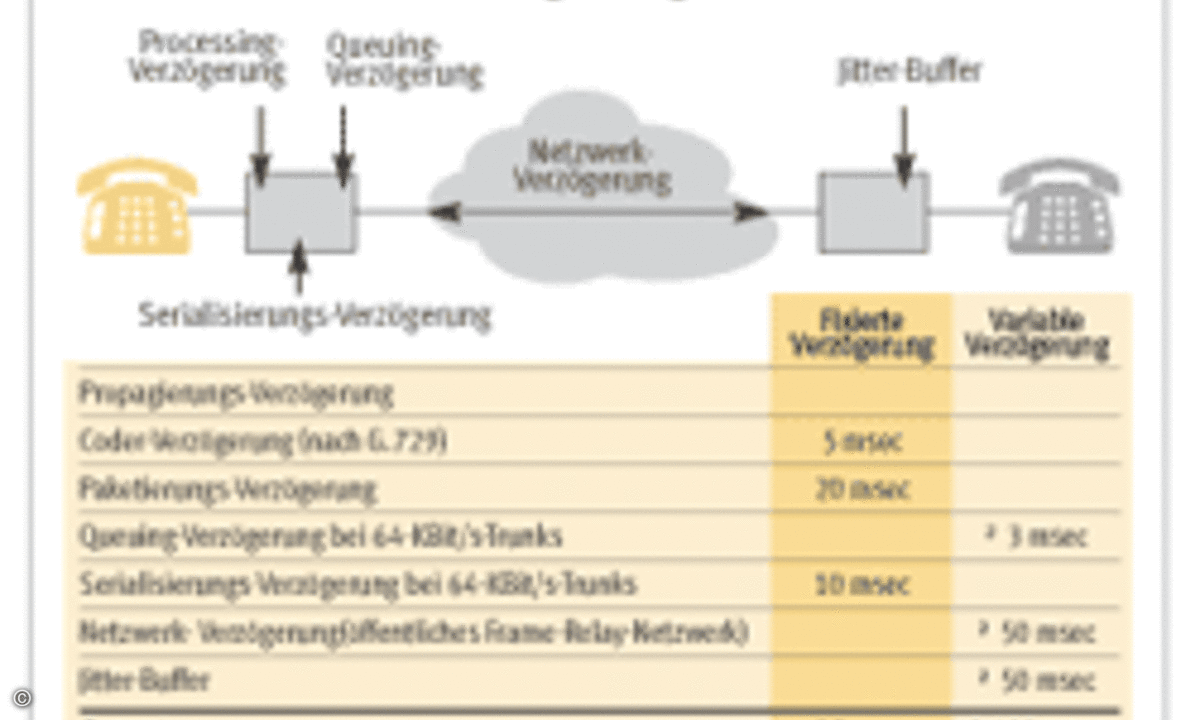
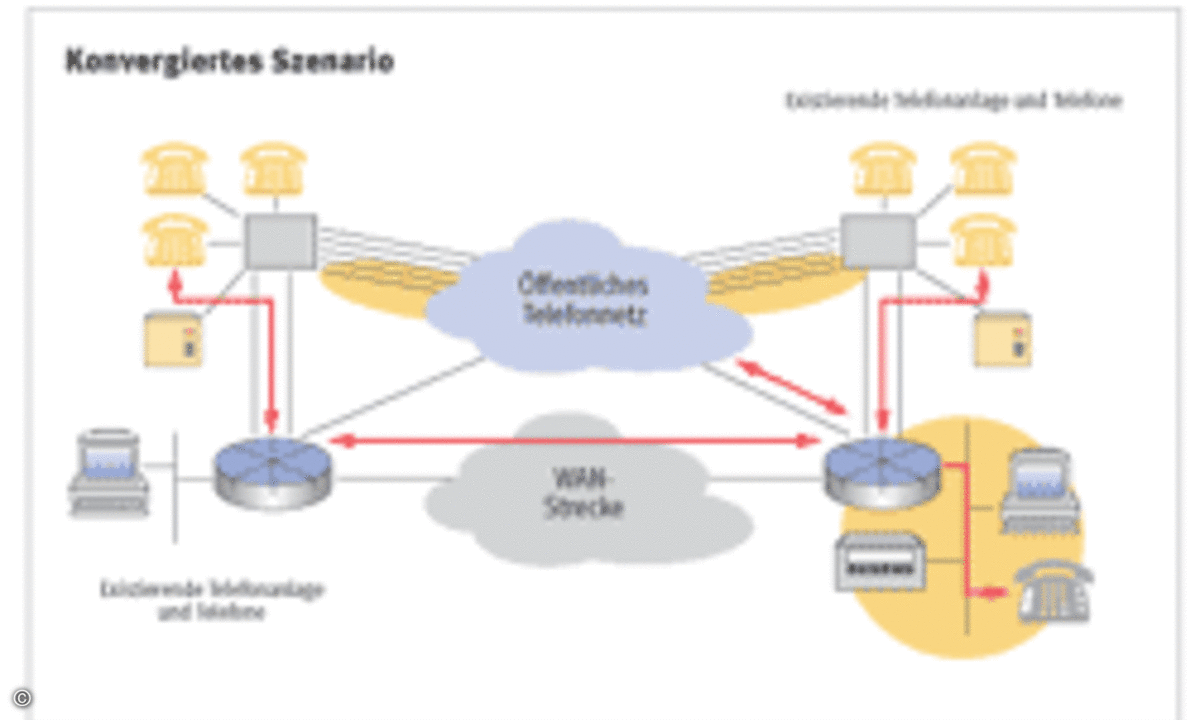
Abhängig von der Infrastruktur setzen Carrier entweder auf ihre Sonet/SDH-Welt mit Ethernet-Intelligenz oder gleich auf pures 10 GBit/s.
Die fatalen Auswirkungen des Dotcom-Crashs strahlen bis zum heutigen Tage nach. Carrier und ISPs haben ihre Netze auf Basis von Kalkulationen ausgebaut, die in der Boomzeit der Dotcoms erstellt wurden. Damals hat man große Datenvolumina erwartet. Nun ist das Verkehrsaufkommen zwar weiter gestiegen, so die meisten Carrier, dank Crash aber nicht in dem Maß, wie sie berechnet hatten. Ihre Netze sind heute weniger ausgelastet und arbeiten allein deshalb schon unwirtschaftlich. Um mehr Kundenbits in ihre Infrastruktur zu locken, haben sie attraktive Angebote geschnürt. Mit der Folge, dass die Preise für klassische Dienste wie Telefonie und Datendienste wie Standleitungen in manchen Bereichen förmlich verfallen sind. Am Ende haben die Dienstleister weniger verdient, während die Betriebskosten ihrer überdimensionierten Netze den kleinen Gewinn aufzehrten. Plötzlich rückten Fragen der Wirtschaftlichkeit in den Vor-dergrund, flankiert von spektakulären Konkursverfahren etablierter Dienstleister wie KPNQuest. Das Carrier-Geschäft war als Sanierungsfall gebrandmarkt. Die miserablen wirtschaftlichen Jahresergebnisse 2003 vieler Kommunikationsdienstleister haben die Stimmung nur weiter eingetrübt. Die Lichtblicke wie die Erfolgsgeschichte des Breitbanddienstes »T-DSL« der Deutschen Telekom haben die düstere Lage nur wenig aufgehellt. Alles in allem wirkt die Situation noch heute auf den ersten Blick prekär.
Doch der düstere Nebel lichtet sich und gibt Raum für erste optimistische Prognosen. Der Analyst Infonetics Research hat beleuchtet, welche Schritte Carrier und ISPs in nächster Zukunft unternehmen werden. Dazu hat er insgesamt 27 Service-Provider befragt, die ihr Geschäft in Nordamerika, Europa und dem asiatischen Raum abwickeln. Der Analyst versuchte, diese Schritte mit den Erwartungen der Carrier-Kunden, also Unternehmen und private Konsumenten, in Zusammenhang zu bringen. Das Ergebnis ist überraschend. Die Dienstleister gehen davon aus, dass ihre Unternehmenskunden innerhalb der kommenden zwei Jahre verstärkt auf Ethernet basierende Dienste nachfragen werden. Services, die ihre Netze über das ihnen bekannte Ethernet direkt an das WAN koppeln. Über diese Leitung wollen sie Garantien für ihre kritischen Daten einfordern, Sprache übertragen, Standleitungen und Bandbreite bei Bedarf buchen. Diese Dienste soll ihnen vor allem ihr nächstgelegenes Carrier-Netzsegment, das Stadtnetz, liefern. Die Stadt, besser gesagt, das »Metropolitan Area Network« (MAN) als glänzender Vorbereiter für fortschrittliche, blendend organisierte Dienste.
Prämissen
Diese Forderung steht nun im Raum und will bedient sein. Es führen aber viele Wege in die Stadt. Schon allein die grundlegend individuellen Ausgangspositionen der verschiedenen Carrier und ISPs wird auf technischer Ebene unterschiedliche Lösungsansätze erfordern. Das zeigt auch die Studie.
Um Ethernet bis zum Unternehmenskunden durchzuschleifen, werden 63 Prozent der befragten Service-Provider bis Januar 2005 auf eine »Resilient-Packet-Ring«-Infrastruktur (RPR) migrieren. Die IEEE hat im Dezember 2000 damit begonnen, den RPR-Standard zu entwickeln. Im RPR wurde ein neuer Media-Access-Control-Layer (MAC-Layer) auf dem Layer 2 festgelegt, damit ein optischer Sonet/SDH-Ring Pakete wie im Ethernet switcht. Dabei soll RPR von den Ausfallmechanismen des optischen Rings profitieren und beispielsweise ausgefallene Strecken innerhalb von weniger als 50 Millisekunden überbrücken. Damit wäre eine für Datenpakete ausgelegte Infrastruktur geschaffen, die aber genauso ausfallsicher arbeitet, wie es Service-Provider von ihren Sprachnetzen kennen.
Den WAN-Zugang für die angebundenen Kundennetze sollen dabei hauptsächlich auf Ethernet basierende Router und Switches etablieren. Für Private-Line-Dienste bevorzugen die befragten Dienstleister aber weiterhin Sonet/SDH-Strecken. Wenn ein Kunde sein Storage-Area-Network mit anderen WAN-gebundenen Segmenten koppeln möchte, so werden die meisten Dienstleister Wellenmultiplexing-Technik (WDM) einsetzen, so die Studie.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Carrier die technische Mischwelt ihrer Backbones zum Teil umbauen, zum anderen Teil bestimmte Techniken auf gesonderte Dienstspektren ausrichten. Das ist realistisch. Es wäre naiv zu glauben, dass die Dienstleister die großen Investitionen in ihre Sprachnetze von einem Tag auf den anderen komplett in Frage stellen. Niemand wird sein bestehendes Equipment, das für einige Dienstanforderungen weiterhin ausgezeichnet geeignet ist, für eine moderne, rein auf Ethernet basierende Infrastruktur opfern. Die Mischwelten bleiben den Carriern erhalten. Wer also eine Revolution erwartet hat, der wird enttäuscht. Denn die Migration wird – wie so oft – evolutionären Charakter haben.
Altes und Neues konsolidieren
Es wird von den ISPs und Carriern abhängen, wie geschickt sie ihre alte Sprachwelt mit der wachsenden, reinen Ethernetwelt vereinen. Es gibt nicht wenige Analysten, die von den Herstellern eine völlig neue Gerätegeneration fordern. Erste Hersteller wie Alcatel, Cisco, Nortel und Siemens haben bereits darauf reagiert und Geräte vorgestellt oder angekündigt.
Diese »Multiservice Transport Devices« (MTD) verstehen einmal die traditionellen Disziplinen eines Carrier-Netzes. Sie liefern die gewohnten auf Time-Division-Multiplexing (TDM) basierenden Sprachdienste auf der Last-Mile-Seite und interagieren weiterhin mit der Sonet/SDH-Infrastruktur im Kern des Carriernetzes. In diesen Kern leiten sie die eintreffenden Daten anhand von Wellenmultiplexing-Verfahren weiter. Damit soll garantiert bleiben, dass die Carrier und ISPs ihre traditionelle Dienstwelt im gleichen Maß bedienen können, wie sie es bisher getan haben. Denn auf TDM basierende Standleitungen und Leased-Lines sind weiterhin in gleicher Weise realisierbar. Den Unterschied zu bisherigen Edge- und Core-Geräten machen die Paket-orientierten Dienste der MT-Switches und -Router. Sie sollen mit eingebauter Layer-2-Intelligenz die gewünschten reinen Ethernet-Verbindungen bis zum Kundennetz durchschalten.
Wegen der prinzipiell gleichen Zielsetzung zeigen die Multitransportsysteme verschiedener Hersteller gemeinsame Charakterzüge. Zuerst müssen sie auf der Sonet/SDH-Seite ein breites Spektrum von Geschwindigkeiten abdecken. Das beginnt bei der kleinsten Sonet/SDH-Hierarchie STM-1 (OC-3) und endet bei STM-64 über OC-192. Im Kern großer Stadtnetze, vor allem auf dem amerikanischen Kontinent, sind Durchsätze von 50 bis 100 GBit/s nicht unüblich. Die künftigen Geräte müssen genügend Dampf haben, um bei diesen Transferraten die Daten zumindest auf der Ethernet-Ebene 2 zu bearbeiten. Das erfordert eine Non-Blocking-Architektur, die neben den OC-Ports genauso reine Ethernet-Ports mit genügend internen Ressourcen versorgt.
Dabei müssen die Multitransportsysteme die Standardfunktionen beider Welten gleich gut beherrschen. Dazu gehört, auf der optischen Seite Cross-Connects zu schalten, die wichtigen Wellenmultiplex-Techniken zu beherrschen und natürlich alle Ausfall-, Management- und Monitoring-Dienste der Sonet/SDH-Welt in angemessener Qualität zu realisieren. Auf der Ethernet-Seite müssen diese Switches oder Router die Dienstgüten der optischen Welt weiterreichen, diese allerdings in die Sprachen und Techniken der reinen Datenwelt übersetzen. Dazu gehört, die Daten auf der auf Ethernet basierenden Standleitung zum Kunden den Service-Level-Agreements entsprechend zu priorisieren. Und zwar nach Qualitäten, die über die reinen Ethernet-Dienste hinausreichen. Denn die LAN-fokussierten Verfahren wie IEEE 802.3p/Q oder Layer-3-Ansätze wie IP-ToS oder Diffserv skalieren nicht, um den Ansprüchen eines Carriers oder ISPs gerecht zu werden. Sie sind technisch nicht fähig, Bandbreitenzuteilungen und ein Traffic-Management aufzusetzen, die den restriktiven Bedingungen der Service-Level-Agreements aus der Carrierwelt gerecht werden. Da sind immer noch zu viel Best-Effort und zuwenig Kontrolle im Spiel.
Damit die Multitransportsysteme die SLAs Ende zu Ende bis zum Kunden durchhalten, also auch auf der Last-Mile-Ethernetstrecke, ist ein neuer Ansatz nötig: Das »Multiprotocol Label Switching«, kurz MPLS. Er wird als der Heilsbringer für alle diese Probleme gehandelt. MPLS arbeitet auf dem Layer 2 und setzt dort Richtlinien für Latenzzeiten durch, teilt Bandbreite nach frei konfigurierbaren Dienstkritieren auf und überwacht die Auslastung der Leitung. Diese Informationen kann das Multitransportsystem wiederum intern in IP-Formate übersetzen und so auf der IP-Ebene eine Quality-of-Service-Richtlinie (QoS) etablieren. Der Ableger von MPLS, das »Generalized MPLS« (G-MPLS) setzt die gleichen Dienste in paketfremden Diensten wie eben TDM-Umgebungen um, so dass das Multiprotokollsystem auf dem Layer 3 für beide Welten eine gemeinsame QoS-Sprache findet. Es packt Paket- und Sprachdienste in ein einheitliches Provisioning- und Management-Korsett, das die verschiedenen SLAs aus der Quality-of-Service-Perspektive festlegt. Auch Überlasten, fehlerhafte Links in beiden Welten, im Grunde die klassischen Verkehrssteuerungselemente, sind konsolidiert.
Die weitaus schwierigere Aufgabe der Geräte ist es, die Paketströme aus der Datenwelt so zu modulieren, dass eine dahinterliegende Sonet/SDH-Infrastruktur sie effizient übertragen kann. Es ist eine Tatsache, dass Sonet/SDH für Sprachdienste konzipiert ist. Ihr auf Circuits basierendes Konfigurationsschema und die darin aufgesetzten optischen Wellenlängenpfade beherrschen die konstanten Sprachtransfers souverän. Diese Arbeitsweise ist bei ungleichmäßig geformten Dateninhalten weniger geeignet, das Sonet/SDH arbeitet ineffizient. Nun müssen die MTDs die Datenpakete so umformen und ummanteln, dass sie wie ein Sprachstrom wirken und ähnlich sauber von der alten Infrastruktur übertragen werden können. Die verschiedenen Standardgremien, unter anderem die ITU-T, haben zu diesem Zweck neue Verfahren entwickelt.
Das »Virtual Concatenation«-Verfahren (VC), verkettet die Payload vieler kleiner, virtueller Sonet/SDH-Container in einer großen Gruppe, der »Virtual Concatenation Group« (VCG). Dieses Verfahren hat die ITU-T in der Spezifikation G.707 definiert. Demnach dürfen die virtuellen, kleinen Container drei verschiedene Größen haben: Der kleinste VC-12 ist rund 2 MBit/s, der VC-3 50 MBit/s und der VC-4 rund 150 MBit/s groß. Ein Datenstrom von etwa 10 MBit/s würde also in vier VC-12-Container aufgetrennt. Die VCG wird als Gruppe unabhängiger VCs behandelt, so dass jeder VC für sich einen eigenen Zeitslot in einem passenden Ende-zu-Ende-Pfad belegen darf. Der große VCG-Kontainer wird an seinem Zielort entsprechend wieder aufgebaut. Ein 10-MBit/s-Strom könnte also auf vier beliebige VC-12-Kontainer innerhalb des Sonet/SDH-Systems aufgeteilt werden. Die ITU-T erhofft sich, dass dieses Verfahren die verfügbaren Bandbreiten der Sonet/SDH-Welt feinerstufig abstimmt. Auf diese Weise ließen sich Sonet/SDH-Pfade auf einer Ende-zu-Ende-Basis weitaus variantenreicher gestalten. Das träge Sonet/SDH wäre skalierbarer und würde Datenströme unter Berücksichtigung von QoS-Vorgaben übertragen können.
Die ITU-T hat mit der G.7042-Vorgabe noch weiter versucht, das alte Sprachnetz an Datendienste anzupassen. Das »Link Capacity Adjustement Schema« (LCAS) erlaubt es den Carriern, individuelle VCs in einer VC-Gruppe (VCG) hinzuzufügen oder zu entfernen. Damit kann die Payload einer VCG feinstufig an tatsächlich verfügbare Bandbreiten angepasst werden. Die LCAS-Definition enthält bereits alle nötigen Signalisierungsmechanismen. Sie teilen beiden Endpunken in einem Ende-zu-Ende-Pfad mögliche Änderungen mit, ohne dass Daten verloren gehen, wenn der Carrier den Link neu justiert.
Beide Definitionen koppelt die ITU-T mit ihrer »Generic Framing Procedure« (GFP), die das Gremium in dem Papier G.7041 festgelegt hat. Das Verfahren beschreibt zahlreiche standardisierte und transparente Mapping-Techniken, die Frame-strukturierte Dienste wie ummantelte Ethernet-Pakete in passende Formate für die VC-Gruppen übersetzen. Die ITU-T hat diese Framing-Prozedur entwickelt, um die vielen proprietären Ansätze in diesem Bereich durch ein allgemein gültiges Konzept zu ersetzen und damit die Herstellerbindung zu schwächen. Die GFP unterstützt jede Bit-Rate und jedes Protokoll und übersetzt sie in die Sonet/SDH-Sprache. Diese Mechanismen sind in zwei grundsätzliche Betriebsmodi eingebettet. Der Frame-Mode passt die Transferrate an und versteht Multiplexing auf der Paketebene, so dass der Carrier die Datenströme modulieren und an die vorgegebenen Kunden-SLAs anpassen kann. Der »Transparent«-Mode dagegen nimmt die eintreffenden Datenströme in ihrer Ursprungsform an und übersetzt sie mit minimaler Latenzzeit in einen Sonet/SDH-Strom.
Die Multitransportsysteme sollen aber nicht nur in der Sonet/SDH-Welt verharren. Wie die Studie von Infonetics Research zeigt, wird der Resilient-Packet-Ring (RPR) als Transporttechnik in einem optischen, bisher rein Sonet/SDH fahrenden Ring eine große Rolle spielen, vor allem im Stadtnetzbereich. Die Hersteller haben reagiert und entsprechende Module für ihre MTDs vorgestellt oder zumindest angekündigt. Ziel bleibt es, sich erst einmal nahtlos in die bisherige Sonet/SDH-Infrastruktur einzuklinken, dabei aber Datendienste wie Metro-Ethernet bereits zu unterstützen. Ob ein Carrier später seinen Ring auf reine Datendienste umstellt oder auf der alten Infrastruktur beharrt, das soll für die MTDs keine Rolle spielen. Sie unterstützen beide Welten.
Ethernet pur
Wenn man über Ethernet-Dienste in Stadtnetzen spricht, so geht kein Weg vorbei am »Metro Ethernet Forum« (MEF) – einer Vereinigung von Herstellern, die ein reines auf 10-GBit/s basierendes Ethernet für das Stadtnetz als die langfristige Lösung propagiert. Ihr Ansatz soll vor allem Dienstleister überzeugen, die auf der grünen Wiese ohne Altsünden starten. Um sie für sich zu gewinnen, hat die MEF unter anderem eine Studie in Auftrag gegeben. Sie legt den Finger in die schmerzende Wunde der Carrier – die Betriebskosten. Die Studie vergleicht, wie sich die Betriebskosten klassischer Frame-Relay-/ATM-Virtual-Circuit-Dienste im Verhältnis zu Ethernet-Line-Services (E-Line) in einem reinen Ethernet-Backbone entwickeln. Dabei geht sie von der Prämisse aus, dass beide Welten den Dienst qualitativ gleichwertig umsetzen.
Resultat: Die Metro-Ethernet-Gemeinde spart, verglichen mit traditionalen Carriern, im ersten Jahr 18 Prozent der »Operations Expenditures« (OpEX) ein, im zweiten bereits 20 Prozent, nach drei Jahren kumulativ 23 Prozent. Wer also auf die neue Generation wechselt, der spart bei den Betriebskosten, muss allerdings bekannte Dienste aus der Sonet/SDH-Welt auch unterstützen. Daher hat sich das MEF in den vergangenen sechs Monaten bemüht, ein entsprechendes Dienste-Framework zu entwickeln. Dieses soll nicht nur reine Ethernet-Dienste definieren, sondern bekannte Sonet/SDH-Services in eine für Ethernet verständliche Sprache und Form zu transferieren. Einer der wichtigsten Bausteine in dem Framework sind die »Circuit Emulation Services over Ethernet«, kurz CESoE. Sie sollen traditionelle TDM-Sprachanwendungen und Legacy-Private-Lines über Ethernet möglich machen.
CESoE versucht, die aus der Sprachwelt bekannte »Constant-Bit-Rate« (CBR) in das »Variable-Bit-Rate«-Konzept (VBR) des auf Ethernet basierenden Stadtnetzes zu übersetzen. Damit dies gelingt, muss CESoE die Latenzzeiten kontrollieren, Paketverluste vermeiden und vor allem die Endpunkte einer bisher CBR-gesteuerten, synchronisierten Kommunikation an eine VBR-Umgebung anpassen. Damit dies gelingt, sind mehrere Schritte und Mechanismen notwendig, die das robuste Ethernet um intelligente Steuerungsmechanismen erweitern.
Der »Paketierungsprozess« konvertiert den synchronen Bit-Strom der Sonet/SDH-Welt in Ethernet-Frames. Er darf dafür nur wenig Zeit benötigen, um die zusätzliche Latenzzeit in akzeptablen Grenzen zu halten. Eine kritische Aufgabe, da sich gerade Verzögerungen katastrophal auf die Sprachqualität auswirken. Um diesen Prozess zu verbessern und die Ressource Zeit zu schonen, soll das CESoE mehrere synchronisierte Sprachströme zusammenfassen und erst dann mit Frame-Formaten ummanteln.
Der Paketierungsansatz klinkt sich sowohl in strukturierte wie unstrukturierte TDM-Operationsmodi ein. Im unstrukturierten Modus interpretiert der Paketprozess den TDM-Dienst als reinen Bit-Stream, ohne seine Struktur innerhalb des Circuits zu berücksichtigen. In diesem Fall betrachtet er beispielsweise ein T1-Circuit als 1,544 MBit/s großen Verkehrsfluss, ohne die Position der Framing-Bits oder des Datenkanals innerhalb dieses Stroms zu beachten. Dadurch kann der Prozess die Signalisierung des TDM-Verkehrs transparent durchreichen. CESoE kann sich somit an jedes TDM-Interface koppeln, unabhängig vom jeweiligen Signalisierungs-Protokoll. Die Implementierung dieses Dienstes, so hofft das MEF, ist auf diese Weise vereinfacht.
Die Latenzzeit wird ab dem Netzwerkknoten gemessen, an dem die TDM-Daten das auf Ethernet basierende MAN erreicht. Diese Messung endet am Ausgangspunkt des MANs. Damit die Sprachdienste in dieser Umgebung funktionieren, muss das Netz die Latenz restriktiv kontrollieren und niedrig halten. Zu diesem Zweck muss es dem Ethernet gelingen, die »Frame Delay Variation« (FDV) auszugleichen. Dieser Effekt ist bedingt durch die asynchrone Arbeitsweise des Ethernets und die variablen Größen der einzelnen Pakete. Das Lyer-2-Verfahren kann ein breites Spektrum von Protokollen übertragen, die sich in ihrer Struktur, Größe und ihren Anforderungen deutlich unterscheiden. Dadurch variiert der Effekt der FDV signifikant und wirkt sich negativ auf garantierte Transportqualitäten aus. Im schlimmsten Fall wäre das Netzwerk nicht mehr in der Lage, die für den TDM-Transfer nötigen CESoE-Vorgaben einzuhalten.
Um den Effekt zu kontrollieren, sollen Jitter-Buffer auf der Zielseite zu früh oder zu spät eintreffende Pakete zwischenspeichern und richtig sortieren. Je größer diese Buffer sind und je häufiger sie Daten parken, desto größer wird leider die Latenzzeit. Damit könnten die Buffer sogar den gegenteiligen Effekt erzielen, indem sie die Sprachqualität noch stärker verfälschen.
Stark schwankende FDV-Werte beeinflussen ebenfalls die Clock-Recovery-Werte und -Routinen. Wenn das Netz niedrige Frequenzen der FDV ausfiltern würde, so könnten das Timing der Clocks und die dazugehörige Berechnungszeit des TDM verloren gehen.
In Stadtnetztopologien auf Basis von Ethernet ist es wahrscheinlich, dass Pakete nicht rechtzeitig und in der falschen Reihenfolge den Zielport erreichen. Es ist genauso zu erwarten, dass das Netz Pakete auf ihrem Weg verwirft, da sie Fehler aufweisen. Weder TDM noch Sonet/SDH kennen aber Konzepte, mit denen sie verlorene Pakete neu anfordern. Wenn also in Frames konvertierte Sprachpakete vom Netz verworfen werden, den Jitter-Buffer also nicht in vorgegebener Zeit erreichen, dann gelten sie als für immer verloren. Ein emulierter Circuit-Strom, bei dem bestimmte Inhalte ihr Ziel nicht erreichen, würde an Qualität einbüßen.
Daher will das MEF die Zielgeräte mit Resequentierungs-Mechanismen ausstatten, um verlorene Daten neu anfordern zu können. Die CESoE hat daher vor, in die Frame-Header selbst Sequenznummern einzugliedern. Auch bei diesem Mechanismus spielt der Jitter-Buffer die Schlüsselrolle. Er hat die Sequenznummern eintreffender Pakete in Leitungsgeschwindigkeit zu prüfen, während er das Ganze in einem kleinen Speicher abwickelt, um die Latenzzeit im Griff zu halten. Hier sind intelligente Buffer-Algorithmen absolut Pflicht.
Damit TDM-Verkehr effizient über eine Ethernet-Strecke transferiert werden kann, spielen natürlich die Synchronisation und die Clock-Recovery eine entscheidende Rolle. Differenzen in der Clock würden dazu führen, dass die Empfänger-Nodes die Daten verwerfen oder erneut prüfen würden. Dieser Zustand ist als »Clock Slip« bekannt. Falls beispielsweise der Sender mit einer schnelleren Clock-Rate arbeitet als der Empfänger, würde Letzterer vom eintreffenden Verkehr quasi überflutet. Wenn dies geschieht, dann wird der Empfänger einige Daten periodisch droppen müssen und so die Sprachqualität erheblich mindern. Er würde gleichzeitig das Datenvolumen erhöhen, da er die gedroppten Pakete neu anfordert, sofern der Sender diese Funktion unterstützt.
Um die Clock zu synchronisieren, hat jede CESoE-Verbindung einen Clock-Recovery-Mechanismus zu unterstützen. Diese Verfahren müssen potenziellen Latenzzeiten widerstehen, FDV und Paketverluste ebenso robust überspielen. Dabei ist der Mechanismus dazu gezwungen, seine Laufzeiten zwischen 18 und 40 Xsekunden zu fixieren. Selbst dann, wenn das auf Ethernet basierende Stadtnetz FDV-Werte von Millisekunden erzeugt. Schließlich muss der Core des Stadtnetzes die Leistung des TDM-Dienstes selbst überwachen, um Signalverluste direkt beim TDM-Interface aufzuspüren. Die zu lösenden Probleme sind zahlreich, die technische Herausforderung gerade bei den Jitter-Buffern nicht zu gering. Sowohl das MEF als auch andere Gremien wie die IETF und das MPLS-Forum arbeiten an allen Fronten, um die Probleme zu lösen und das Ergebnis in einem Standardpapier zu lösen. Wie schnell eine allgemeine Spezifikation ratifiziert wird, ist schwer zu sagen. Sicher scheint, dass es in diesem Jahr nicht geschehen wird.
Richtungsweisend
Wenn Unternehmenskunden Dienste einfordern, werden sie sich Carrier und ISPs suchen, die solche Services in entsprechender Qualität anbieten. Es ist daher keine Frage, ob Ethernet als WAN-Strecke überhaupt verfügbar sein wird. Entscheidend ist vielmehr, wie schnell die Netzbetreiber die neue Technik adaptieren. Die IT-Industrie hat mit ihren verfügbaren und angekündigten Produkten mehrere Migrationspfade geöffnet, die den unterschiedlichen Ausgangspunkten der Carrier Rechnung tragen. Ob ein Netzbetreiber nun Ethernet pur macht oder die Pakettechnik in welcher Form auch immer an sein Sonet/SDH-Netz koppelt, dürfte für den Unternehmenskunden eher zweitrangig sein. Ihn interessieren die SLAs und der Preis für den Dienst. Über den Preis allerdings kommt wieder die Technik mit ins Spiel. Denn wenn sich die OpEx-Zahlen der MEF-Studie in der Breite bestätigen, wird ein Stadtnetzbetreiber mit einer reinen Ethernet-Infrastruktur die Einsparungen bei den Betriebskosten an den Kunden weitergeben können. Sein Dienst wäre am Ende ein Stück günstiger. [ pm ]