IT-Outsourcing und Nutzungsrechte
IT-Outsourcing und Nutzungsrechte Egal, ob IT-Outsourcing mit der Software des Kunden, der des Anbieters oder gar mit vom Anbieter neu entwickelter Software betrieben wird, immer ist eine vertragliche Regelung nötig.
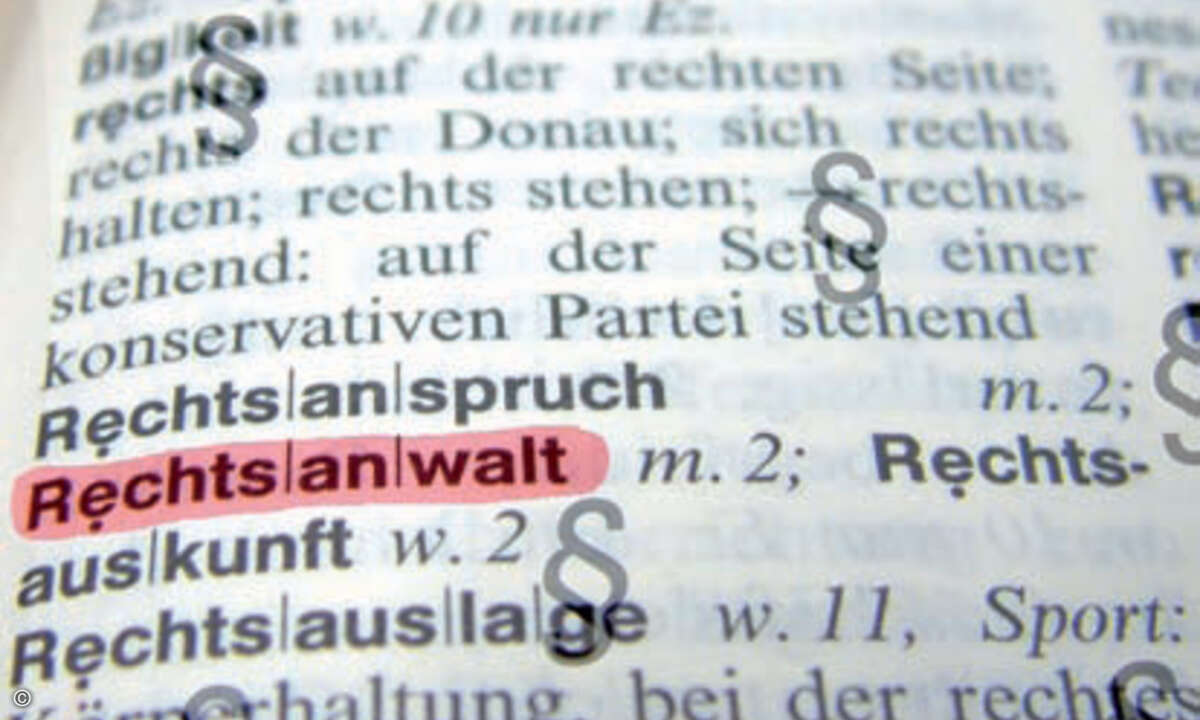
Oftmals wird beim IT-Outsourcing die beim Kunden vorhandene Software vom Anbieter übernommen und dann im Rechenzentrum des Anbieters betrieben. Umgekehrt kommt es auch vor, dass der Anbieter dem Kunden eigene Software zur Nutzung zur Verfügung stellt. Schließlich gibt es in der Praxis auch Fallkonstellationen, in denen der Anbieter für den Kunden Software neu entwickelt und hieran dem Kunden Nutzungsrechte einräumt. In allen Fällen ist es erforderlich, die jeweils im Einzelfall an der Software zu gewährenden Nutzungsrechte vertraglich zu regeln. Als Grundsatz ist hierbei zu beachten, dass – soweit Software betroffen ist – die jeweiligen Nutzungsrechte bei derjenigen Person liegen müssen, auf deren Hardware die Software »abläuft«. Aus rechtlicher Sicht ist zu berücksichtigen, dass bereits die Installation einer Software sowie das bloße Laden in den Arbeitsspeicher als urheberrechtlich relevanter Vervielfältigungsvorgang einzustufen ist, der als solcher immer der Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers bedarf. Der Anbieter benötigt daher immer die entsprechenden Nutzungsrechte des originären Rechteinhabers für die in seinem Rechenzentrum in diesem Sinne ablaufende Software, auch wenn er diese von seinem Kunden »beigestellt« bekommt. Hingegen benötigt der Kunde die entsprechenden Nutzungsrechte für die in seinem Unternehmen, zum Beispiel auf den dort noch vorhandenen Arbeitsplatz-Rechnern, ablaufende Software. In der Praxis wird leider sehr oft vergessen, dass auch an Datenbanken eigenständige und wirtschaftlich wertvolle Rechte bestehen können. Oft übernimmt der Anbieter die Verwaltung und den Betrieb einer bereits vom Kunden erstellten Datenbank im Wege der Auftragsdatenverarbeitung. Ebenso kommt es auch häufig vor, dass der Anbieter die Entwicklung, Strukturierung und Verwaltung neuer Datenbanken übernimmt oder aber während des Betriebs neue wertvolle Datenbanken entstehen beziehungsweise bestehende Datenbanken wesentlich durch neue Daten ergänzt werden. Insbesondere in den letzteren Fällen ist auch hier ausdrücklich zu regeln, wem die Rechte an solchen »neuen« Datenbanken bei Vertragsbeendigung zustehen sollen.
Bestandsaufnahme und Due Dilligence
Gerade im Bereich der Einräumung von Nutzungsrechten an Software gilt, dass die vertragliche Umsetzung erheblich erleichtert wird, wenn vor der Betriebsübernahme eine umfangreiche Due Dilligence beim Kunden durchgeführt wird. Im Rahmen dieser Prüfung sollte insbesondere festgestellt werden, ob der Kunde, der im weiteren Projektverlauf Nutzungsrechte an den Anbieter einräumen muss beispielsweise soll, auch rechtlich hierzu in der Lage ist oder ob er gegebenenfalls die Zustimmung Dritter – insbesondere des originären Rechteinhabers (zum Beispiel eines Softwarelieferanten) – zu der beabsichtigten Rechteinräumung einzuholen hat. Folgender Fragenkatalog hat sich in der Praxis bewährt:
– Ist die Software gekauft oder gemietet? Falls Miete, wann läuft der Mietvertrag aus?
– Enthalten die Softwarelizenzbedingungen Weitergabeeinschränkungen oder Weitergabeverbote?
– Enthalten die Softwarelizenzbedingungen eine Klausel, wonach die Software nur auf einem definierten System genutzt werden darf (sogenannte »CPU-Klausel»)?
– Ist eine maximale Anzahl von gleichzeitig mit der Software arbeitenden Nutzern vertraglich vereinbart (»Concurrent User«)? Erhöht sich diese Anzahl durch die Auslagerung?
– Wird die Nutzung der Software von der Leistungsfähigkeit der Hardware abhängig gemacht und ist eine Nachlizenzierung notwendig bei einem Wechsel auf leistungsfähigere Hardware?
– Bleibt der Kunde für die Softwarepflege verantwortlich oder sollen Softwarepflege- und Wartungsverträge vom Anbieter übernommen werden?
Die Übertragung von Nutzungsrechten an den Anbieter
In den meisten Outsourcing-Projekten wird der Kunde seine bislang im eigenen Haus betriebene Software an den Anbieter zum weiteren Betrieb in dessen Rechenzentrum übergeben. Hinsichtlich der dann einzuräumenden Nutzungsrechte, ist zwischen Software, an der der Kunde sämtliche Nutzungs- und Verwertungsrechte hat (»Eigensoftware«) und Software Dritter (»Fremdsoftware«), deren Nutzung vom Kunden lediglich lizenziert wurde, zu differenzieren.
Keine Probleme bei Eigensoftware des Kunden
Soweit es sich bei der an den Anbieter zu übergebenden Software um Software handelt, die der Kunde alleine in seinem Unternehmen geschaffen hat beziehungsweise durch einen Dritten ausschließlich für sich hat entwickeln lassen, ergeben sich wenig Probleme. Der Kunde kann nämlich als Rechtsinhaber frei entscheiden, ob und in welchem Umfang er Nutzungsrechte an der Software an den Anbieter einräumt. Da der Anbieter die Software des Kunden in der Regel lediglich zur Erbringung der geschuldeten Dienstleistung benötigt, die zudem in zeitlicher Hinsicht auf die Laufzeit des IT-Outsourcingvertrages beschränkt ist, wird der Kunde an der Eigensoftware nur ein entsprechend beschränktes Nutzungsrecht einräumen.
Vorsicht bei genutzter Software
In rechtlicher Hinsicht schwieriger ist es, wenn dem Anbieter Fremdsoftware zur Nutzung in seinem Rechenzentrum überlassen wird. In dieser Situation, empfiehlt es sich, mit dem jeweiligen originären Rechteinhaber vor Beginn eines IT-Outsourcingprojekts Kontakt aufzunehmen. Schon im Hinblick auf die gegebenenfalls vom Anbieter zu übernehmenden beziehungsweise neu abzuschließenden Softwarepflege- und Wartungsverträge macht dies Sinn. In der Vielzahl der Fälle wird sich zudem bereits vorab mit dem jeweiligen Softwarelieferanten vereinbaren lassen, dass die Software nunmehr durch den Anbieter im Rahmen des Outsourcings genutzt wird. Allerdings sollte man zusätzlich prüfen, ob diese Zustimmung des Rechteinhabers zur »Überlassung« der Software an den Anbieter überhaupt rechtlich notwendig ist. Insbesondere in den Fällen, in denen der Rechteinhaber nach Mitteilung der beabsichtigten Überlassung an den Anbieter finanzielle Forderungen stellt, dürfte es sehr hilfreich sein, eine entsprechende Rechtsposition aufzubauen. Für die Frage, ob zur »Weitergabe« der Software an den Anbieter eine Zustimmung des Softwarelieferanten notwendig ist, kommt es entscheidend darauf an, ob der Kunde die Software dauerhaft gegen Einmalzahlung (Softwarekauf) oder aber nur für einen beschränkten Zeitraum (Softwaremiete) überlassen bekommen hat. Die Überlassung von gekaufter Standardsoftware dürfte jedenfalls dann ohne Zustimmung des Rechteinhabers möglich sein, wenn die Software nur noch im Rechenzentrum des Anbieters genutzt wird, sämtliche Kopien beim Kunden gelöscht und keine weitere Nutzung der Software durch den Kunden stattfindet. Dies gilt unter Umständen selbst dann, wenn die Standardlizenzbedingungen ein ausdrückliches sogenanntes Weitergabeverbot enthalten. Solche pauschalen Weitergabeverbote sind nämlich in der Regel unwirksam und daher rechtlich nicht durchsetzbar. Etwas anderes gilt jedoch bei gemieteter Software, da die Einschränkung oder auch die vollständige Untersagung der Weitergabe der Software in den entsprechenden Mietbedingungen ohne weiteres wirksam vorgegeben werden kann. Daher wird man hinsichtlich gemieteter Software in jedem Fall mit dem Softwarelieferanten reden müssen.
Datenbanken
Im Zusammenhang mit Datenbanken und den hieran bestehenden Rechten ist lediglich zu empfehlen, ausdrücklich vertraglich festzulegen, dass diese ausschließlich dem Kunden zustehen. Der Kunde sollte dem Anbieter insoweit lediglich ein einfaches, zeitlich bis zur Beendigung des Vertragsverhältnisses begrenztes und nicht übertragbares Nutzungsrecht an den jeweiligen Datenbanken einräumen, damit dieser seine vertraglichen Verpflichtungen – in erster Linie Pflege und Betrieb – erfüllen kann.
Die Übertragung von Nutzungsrechten an den Kunden
In den meisten IT-Outsourcing-Projekten wird der Kunde nicht nur »seine« alte Software nutzen, sondern auch neue Software, die ihm vom Anbieter zur Nutzung zur Verfügung gestellt wird. Hierbei kann es sich wiederum um Eigensoftware oder Fremdsoftware des Anbieters handeln. Zudem gibt es auch Fallkonstellationen, in denen der Anbieter mit der Erstellung einer Individualsoftware beauftragt wird. Im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Software sind dem Kunden wiederum die notwendigen Nutzungsrechte einzuräumen. In der Regel wird dem Kunden nur ein einfaches Nutzungsrecht eingeräumt werden. Etwas anderes kann jedoch für eine Individualsoftwareentwicklung gelten. Hier wird der Kunde ein Interesse daran haben, möglichst umfassende Nutzungsrechte an der für ihn individuell erstellten Software zu erhalten. Insofern dürfte der Kunde auf die Einräumung von ausschließlichen Nutzungsrechten bestehen. Soweit die Software dann im Rechenzentrum des Anbieters betrieben wird, wird der Kunde dem Anbieter im Wege der Rücklizenzierung ein entsprechendes einfaches Nutzungsrecht einräumen, damit dieser seinen vertraglichen Verpflichtungen nachkommen kann. Die gegenseitige Einräumung von Nutzungsrechten im Rahmen eines IT-Outsourcings ist wirtschaftlich immens wichtig und rechtlich sehr komplex. Nur durch eine durchdachte Vertragsgestaltung lassen sich die Interessen beider Vertragsparteien angemessen berücksichtigen.
Peter Huppertz ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Informationstechnologie in Düsseldorf










