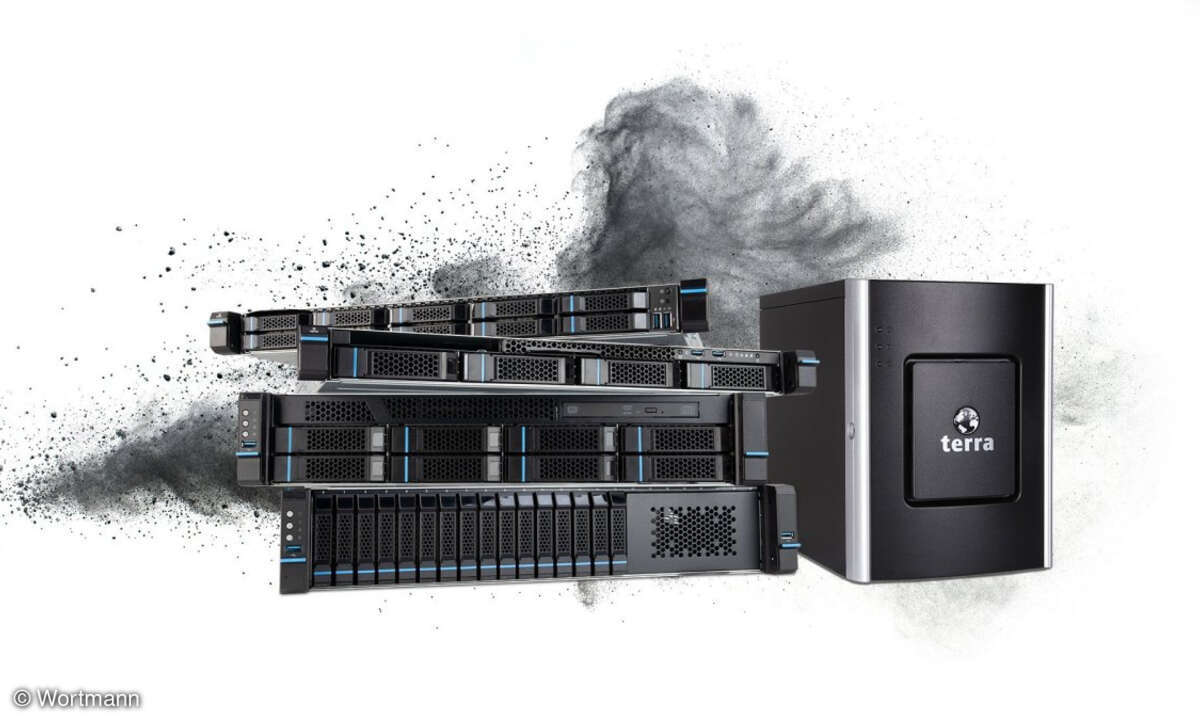Leistungsmessung im Sekundentakt
Performance-Monitoring im WAN – Die Sicherstellung der erforderlichen Netzwerkleistung setzt verlässliche und zeitnahe Messwerte sowie ein detailliertes Reporting voraus. Nur so lassen sich Service-Levels überprüfen und etwaige Störungen schnell analysieren und beseitigen.


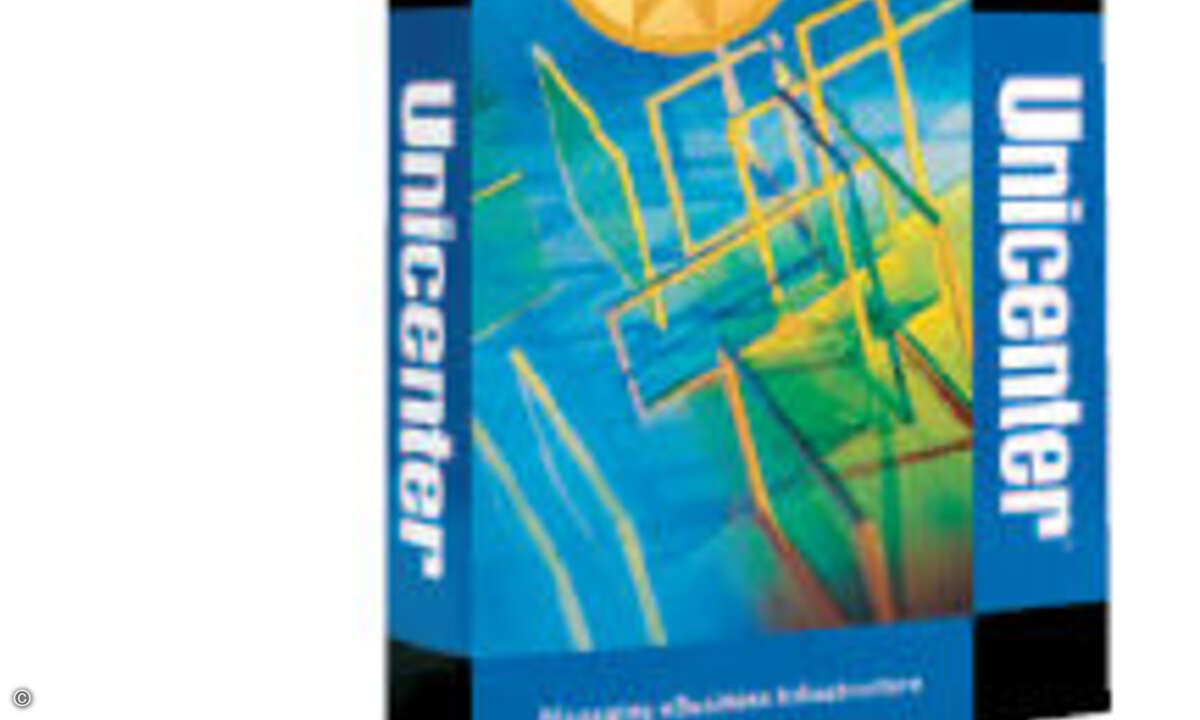
Unternehmen benötigen an sämtlichen Standorten garantierte Datendurchsätze, um keine Ausfälle bei geschäftskritischen Anwendungen zu riskieren. Ein Nadelöhr im Netz stellen dabei meistens Hardwarekomponenten wie Router oder Switches dar. Herkömmliche Monitoringsysteme, die komponentenbezogen bestimmte Schlüsselkennzahlen auslesen, beispielsweise Paketverzögerungen und -verluste von Testpaketen auf dem Weg von einem Router oder Switch zum nächsten, sind in aller Regel nicht in der Lage, das Leistungsverhalten von LAN zu LAN ausreichend gut darzustellen. Auch Verkehrsstaus in Routern an den einzelnen Standorten (Customer-Premise-Equipment) finden oft keine Berücksichtigung.
Zu wenig Transparenz bei der Netzüberwachung
Die eigentliche Schwierigkeit ist aber die ungenügende Dokumentation des Datenverkehrs und damit die unzureichende Überwachung der einzelnen Unternehmensapplikationen. Laut einer Umfrage, die IDC im Auftrag von Ipanema Technologies Ende 2005 bei 107 Unternehmen in Deutschland, Frankreich und Großbritannien durchführte, haben mehr als die Hälfte aller Befragten keine technischen Möglichkeiten, die über das WAN gehenden Anwendungsströme live zu analysieren.
Mag es auch durchaus so etwas wie Service-Klassen im Netz geben, letztlich liegen den betreffenden Unternehmen keine ausreichenden Informationen vor, um die Einhaltung der Services zeitnah zu kontrollieren und natürlich noch viel weniger eine Option, steuernd einzugreifen. Um diese Defizite beseitigen zu können, müssen die Netzwerkadministratoren wissen, was läuft. Sie benötigen detaillierte, aktuell erstellte Berichte über das Geschehen im Netz und an den Netzknoten.
Dass dabei die Unmengen von Protokolldaten automatisch auf die wesentlichen, sprich für die Steuerung der Geschäftsprozesse entscheidenden Faktoren, kondensiert werden müssen, ist selbstverständlich. Genauso sollte es heute Stand der Technik sein, dass der Administrator beliebige Teilelemente in den Fokus nehmen kann – seien es Domänen, einzelne Server- oder Rechenzentrumsbereiche ebenso wie Anwendungsgruppen, Einzelapplikationen oder bestimmte Netzsegmente und Programmabläufe. Über all diese Bereiche sollte sich überdies ein beliebig definierbares Zeitfenster – Stunden, Tage, Wochen oder Monate – setzen lassen.
Netzsteuerung durch interaktives Reporting
Moderne Reports in dem genannten Sinn sind keine Akten zum Abheften, sondern aktuelle Arbeits- und Steuerungsinstrumente. Sie sollten zeitnah die Situation im Netz beziehungsweise in einem Netzsegment darstellen und interaktiv Wege zur weiteren Optimierung aufzeigen. Ausgefeilte Systeme zur Überwachung der Systemleistungen liefern sowohl Tabellen mit detaillierten Messergebnissen zu allen genannten Netz- und Systemelementen als auch Übersichtsberichte, beispielsweise über die gelieferten Service-Levels oder die Niederlassungen mit der schlechtesten Performance.
Basis hierfür sind einfache und präzise Qualitätsindikatoren für die Anwendungsperformance wie der vom Welttelekom-Verband ITU definierte Mean-Opinion-Score, kurz MOS, für VoIP. Das Maß berechnet sich aus den Parametern Paketverzögerung und Paketverluste sowie dem arithmetischen Mittel der Laufzeitunterschiede. Bei der Ermittlung des MOS-Werts werden darüber hinaus sowohl der jeweils verwendete Analog-Digital-Umsetzer (Codec) berücksichtigt als auch die Pakete bis zur Applikationsebene hinauf unter die Lupe genommen.
Traditionelle Überwachungssysteme, die ohne die genannten zeitnahen Überwachungs- und interaktiven Reporting-Mechanismen arbeiten, lassen keine wirkliche Bewertung der Netzleistung und der Leistungsvereinbarungen zu. Bei dieser traditionellen Art des Monitorings wird nämlich nicht der tatsächliche Verkehr gemessen, sondern nur ein durch regelmäßigen Versand von Testpaketen simulierter Verkehr.
Überdies werden nur bestimmte als wichtig definierte Netzwerkknoten berücksichtigt. Unternehmen, die nicht auf neue Technologien umsatteln wollen, sind letztlich dazu gezwungen, die Netzwerkleistung durch eine präventive Überdimensionierung der Bandbreite oder eine allgemeine Komprimierung des gesamten Datenverkehrs zu verbessern. Die Kapazitäten auf bloßen Verdacht hin zu erweitern, führt in den seltensten Fällen zu dem gewünschten Erfolg. Im besten Fall laufen die Anwendungen ohne sichtbare Probleme und die Leistungsvereinbarungen können formal eingehalten werden. Eine garantierte Dienstgüte für die Applikationen lässt sich damit nicht zwangsläufig sicherstellen. Auch eine generelle Komprimierung des Datenverkehrs im Netz bringt meist keine überzeugenden Verbesserungen, da sich nicht flexibel auf die Bedarfssituation der einzelnen Anwendungen reagieren lässt.
Herkömmliche Service-Klassen sind zu statisch
Inzwischen ersetzen viele Unternehmen ihre herkömmlichen Telekom-Netze auch deshalb durch moderne IP-Netze, weil auf diesem Wege ein präziseres Bandbreiten-Management realisiert werden kann. Diese so genannten »Multi-Protocol-Label-Switching VPNs« (MPLS-VPNs) ermöglichen es, Anwendungen gemäß ihrer unterschiedlichen Anforderungen zu priorisieren. Dabei werden die gesamten verfügbaren Ressourcen in unterschiedliche Service-Klassen eingeteilt und jeder Anwendung entsprechend ihrer Wichtigkeit ein festgelegtes Maß an Bandbreite zugeordnet.
Die Flexibilität einer solchen Lösung hat allerdings ihre Grenzen. Denn dabei tritt schnell der Fall ein, dass in einer Klasse Bandbreite ungenutzt bleibt, während sie in einer anderen Klasse fehlt. Ein weiterer Nachteil dieses Konzepts ist zudem, dass in einer Klasse unterschiedlichste Anwendungen mit komplett verschiedenen Anforderungen zusammengefasst werden. So benötigt eine Terminalserver-Applikation wie Citrix zwar nur kleine Datenströme von vielleicht 20 bis 30 kBit/s, diese müssen aber kontinuierlich übertragen werden.
Ist dies nicht der Fall, kommen ein Mausklick oder die Eingabe einer Zeichenkette nur verzögert an, so dass ein vernünftiges Arbeiten unmöglich wird. SAP-Anwendungen wiederum übertragen als maskenorientierte Systeme in der Regel größere Datenmengen in einem Schub. Durch die Einordnung in die selbe Service-Klasse sind die beiden genannten Applikationen gleichberechtigt. De facto treten sie in dieser Klasse aber zueinander in Konkurrenz und das großvolumige SAP-System kann im ungünstigsten Fall die Citrix-Anwendung vollständig ausbremsen.
Optimierte Bandbreitenzuteilung
Durch eine »Dynamisierung der Service-Klassen« lässt sich das beschriebene Manko beseitigen. Dafür muss das Managementsystem aber in der Lage sein, die Zustände im Netz praktisch in jeder Sekunde genau zu kennen. Auto-adaptive Lösungen berechnen im Gegensatz zu den oben genannten statischen Verfahren praktisch in jeder Sekunde neue Parameter für die optimale Ausnutzung der Bandbreite. Daraus ergibt sich ein bedarfsgerecht reagierendes System, das die gesamte Bandbreite optimal aufteilt, sodass jeder Applikation ausreichend Bandbreite zur Verfügung steht und keine Ressourcen verschenkt werden.
Zudem wird verhindert, dass sich Anwendungen in ein und der selben Klasse wechselseitig behindern oder blockieren. Gewährleistet wird diese flexible Einteilung durch die Kombination von Echtzeit-Monitoring und dynamischer Berechnung der Optimierungsregeln. Die Effizienz bei der Messung und Bandbreitensteuerung wird dadurch erreicht, dass diese Systeme sämtliche Ebenen des OSI-Modells im Blick haben und sich nicht wie ältere Management-Systeme alleine auf Layer-4 beschränken.
Alles im Blick
Mit Hilfe eines solchen Netzwerkmanagement-Systems wird nicht nur ein Echtzeit-Controlling des Netzwerkes erreicht, sondern es können Performance-Beeinträchtigungen rechtzeitig erkannt und behoben werden. Hardware-Boxen am Übergang vom globalen ins lokale Netz analysieren in Echtzeit jedes einzelne Datenpaket im gesamten Netzwerkverkehr bis hinauf zur Anwendungsschicht. Die Appliances an den verschiedenen Standorten synchronisieren in Millisekunden-Abständen die erhobenen Messdaten.
Die Datenpakete erhalten dabei nicht nur eine Signatur, sondern es erfolgt auch eine Erfassung und Erkennung der laufenden Anwendungen anhand der Adressorientierung, des IP-Protokolltyps, der genutzten Ports sowie des Verbindungsaufbaus. Einzelne Leistungsparameter wie Verzögerung, Laufzeitunterschiede (Jitter), Paketverluste und Durchsatz werden für jedes Datenpaket genau gemessen. Dank dieser formalisierten Performance-Key-Indikatoren lässt sich später ein direkter Vergleich der Service-Level-Vorgaben mit den tatsächlich erreichten Werten ziehen, so dass neben der Steuerung des Datenverkehrs quasi als Sekundäreffekt genaue Leistungsnachweise möglich sind.
Das interaktive Monitoring moderner Netzwerkmanagement-Systeme ermöglicht den Administratoren, die Vorgänge im Weitverkehrsnetz schnell nachzuvollziehen. Die erhobenen Daten werden im Minutentakt gesammelt, aggregiert und in Form umfassender Echtzeit-Reports zur Verfügung gestellt. Grafische Interfaces zeigen auf einen Blick alle aktiven Datenströme im WAN gemäß ihrer Wichtigkeit für die Steuerung der Geschäftsprozesse. Außerdem informieren farbliche Markierungen sowie Alarmmeldungen, wenn Grenzwerte erreicht werden. Die Administratoren können innerhalb des gesamten Netzes navigieren, einzelne Bereiche heranzoomen, bei Bedarf detaillierte Messdaten zur aktuellen Situation abrufen und per Mausklick entsprechende Tasks zur Fehlerbehebung erstellen. Auf diese Weise lässt sich schnell auf Schwachstellen im System reagieren.
Durch ein solches Live-Reporting sehen die Unternehmen jederzeit, ob die vereinbarten Service-Levels eingehalten wurden oder wo Abweichungen aufgetreten sind. Auch die von Carriern oder Service-Providern erbrachten Netzwerkdienste lassen sich damit effizient kontrollieren und bewerten. Der Leistungsbeitrag der einzelnen Komponenten ist über Maßzahlen dargestellt, die gleichermaßen für Fachabteilungen, Geschäftsleitung und Netzwerkmanager verständlich sind. Rollenspezifisch aufbereitete Berichte vereinfachen die Kommunikation und tragen zu einer schnelleren Lösungsfindung bei Problemen bei.
Last but not least kann die IT dem Controlling dadurch einfach zu handhabende Verrechnungsdaten liefern und damit die von vielen Unternehmen immer häufiger geforderte Leistungsverrechnung bewerkstelligen.
Hans Pfau,
Country Manager Deutschland,
Ipanema Technologies