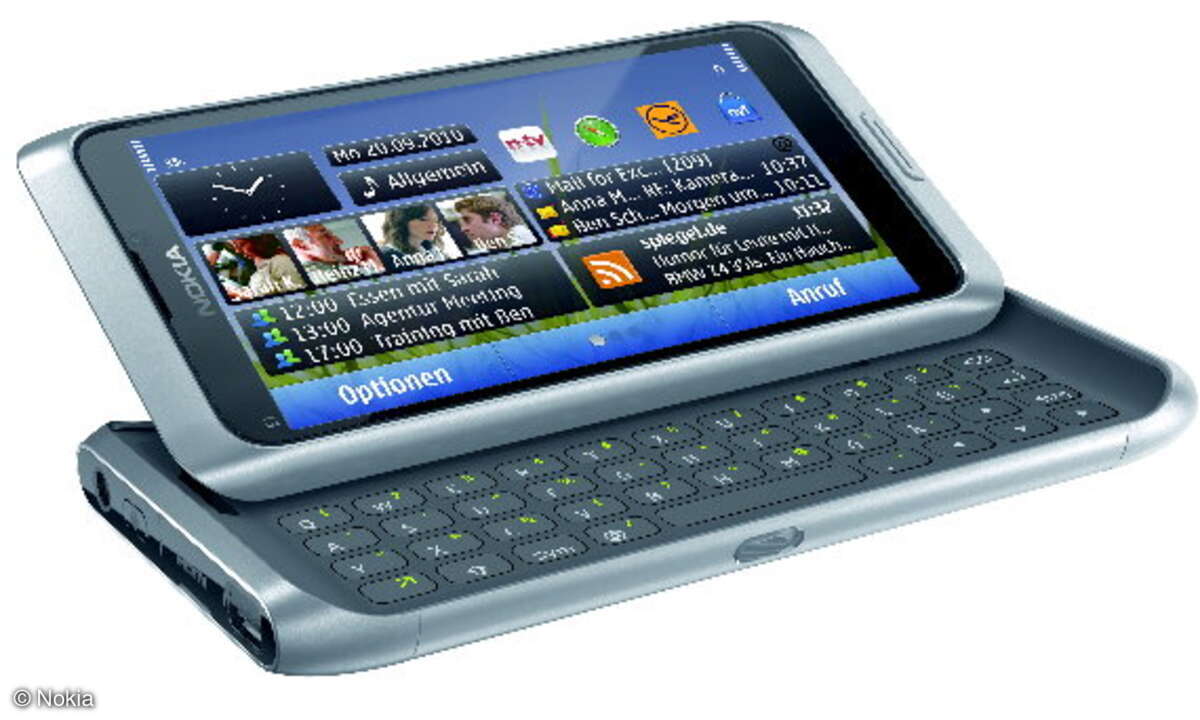Paradigmenwechsel bei IT-Services
Paradigmenwechsel bei IT-Services. Die Zeit der Technik ist vorbei, die Zeit der Prozesse ist gekommen. So auch bei Service Level Agreements, die zunehmend von Geschäftsprozessen statt aus der IT abgeleitet werden.
Paradigmenwechsel bei IT-Services
Outsourcing-Projekte werden zumeist von Service Level Agreements (SLAs) flankiert, von denen sich die Unternehmen einen problemlosen Geschäftsbetrieb erhoffen. Doch herkömmliche SLAs beschreiben im günstigsten Fall nur das Funktionieren der IT. Funktionsbezogene SLAs hingegen werden aus den Geschäftsprozessen eines Unternehmens abgeleitet und sorgen für die reibungslose Bereitstellung der dafür erforderlichen Funktionen. Zudem bieten sie eine bisher nicht gekannte Flexibilität und Kostentransparenz, die sich bis auf konkrete Geschäftsvorgänge herunterbrechen lässt.
Für Georg Reul, Mitglied des Vorstands bei IVG Immobilien, war der Fall klar: »Erst die Vereinbarung funktionsbezogener Service Level Agreements hat uns ein IT-Outsourcing überhaupt erst ermöglicht.« Seine Worte drücken die Zufriedenheit aus, die er für das Ergebnis empfand, das in den gemeinsamen Vertragsverhandlungen mit einem neuen Serviceprovider erreicht werden konnte. Bislang hatte die eigene IT-Tochter für die Bereitstellungen der Leistungen gesorgt, die für die Verwaltung des Immobilienvermögens und für das Projektentwicklungsvolumen erforderlich waren.
Was aber steckt hinter dem Begriff »funktionsbezogene SLAs«? Als Service Level Agreement (SLA) wird grundsätzlich eine Vereinbarung als Bestandteil eines Dienstleistungs- oder Wartungsvertrages bezeichnet, in der die zu erfüllenden Kriterien eines Dienstes festgelegt, hinsichtlich Umfang und Qualität quantifiziert und bezüglich der Art der Leistungserbringung definiert werden. Die als de facto Standard geltende IT Infrastructure Library (ITIL) führt in einem SLA beispielsweise Reaktionszeiten für Supportleistungen oder maximale Ausfallzeiten von IT-Services an.
Kosten sauber abgebildet
Für Reul und seine Berater war klar, dass bislang praktizierte SLAs mehr oder minder nur die Funktionsfähigkeit von Technologien messbar beschreiben können. Für die IVG war es jedoch wichtig, die IT-Leistungen bestimmten Funktionen zuordnen zu können und diese auch von den Kosten her sauber abzugrenzen. Das Ziel musste daher sein, SLAs zu erarbeiten, in denen die Verfügbarkeit von Geschäftsprozessen ermöglicht wird.
Mit der Einsicht in die Notwendigkeit, Prozesse in IT-Organisationen einzuführen (die über die abstrakte Darstellung von Mindmaps hinaus gehen) wuchs in den IT-Organisationen auch die Erkenntnis, dass prozessorientiertes Vorgehen im Ergebnis nur vorteilhaft sein kann: Die Möglichkeit, Kennzahlen zu ermitteln, die eigenen Leistungen zu messen und mithin die erforderlichen Managementakzente für Qualität setzen zu können, eröffnet trotz der so gefürchteten Vergleichbarkeit gegenüber Drittanbietern eine stringente Positionierung gegenüber dem eigenen Servicenehmer. Hinzu kommt, dass der konkurrierende Drittanbieter zumeist selbst die Transparenz seiner Leistungen noch nicht als Wettbewerbsvorteil erkannt hat und die Messbarkeit scheuen wird.
Einfache Rechnung
Doch selbst wenn Wettbewerb und Marktanforderungen auf absehbare Zeit für mehr Entgegenkommen von Service-Anbietern sorgen sollten, konzentrieren sich die Leistungsangebote fast ausschließlich auf technische und betriebliche Aspekte der Informationstechnologie. Dies übrigens aus guter, alter Tradition: Der klassische Rechenzentrumsbetrieb war ? das zeigt sich in vielen, bestehenden Outsourcingverträgen ? relativ leicht und mit nachvollziehbaren Synergien auszulagern. Die Messbarkeit und Zuordnung von CPU-Zeiten zu Anwendungen galt als bewährtes Verfahren, ebenso wie die IT an sich als Supporteinheit klar abgegrenzt werden konnte. Für Outsourcingverträge der früheren Generationen hieß das vereinfacht, über eine einfache Division von übernommenem Anlagevermögen und Personal durch die Anzahl der zu betreuenden Anwender plus Marge auf einen Servicepreis zu kommen, der durch Leistungsscheine in einzelne Bestandteile zerlegt werden konnte.
Doch mittlerweile hat sich nicht nur die eingesetzte Technologie hin zu hybriden Modellen gewandelt, bei denen klassische Aufgaben des Rechenzentrums vielfach auf lokalen Notebooks ausgeführt werden und es zu einer wahren Herausforderung geworden ist, zentrale Datenhaltung nicht nur aus Gründen gesetzlicher Erfordernissen gegen die Flexibiltätsbestrebungen eines Servicenehmers durchzusetzen; auch die strategische Positionierung der Informationstechnologie hat sich gewandelt. Sie ist viel stärker und schneller in ihrem Anspruch gewachsen, bestimmender und elementarer Bestandteil von einzelnen Geschäftsprozessen in einem Unternehmen zu sein.
Diese Entwicklung wird in Zeiten deutlich, in denen viele Outsourcingverträge zur Neuverhandlung stehen: Servicenehmer sprechen von einer »Blackbox«, die sie Geld kostet, ohne die Kosten bewerten zu können. Servicegeber weisen in SLAs vereinbarte Verfügbarkeiten von Serverschränken, Netzwerkleitungen, Helpdesk-Erreichbarkeiten und PCs aus und rechnen vor, wie die Verfügbarkeiten von IT Systemen gesteigert werden können, indem sie durch additives Beistellen weiterer Systeme Ausfälle in der Wertschöpfungskette minimieren. Aber gerade hier beginnt der eigentliche Irrtum: Wertschöpfungsketten sind aus Geschäftsprozessen zusammengesetzt, aus denen eigene und übergreifende Funktionen ? unabhängig von IT Leistungen- abgeleitet werden. Diese Funktionen können kritisch sein, tatsächlich ist ? streng hinterfragt ? in den meisten Fällen nur ein kleiner Teil wirklich unternehmenskritisch.
Vom »WAS« zum »Wie«
Gehen wir beispielsweise davon aus, dass der entscheidende Geschäftsprozess in einem Unternehmen auf den Erwerb, die Entwicklung und die Veräußerung von Immobilien abzielt, dann kommt der Vorbereitung und der minutiös geplanten Umsetzung von Zahlungstransaktionen eine kritische Bedeutung zu. Oft werden derartige Vorgänge mit Spezialanwendungen durchgeführt, an die nicht die Maßstäbe einer SAP-Betriebsführung gelegt werden können. Um die 100prozentige Verfügbarkeit dieser schwer-betriebsfähigen Anwendungen sicherzustellen, würde der Servicegeber versuchen, die »nahezu-Betriebsfähigkeit« herzustellen, denn das klassische SLA, das diese Vorgehensweise determiniert, dreht sich immer um die Fragestellung »Was muß getan werden, damit die Anwendung verfügbar ist?«. Möglicherweise könnten die Verfügbarkeitserfordernisse darin gipfeln, dass im Vorzimmer des Finanzvorstands ein gespiegeltes Mini-Rechenzentrum für diese Anwendung aufgebaut wird.
Für den Verantwortlichen des Geschäftsprozesses steht aber die Funktion im Vordergrund, und die bezieht sich auf die Durchführung der Transaktion. In einem funktionsbezogenen SLA kann dies besser berücksichtigt werden, denn er stellt im konkreten Fall die Frage »Wie kommt die Transaktion zur Ausführung?« Und führt neben IT-Leistungen auch organisatorische Aspekte ins Feld, indem zum Beispiel in einem detaillierten Planungsverfahren der Kurierdienst einberechnet wird, der für eine pünktliche Ausführung der Transaktion bei der Hausbank sorgen kann.
Funktionen jenseits der IT
Dies zeigt deutlich, dass funktionsbezogene SLAs dort ihre Sinnhaftigkeit entfalten, wo die klassischen SLAs aufhören: Sichern letztere nur den IT-Betrieb, so garantiert ein funktionsbezogener SLA, dass der entsprechende Geschäftsprozess selbst dann zeitgerecht ausgeführt wird, wenn dies durch reine IT-Leistungen schon gar nicht mehr möglich wäre.
Eine leistungsbezogene Vereinbarung muss also individuelle Funktionen anstelle von Technik bieten, denn für den Servicenehmer ist es eher unerheblich, welche technischen Komponenten die ihm bereitgestellten Funktionen ermöglichen. Dadurch wird die Leistung des Servicegebers dort messbar, wo direkte Auswirkungen im Geschäftsprozess entstehen. Die Zuordnung der IT- Kosten zu Funktionen verschafft dem Servicenehmer zudem Kostentransparenz und Kennzahlen, die er etwa für sein eigenes Risikomanagement benötigt. Und ganz nebenbei kann er Stellschrauben entlang der funktionalen Kette etablieren, mit der er die Leistungsqualität überwacht und steuert. Die Erfahrung zeigt, dass immer mehr Unternehmen von Ihren IT-Dienstleistern fordern, ihre Geschäftsprozesse bei der Leistungsgestaltung voranzustellen. Stephan Brendel ist Leiter Consulting bei der Arxes Network Communication
Consulting AG