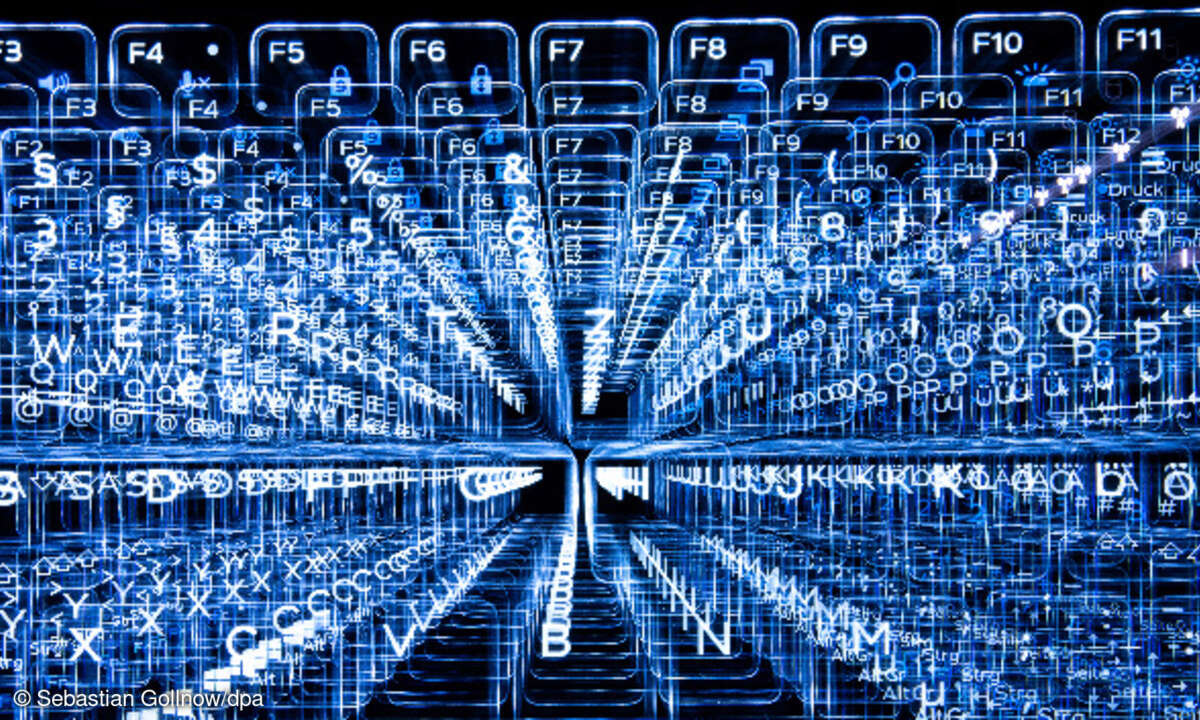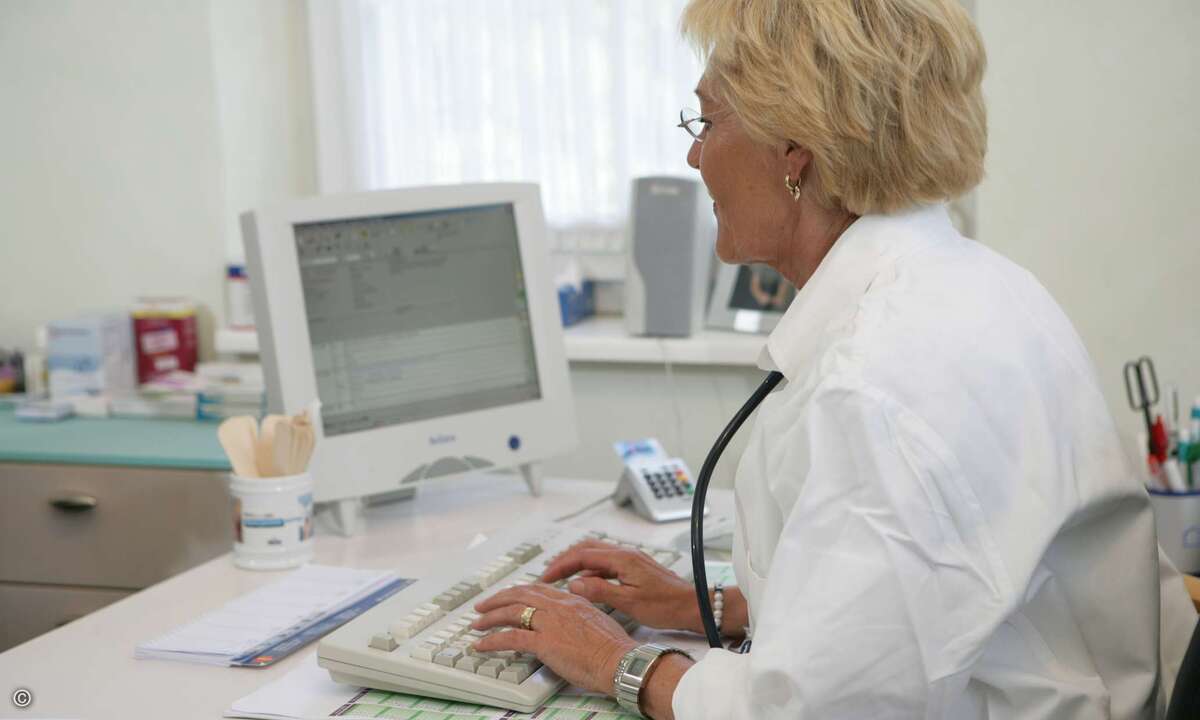Sachsen sichert sich ab
Sachsen sichert sich ab Bei der Sächsischen Landesverwaltung steigt der Bedarf an IP-Adressen stetig. Aus diesem Grund hat sie ausführlich getestet, ob die aktuellen Microsoft-Produkte kompatibel zum Internet Protocol Version 6 sind.

Der Freistaat Sachsen gehört zu den Netzwerkpionieren in Deutschland. Der mit Unterstützung der Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft (IABG) aus Ottobrunn konzipierte InfoHighway Sachsen diente bereits vielen Bundesländern als Modell für deren Netzinfrastrukturen. Derzeit arbeiten etwa 70000 Personen für die sächsische Landesregierung, 45000 PC-Arbeitsplätze sind über Behördengrenzen hinweg miteinander vernetzt. Durch die Umstellung auf internetgestützte Telefonie (Voice over IP) und die starke Zunahme von mobilen Arbeitsplätzen stehen bei der Sächsischen Landesverwaltung nach heutigem Stand ab 2011 keine freien internen IP-Adressen mehr zur Verfügung. Den benötigten Adressraum kann das etablierte Netz auf Basis der Internet Protocol Version 4 (IPv4) dann nicht mehr bereitstellen. Entsprechend erarbeitete Sachsen gemeinsam mit IABG ein Adresskonzept auf Basis der Internet Protocol Version 6 (IPv6). Dieses erlaubt eine vielfach höhere Zahl von IP-Adressen, vereinfacht die Sicherheitseinstellungen und erhöht die Dienstgüte zwischen den Endgeräten. Im Dezember 2005 stellten die IT-Experten des Freistaats Sachsen fest, dass noch längst nicht alle Produkte im Netzwerksektor sich durchgängig für IPv6 eigneten: weder die Software noch die damals verfügbare Hardware. Das galt auch für die in der Landesverwaltung verbreiteten Produkte von Microsoft. Die Entwickler in Redmond bestätigten das Ergebnis der Untersuchung und stellten gleichzeitig eine Roadmap vor, die basierend auf Windows Server 2008 und Windows Vista den Umsetzungszeitplan für IPv6 offenlegte. Gemeinsam mit Microsoft und T-Systems entwickelte Sachsen Anfang 2007 ein Testszenario, das auf dieser Roadmap basierte. Dabei wurden die im Freistaat existierenden Kommunikationsbeziehungen nachgebildet. T-Systems stellte die Netzwerkinfrastruktur bereit, die Redmonder richtete den beteiligten IT-Spezialisten den Zugang zum Windows Longhorn Server Technical Adoption Program (TAP) Evaluation Program ein. »Dieser direkte Zugang zur Produktentwicklung wurde im Rahmen des IPv6-Tests intensiv genutzt«, sagt Jörg Schneider von der Leitstelle InfoHighway in Sachsen: »Wir konnten dadurch sicherstellen, dass jeweils die aktuellsten IPv6-Services getestet wurden.« Gleichzeitig gaben die Testergebnisse Feedback für die Produktentwicklung. Noch im ersten Quartal 2007 starteten die Tests. Dabei wählte die verantwortliche Arbeitsgruppe unterschiedliche Szenarien: Neben einer reinen IPv6-Umgebung evaluierte sie ein über ein Gateway angeschlossenes IPv4-Netz sowie ein gemischtes Netz. Essenziell war die Simulation des auf Active Directory basierenden bestehenden Verzeichnisdienstes mit den neuen Technologien. Dazu gehörten Tests des integrierten DNS (Domain Name Service) und des Dynamic HostConfiguration Protocol (DHCP). Zum Einsatz kamen Windows Server 2008 Beta 3 und RC0, Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 und SUSE Linux 10.2. Als Client-Lösung wurden Vista und XP SP2/SP3 genutzt. Die Teilnahme am TAP für die Nachfolgeversion von ISA Server 2006 ermöglichte es, dessen Beta-1-Release im IPv6-Umfeld zu testen. Nachdem die Netzwerkverbindungen unter IPv6 eingerichtet waren, wurden die vorab definierten Testszenarien mit Erfolg abgearbeitet. Jörg Schneider: »Die Tests im IPv6-Pilotprojekt zeigten, dass es möglich ist, die Infrastrukturdienste auf Basis von Windows Server 2008 umzustellen. Im Netzwerkbereich notwendige Grundfunktionen wie Routing, Switching, Adresszuweisung oder Firewalling sind bei Einsatz aktueller Hard- und Software sichergestellt.« Kleinere Probleme, zum Beispiel mit der DHCP-Autorisierung, sollen mit dem Erscheinen der finalen Version ausgeräumt sein.