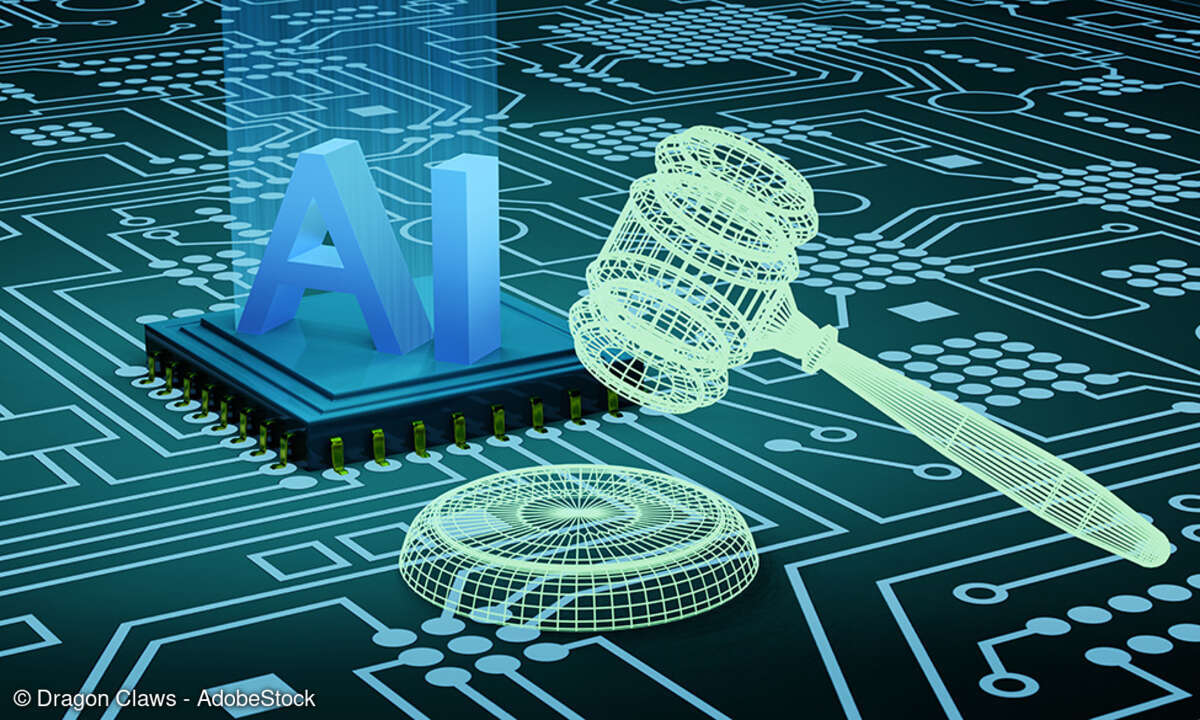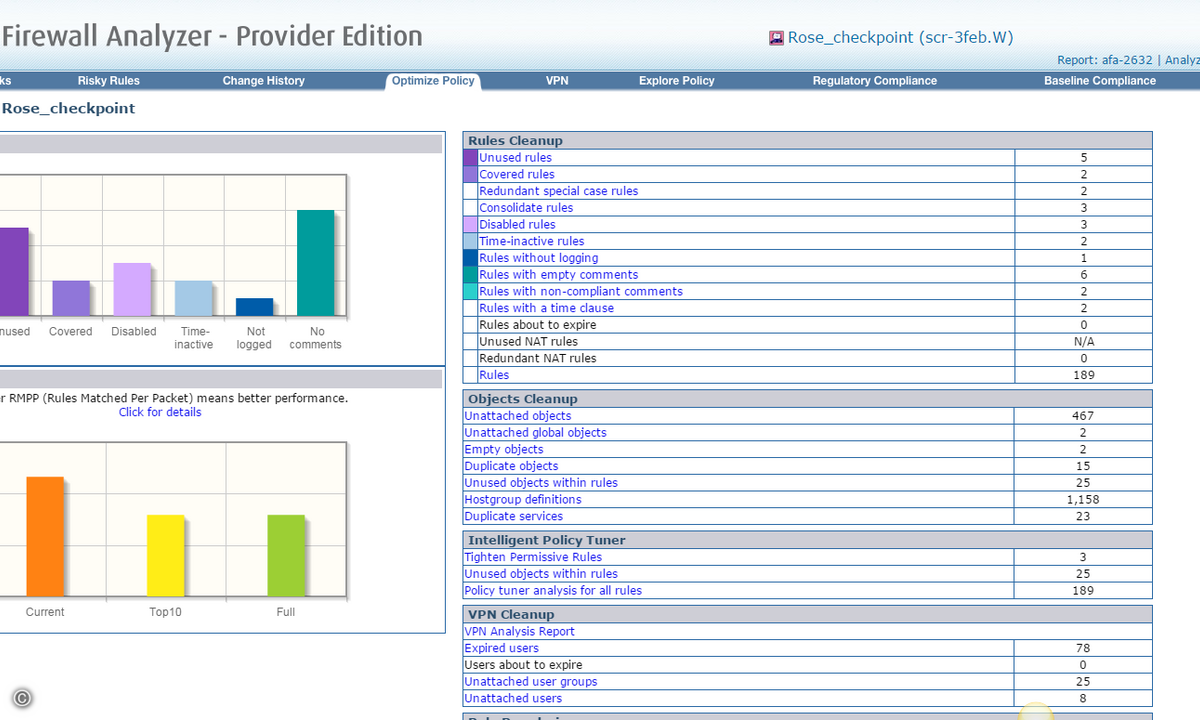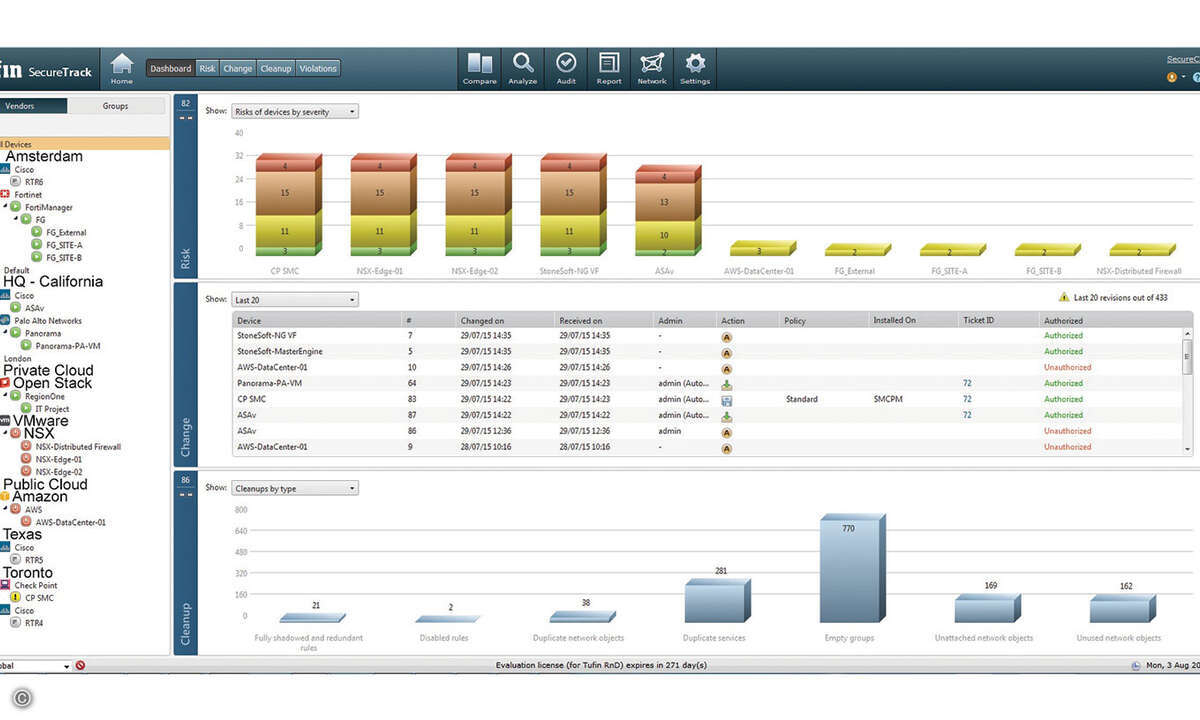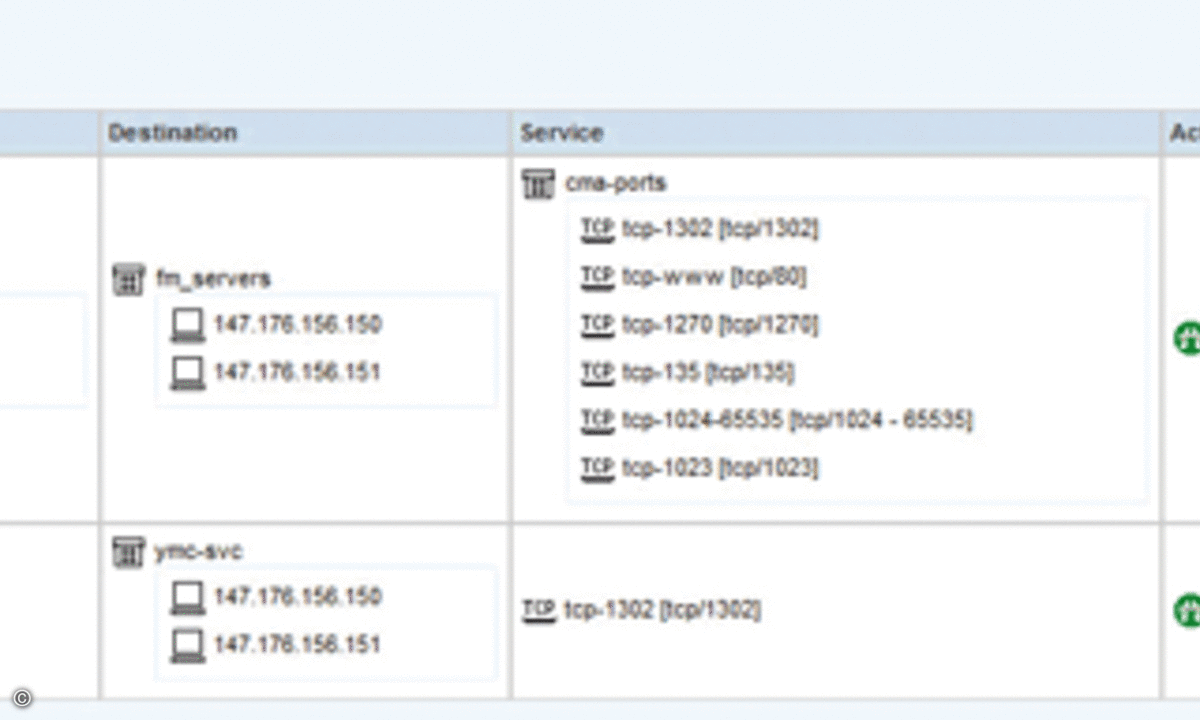So regeln Sie Ihr Verhältnis zum Lieferanten
Partnerschaften können in die Brüche gehen – auch und gerade zwischen Lieferant und Händler. Steht die Trennung an, sind nicht nur Fristen zu beachten. Um diesen und alle anderen wichtigen Punkte bereits mit Beginn der Zusammenarbeit zu regeln, werden Partnerschaftsverträge abgeschlossen.
Die Zusammenarbeit zwischen Herstellern/Lieferanten einerseits und Händlern andererseits werden häufig mit einem Partnerschaftsvertrag besiegelt. Zweck dieser Vertragsform ist es, die grundlegenden Regeln der Zusammenarbeit festzulegen. Sie können als konkreten Inhalt Kooperationsund Vertriebsverträge beinhalten, aber auch Vereinbarungen zu gemeinsamen Werbestrategien und Mindestanforderungen an Qualität (der Ware und des Managements), Auftreten und Abwicklungsregelungen aufweisen.
Kündigungsfrist meist drei Monate
Wenn Sie einem Partnerschaftsvertrag einwilligen wollen, sollte er einige grundlegende Bestandteile beinhalten: Präambel über den Zweck des Vertrages, Hauptleistungsverpflichtungen der beiden Vertragspartner, Nebenleistungspflichten der beiden Vertragspartner, Regeln für Vertragsstörungen, Laufzeit und Kündigungsmöglichkeit sowie letztlich Schriftformklausel und salvatorische Klausel. In Anlehnung an § 309 Nr. 9 BGB ist bei einem solchen als Dauerschuldverhältnis geprägten Vertrag häufig eine Kündigungsfrist von drei Monaten vereinbart. Längere Kündigungsfristen sind gegenüber einem Unternehmer (vgl. § 14 BGB) zulässig (vgl. § 310 BGB). Diese Frist von drei Monaten dürfte auch gelten, wenn keine ausdrückliche vertragliche Regelung hinsichtlich der Kündigungsfristen aufgenommen worden ist. Eine solche fristgerechte Kündigung eines Partnerschaftsvertrages bedarf im Übrigen keiner Begründung.
In § 314 BGB ist weiter die Kündigung von derartigen Dauerschuldverhältnissen aus wichtigem Grund geregelt worden. Liegt ein solcher wichtiger Grund vor, kann das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung beendet werden. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann (§ 314 Abs. 1 S. 2 BGB). Damit stellt die außerordentliche Kündigung die so genannte Ultima Ratio dar, also das letzte Mittel, wenn andere Maßnahmen versagen sollten. Ob dieser Grund konkret vorliegt, ist an Hand der konkreten Umstände des Einzelfalls zu ermitteln. Liegt allerdings der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus dem Vertragsverhältnis, so bestimmt § 314 Abs. 2 BGB, dass eine fristlose Kündigung erst nach erfolgloser Abmahnung des Vertragspartners zulässig ist.