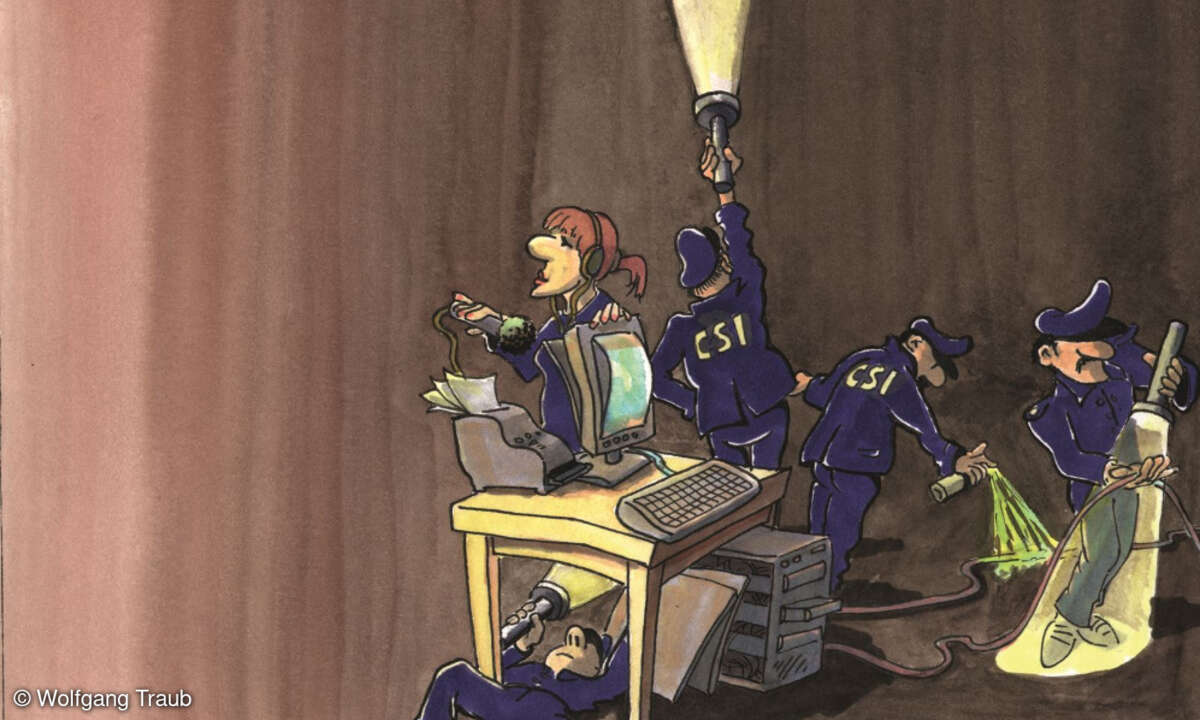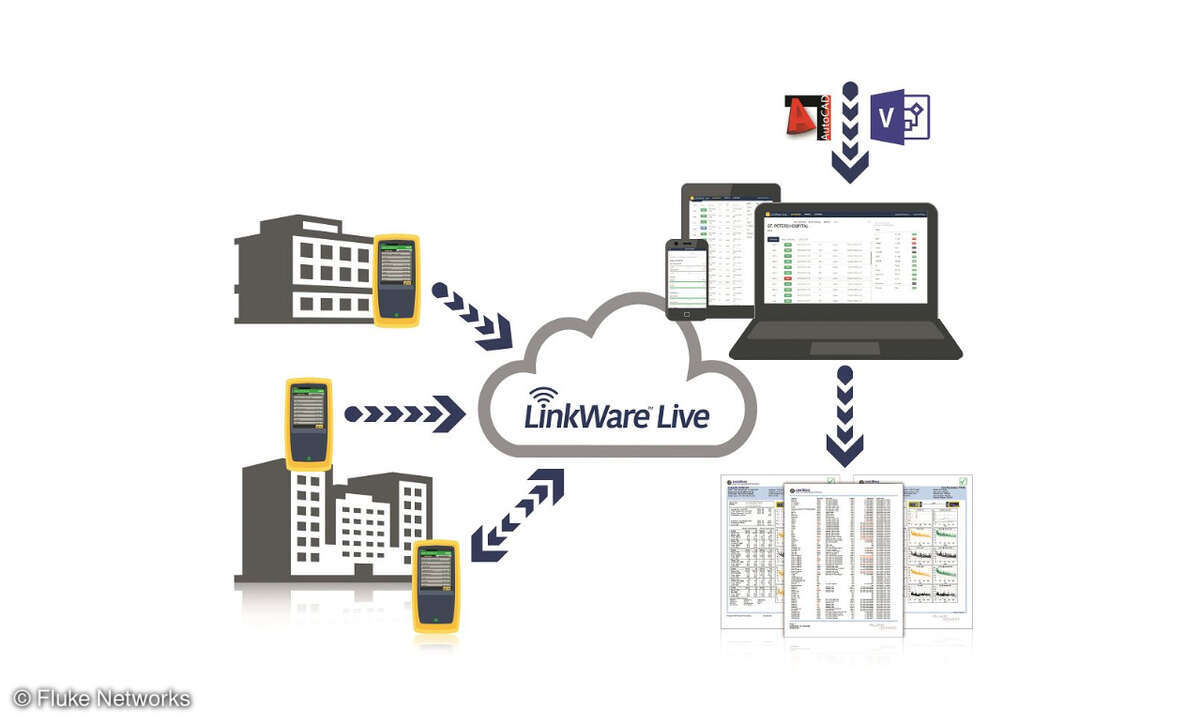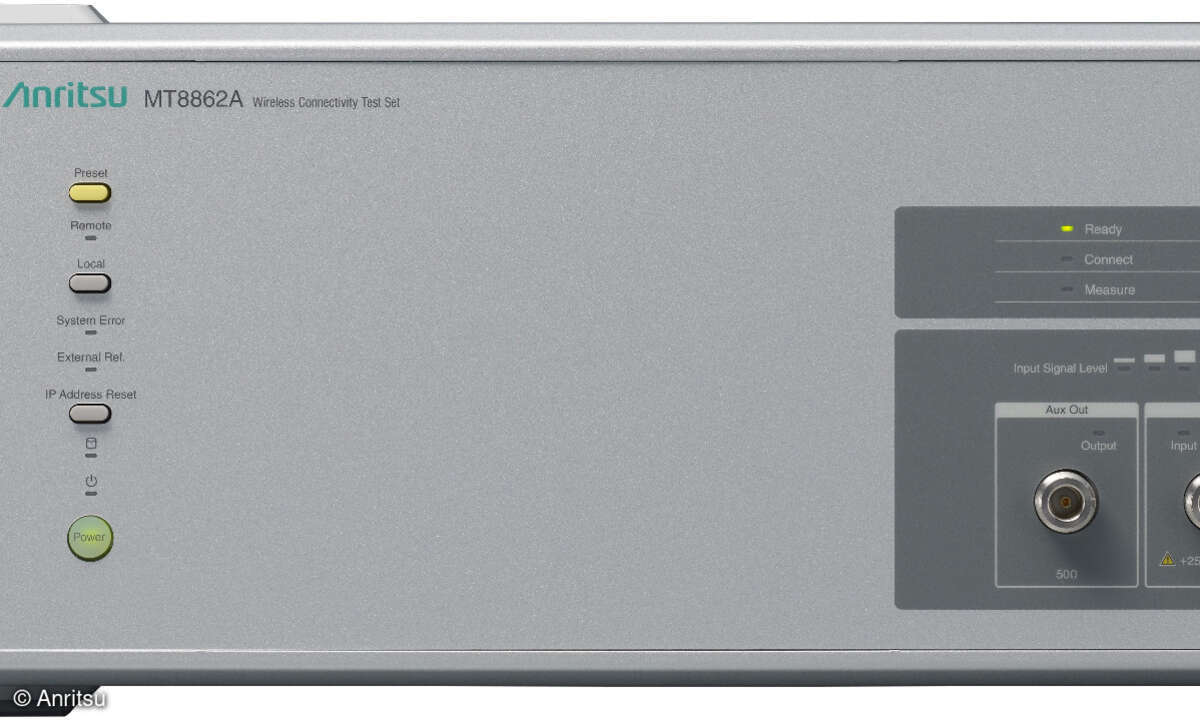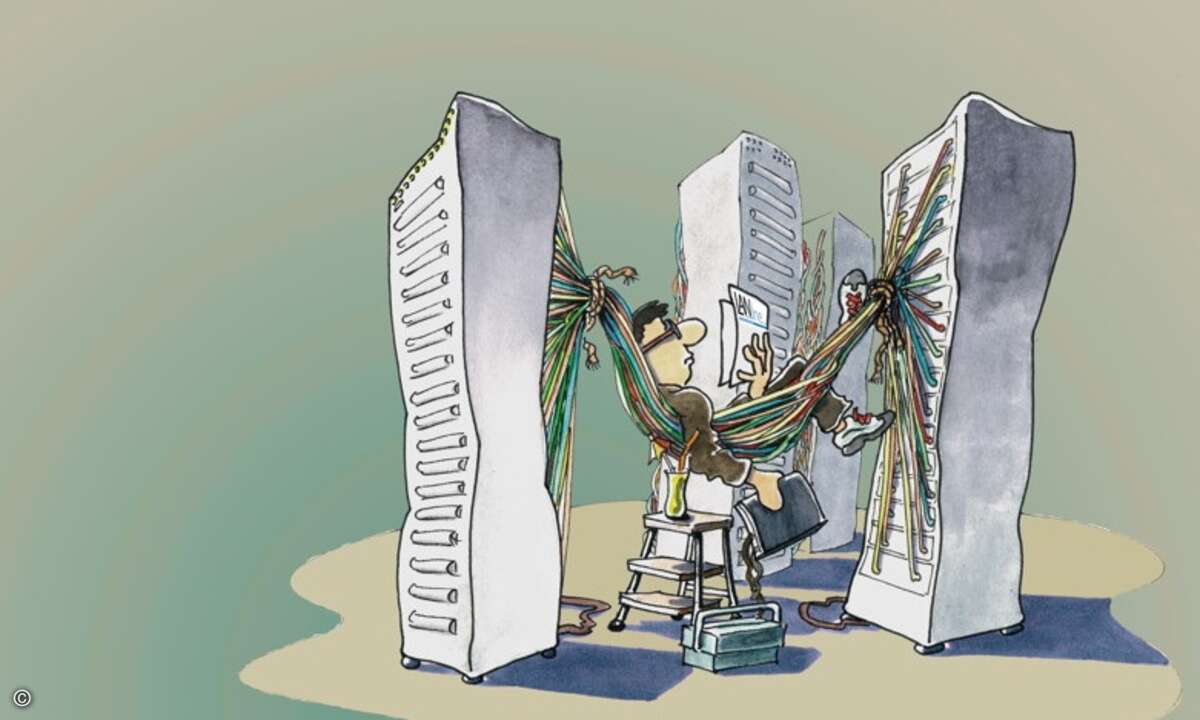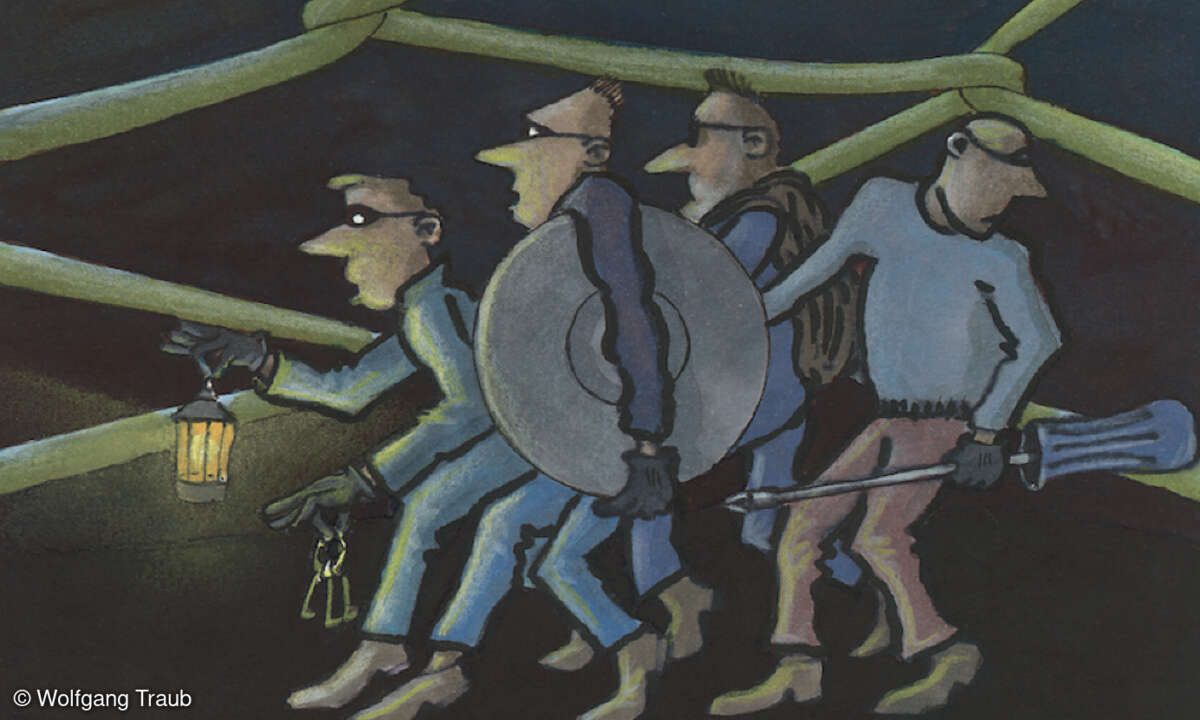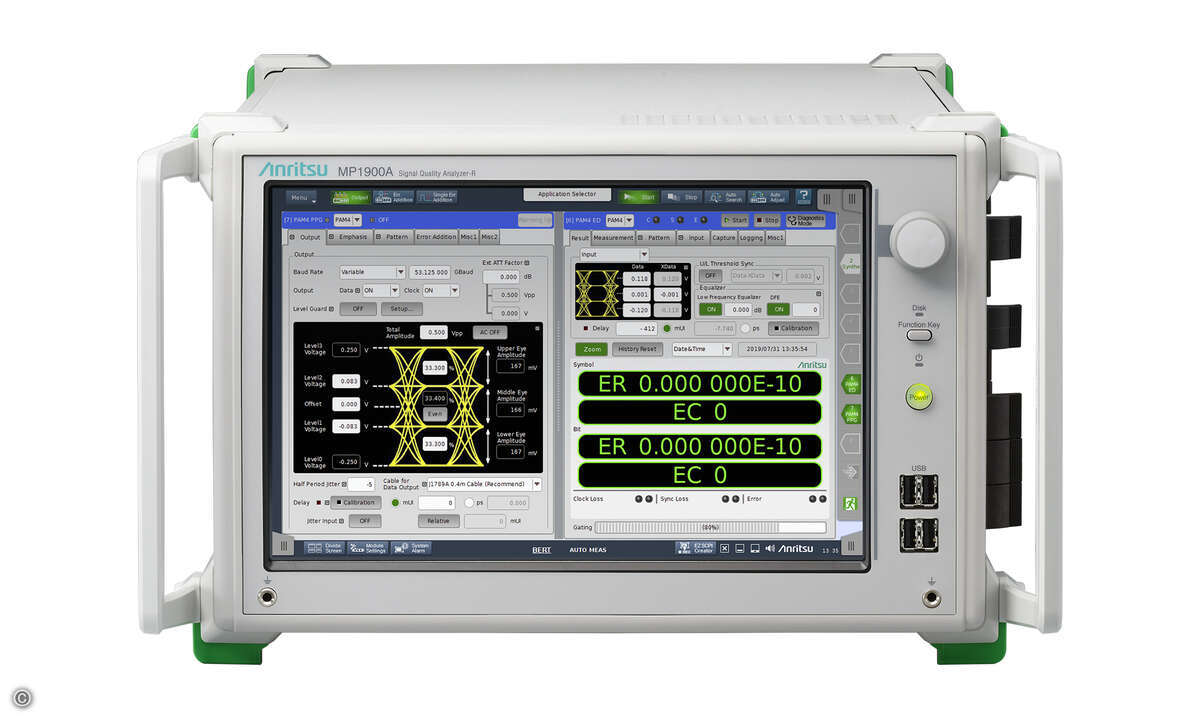Tests – mehr als notwendig
Die Softwareinstallationen in den Unternehmen werden immer komplexer. Dazu kommt, dass die Geschäftsprozesse, die von der Software unterstützt werden, zunehmend geschäfts- und zeitkritischer ausfallen. Solchen Herausforderungen muss sich der Testmanager stellen, damit später im Betrieb alles nach Plan abläuft.

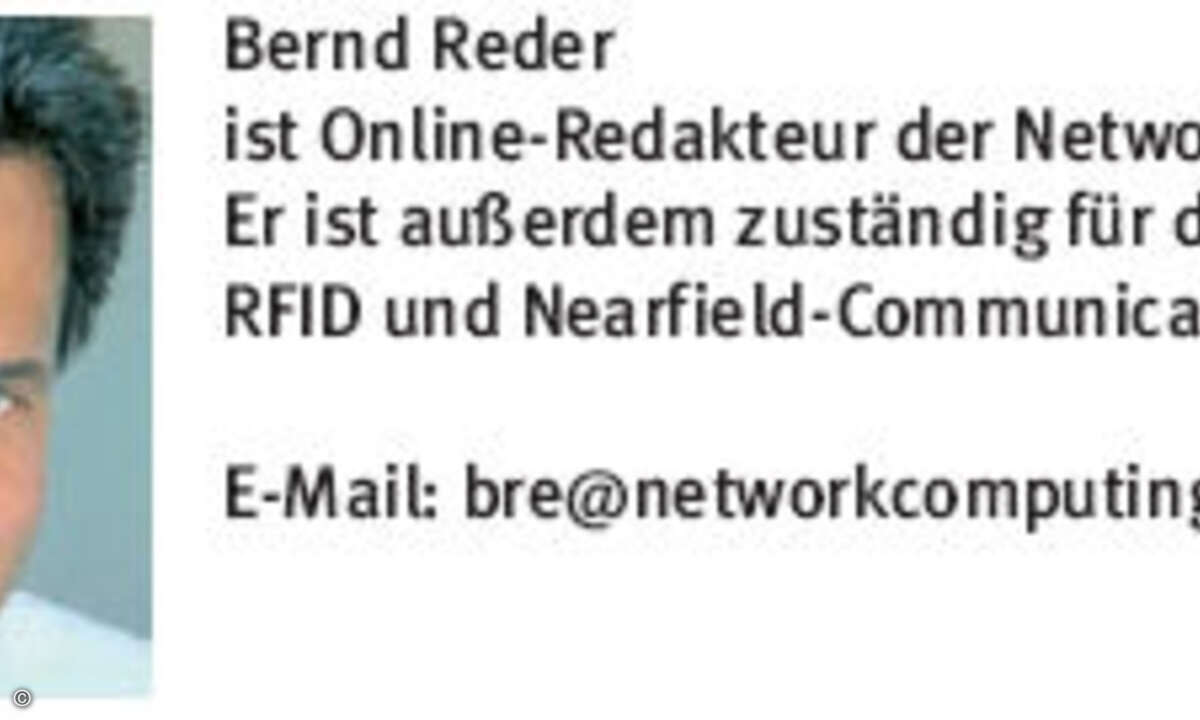
Wie wird die Intensität von Tests bestimmt? Welche Testfälle sollen absolviert werden? Wie lässt sich die Frage beantworten, ob ausreichend getestet wurde? Ist das Management an reinen Fehlerstatistiken interessiert oder am unternehmerischen Risiko, das gegebenenfalls noch im auszurollenden System steckt? Mit solchen Fragen sind Testmanager heute mehr denn je konfrontiert. Und je höher das (Produkt-) Risiko ausfällt, desto intensiver sollte im eigenen Geschäftsinteresse getestet werden. Dafür müssen in den Phasen Testvorbereitung und -auswertung die richtigen Weichen gestellt werden.
Gut vorbereiten
In der Planungsphase sollten, neben der Zeit- und Ressourcenplanung, unter anderem die Teststrategie und Test-Ende-Kriterien festlegt werden. Ausschlaggebend für den Umfang der Softwareprüfungen ist das Risikopotenzial des Testobjekts. Je höher dieses Potenzial ausfällt, desto intensiver müssen die einzelnen Softwareteile Testfällen und -szenarien unterworfen werden. Das setzt voraus, dass sich der Testmanager des Risikopotenzials der einzelnen Programme und Programmteile voll bewusst ist und dieses Wissen einsetzt. Nur dann kann er unter anderem Testfall-Entwurfsmethoden angemessen auswählen und kombinieren. Rangieren die zu testenden Objekte – für sich allein stehend oder in Kombination mit anderen Objekten – unter der Kategorie »kritisch«, sollten formale Entwurfsmethoden wie beispielsweise die Äquivalenzklassenanalyse oder Grenzwertmethode mit Expertentests kombiniert werden. Der Lohn: eine weitgehende Testabdeckung selbst im äußerst kritischen Softwarebereich, dadurch deutlich weniger Fehlfunktionen und wirtschaftliche Schäden.
Die wichtigsten Testfälle kommen im Rahmen der Testdurchführung zuerst. Steht für die Tests nicht ausreichend Zeit bereit, kann durch diese Strategie sichergestellt werden, dass zumindest die wichtigsten Systemfunktionen hinreichend geprüft wurden. Idealerweise kann die Priorisierung der Testfälle und -szenarien direkt aus dem Risikopotenzial der einzelnen Testobjekte abgeleitet werden. In der Realität fehlen aber oft dokumentierte Anforderungen und/oder Risikobetrachtungen. In diesem Fall kommt der Testmanager nicht daran vorbei, die einzelnen Testfälle zu priorisieren. Diese Gewichtung ist unabdingbar, um bei Bedarf steuernd in Testläufe eingreifen zu können. Testverzüge, die einen planerischen, steuernden Eingriff notwendig machen, können auch durch dynamische und Testteam-fremde Einflussfaktoren entstehen. Dadurch kann unter anderem die Anzahl der notwendigen Re-Testzyklen höher als ursprünglich erwartet ausfallen. Oder die Fehlerbehebungen nehmen mehr Zeit in Anspruch als gedacht. In solchen
Situationen muss der Testmanager, sofern sich Roll-outs nicht verschieben lassen, fundiert auf Basis objektiv messbarer Kriterien zu Risikopotenzialen entscheiden, welche Tests fortgesetzt werden und auf welche verzichtet werden kann. Für den Fall, dass Softwaretests extern realisiert werden sollen und nur die fachliche Abnahme im Unternehmen verbleiben soll, helfen so genannte Smoke-Tests weiter. Die Reifeprüfung des Systems erfolgt dabei über einen Teilausschnitt aller Testfälle, der zu Beginn der Abnahme geprüft wird. Umso wichtiger ist es, eine auf Risiko basierende Auswahl von Testobjekten, -fällen und -szenarien zu treffen. Denn verläuft der Smoke-Test des Teilausschnitts negativ, führt das zur Zurückweisung des kompletten Testobjekts, und seine Überprüfung muss erneut aufgesetzt werden.
Auswerten
Bei weiser Definition der Test-Ende-Kriterien fällt es dem Verantwortlichen leichter, das Testende ohne große Betriebsrisiken für das Unternehmen zu bestimmen. Diese Entscheidung muss mit einer eingehenden Bewertung von Testfortschritt, der Testergebnisse und des verbleibenden Restrisikos einhergehen. Wirtschaftliche und/oder unternehmenspolitische Einflüsse sind in diesem Kontext nicht zu unterschätzen. Für den Testmanager heißt das, am Ende auszuwerten, ob sich Testaufwände und -ergebnisse bei tolerierbaren Risiken die Waage halten.