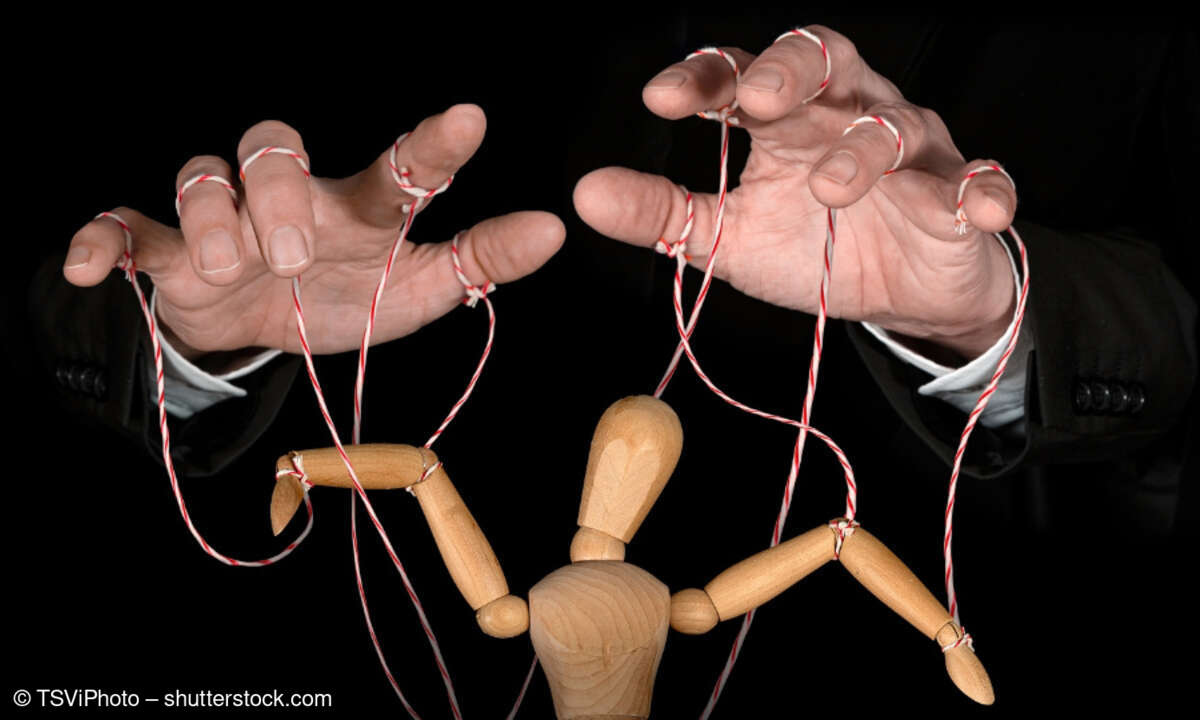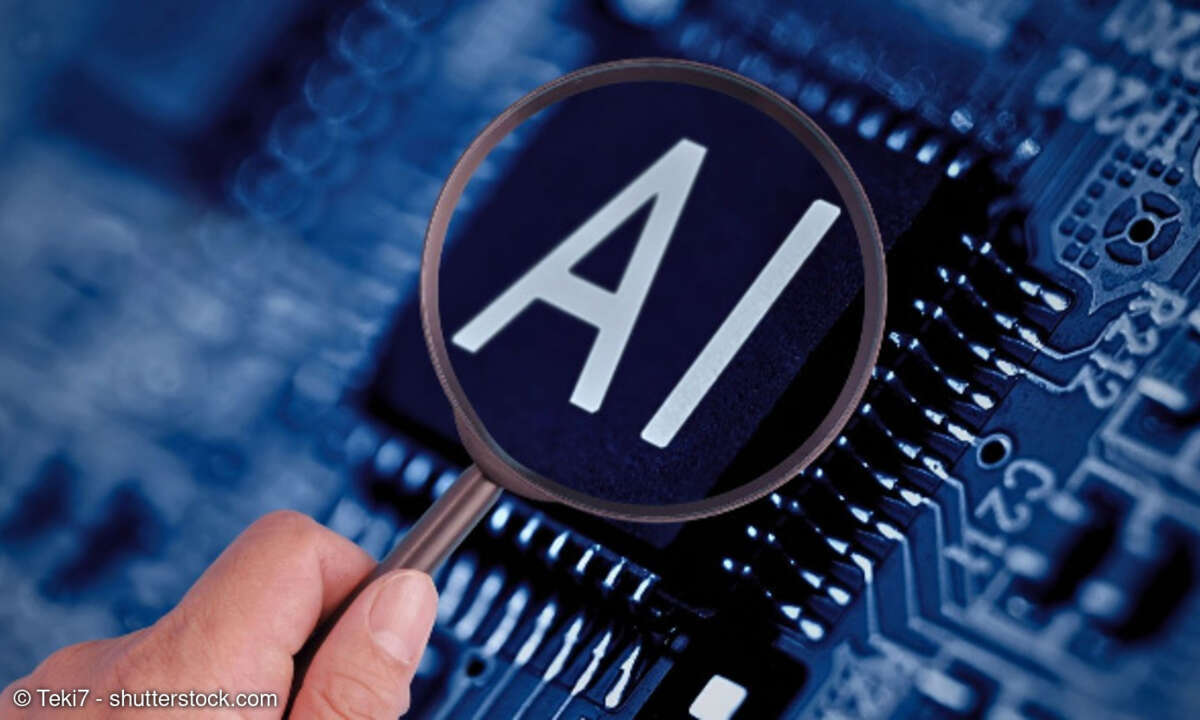Verschenkter Beratungserfolg
Beratungsleistungen sollen die Effizienz der IT und darüber die der Geschäftsabläufe steigern. Die externen Leistungen und vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse passen aber nicht immer zusammen. Gründe dafür, dass beides auseinanderdriften kann, gibt es viele, wie eine Studie, durchgeführt in 100 englischen Unternehmen, aufzeigt. Die Ergebnisse dürften für Deutschland ähnlich ausfallen.

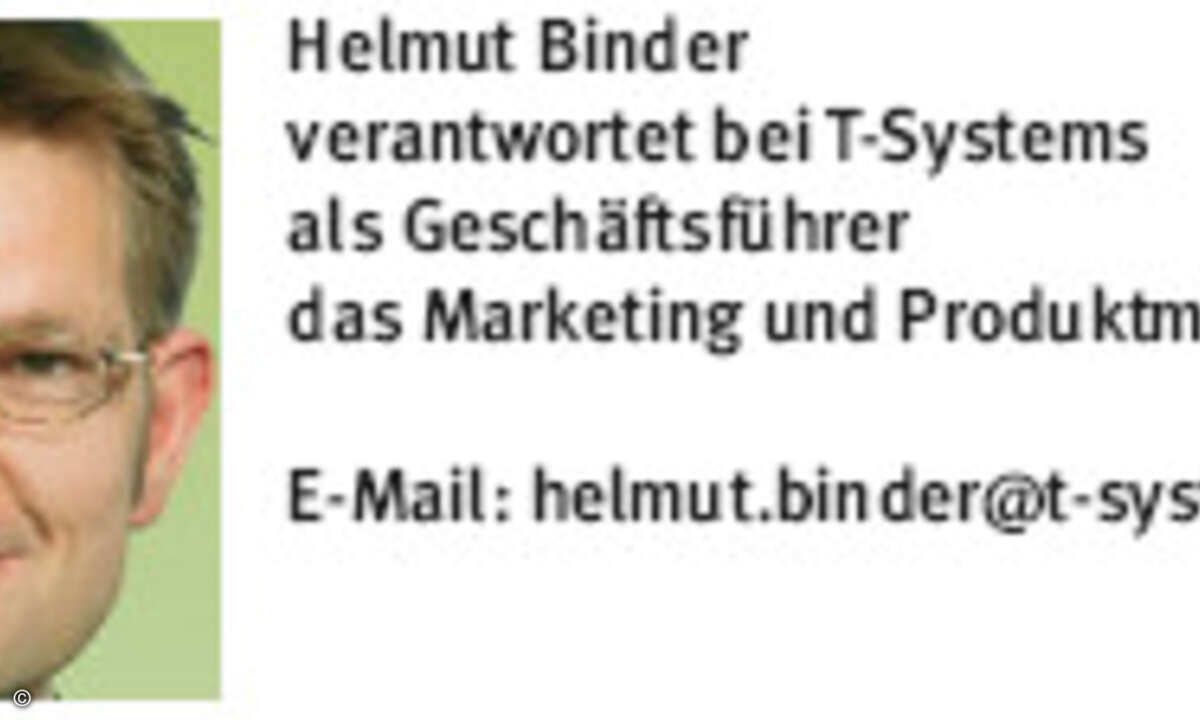
Für die von Logica CMG in Auftrag gegebene Untersuchung wurden Einkäufer von Beratungsdienstleistungen auf Geschäftsführer- und Vorstandsebene befragt. Die Studie ergab, dass zahlreiche Unternehmen weiterhin Probleme bei der Auswahl, dem Management und der Erfolgsbetrachtung externer Beratungsleistungen haben. Das beginnt damit, dass Wahrnehmung und Realität oft weit auseinander liegen. So qualifizierten sich 60 Prozent der befragten Unternehmen als »proaktiv und strategisch« in ihrer Beratungsentscheidung, obwohl die detaillierte Auswertung der Fragebögen mehrheitlich ein rein taktisches und kurzfristig angelegtes Einkaufsverhalten belegte. Lediglich 40 Prozent der Befragten dürfen nach der Auswertung als vorbildliche, strategische Nutzer externer Beratungsleistungen gelten.
Die tiefer gehende Analyse anhand eines Consultancy-Quadranten deckt die Schwachpunkte und Beziehungen zwischen der strategischen Vision des Unternehmens beim Einkauf und dem tatsächlichen Einkaufsverhalten auf. Sie förderte neben den vorbildlichen »Wise Owls« drei weitere Typen zutage. Auf den Typus »Rising Star« entfielen 10 Prozent. Er schöpft den Einkauf von Beratungsleistungen nicht voll aus, setzt aber die externen Consultants für das Unternehmen mit hohem Nutzen verbunden strategisch ein. Die so genannten Aspirants (23 Prozent) verhalten sich beim Einkauf reaktiv. Sie nutzen externe Berater vor allem für kurzfristige, rein taktische Aktivitäten, beispielsweise um schnell auf Markt- oder rechtliche Veränderungen zu reagieren. Unternehmen des Typus »Mid-life Crises« (27 Prozent) haben zwar den Einkauf von Consultants voll entwickelt. Sie handeln jedoch wie der Typus »Aspirants« mehrheitlich reaktiv, ohne für den Beratungseinsatz strategische Programme mit mittel- oder langfristiger Ausrichtung und Wirkung zu entwickeln.
Zudem förderte die Studie zu Tage, dass die meisten Befragten Bedenken haben, große Beratungshäuser zu beauftragen. Der Grund: Sie fürchten, die Berater würden sich nicht vollständig auf die Anforderungen des Unternehmens konzentrieren. Außerdem erwarten 61 Prozent der Unternehmen, dass sie in diesem Fall höhere Beratungshonorare zahlen müssten. Für die Hälfte der Befragten sind zu hohe Beratungskosten ein stichhaltiges Argument, im schlimmsten Fall solche Leistungen erst gar nicht in Anspruch zu nehmen. Der gleiche Prozentsatz fürchtet, dass Fehler und Probleme im Verlauf des Projekts über die Berater nach draußen dringen könnten.
Und wie steht es laut der Studie um die Erfolgskontrolle? 10 Prozent der Unternehmen kontrollieren und messen den Erfolg der Beratungsleistungen generell nicht. Lediglich ein Drittel der Unternehmen kontrolliert und misst immer. Ein Viertel der Unternehmen gleicht nicht einmal die Ergebnisse der Beratungsleistungen mit den strategischen Unternehmenszielen ab. Der gleiche Prozentsatz hält wenig von einer Prüfung, ob die Beratungsleistungen fristgerecht erbracht wurden. Immerhin stimmt, ob geprüft oder ungeprüft, laut der Befragung die Vertrauensbasis zwischen dem Unternehmen und den externen Beratern. 72 Prozent der Teilnehmer bestätigten dies. Für ihre Fähigkeiten, sich auf die Aufgabenstellung zu konzentrieren und das Vorhaben durchzuziehen, vergaben die 100 Unternehmensvertreter im Schnitt 4,5 von 5 möglichen Punkten.
Was bleibt, ist ein Gesamtergebnis, das ausweist, dass viele Unternehmen durch eine mangelhafte Einstellung beginnend beim Einkauf bis zu einer unzureichenden Erfolgskontrolle einen höheren Beratungsnutzen für das Geschäft buchstäblich aufs Spiel setzen. Aber auch auf Seiten zahlreicher Beratungsdienstleister besteht Nachholbedarf. Sie müssen ihre Arbeitsmethoden flexibler gestalten, um dem speziellen Bedarf ihrer Kunden auch in Krisensituationen noch näher zu kommen. Das Zusatzgeschäft, dass Beratungshäuser auf diese Weise generieren könnten, wird in England auf jährlich 4,5 Milliarden Euro beziffert. Noch größer dürfte die Beratungslücke in Deutschland ausfallen.