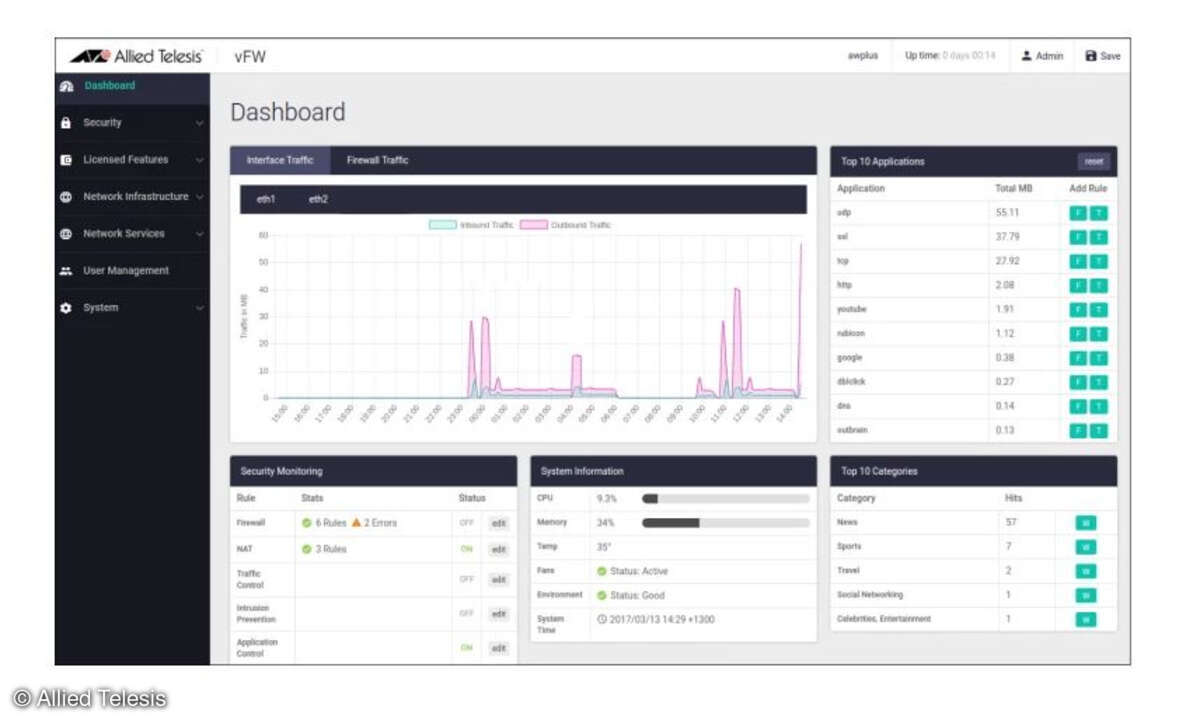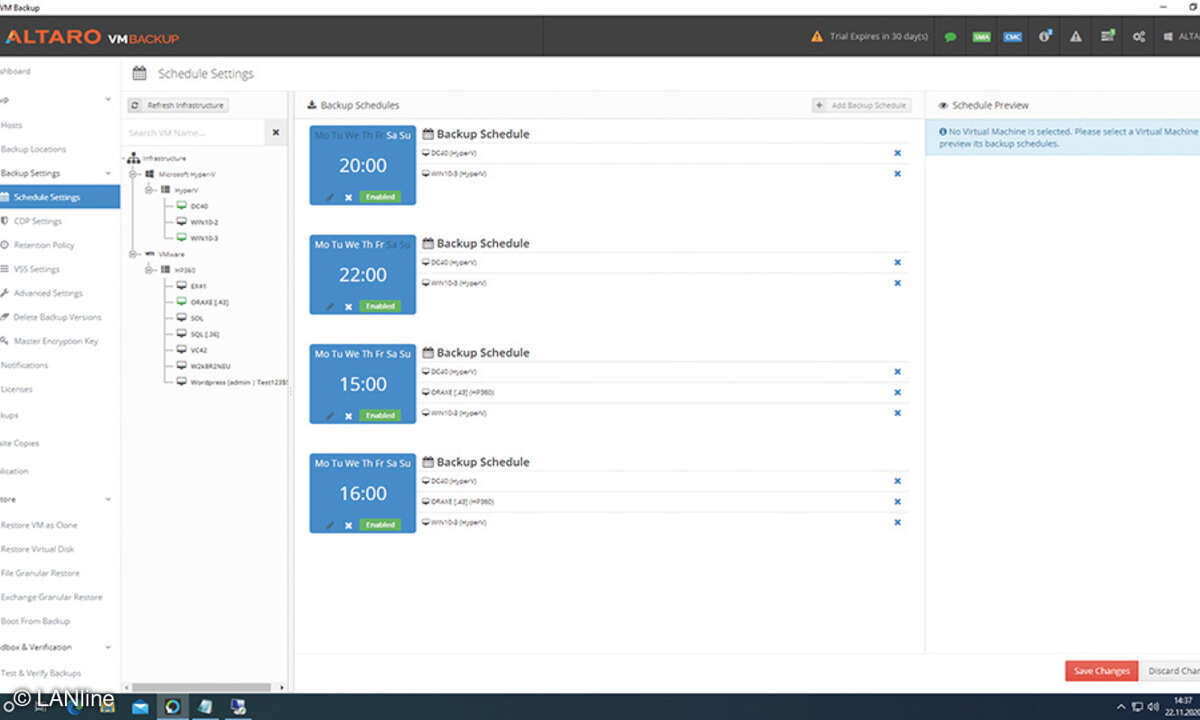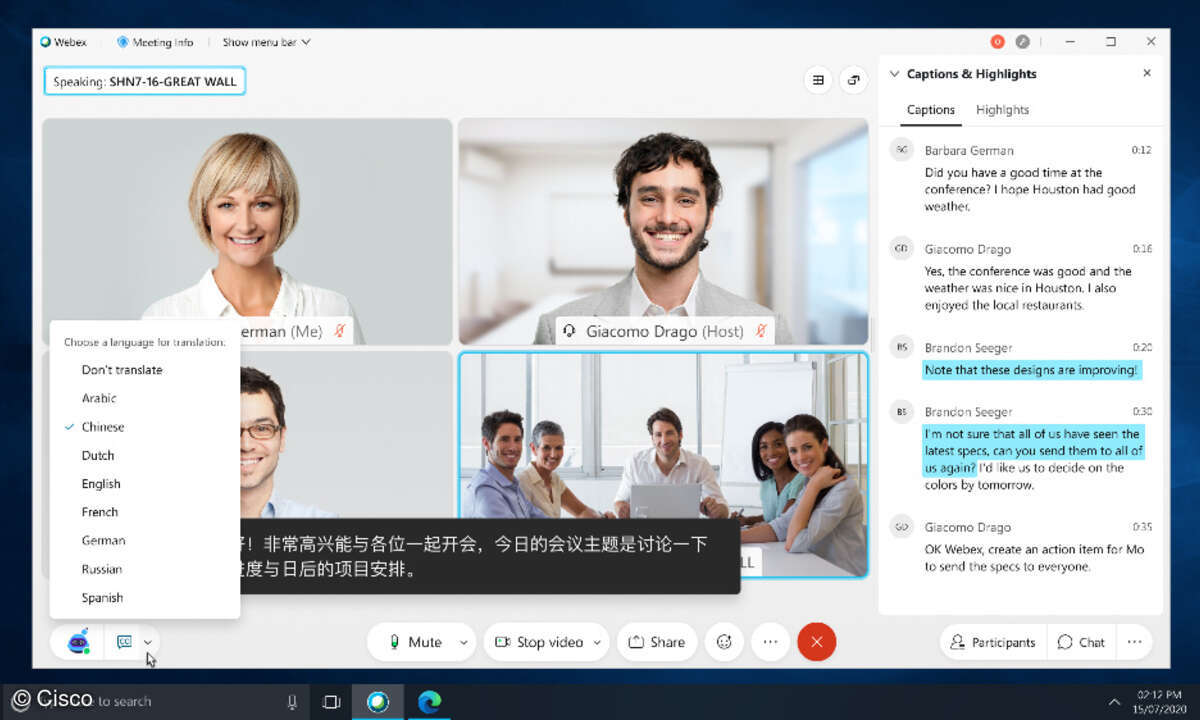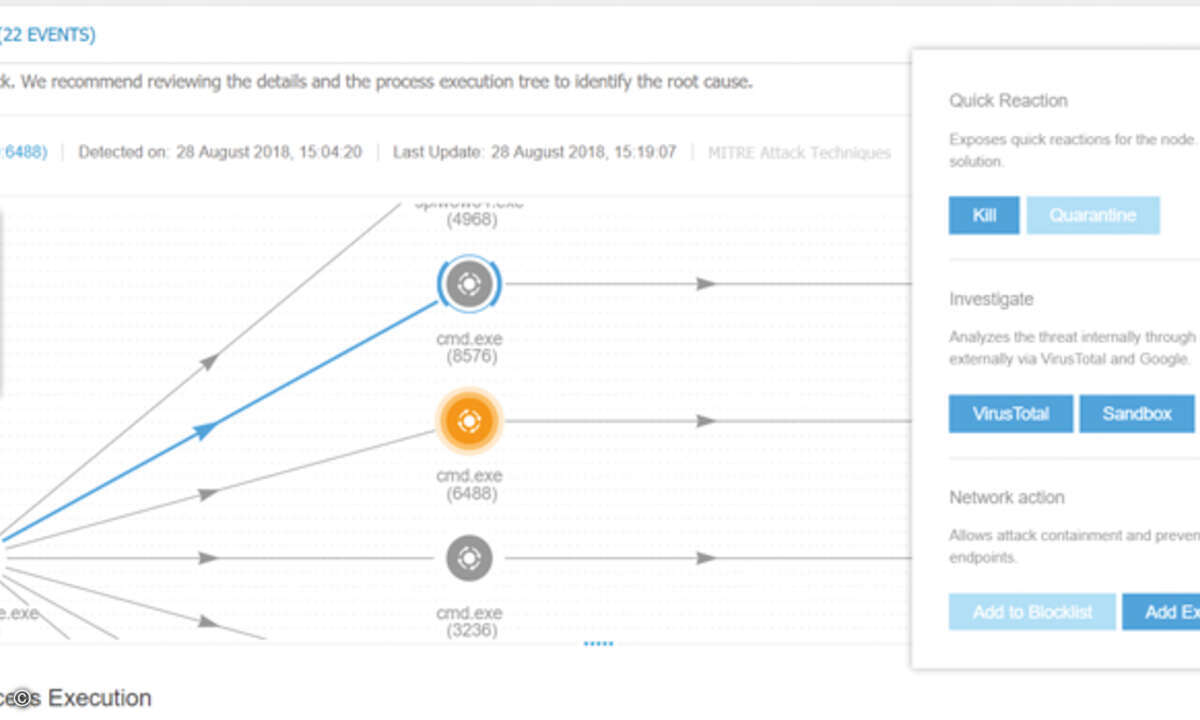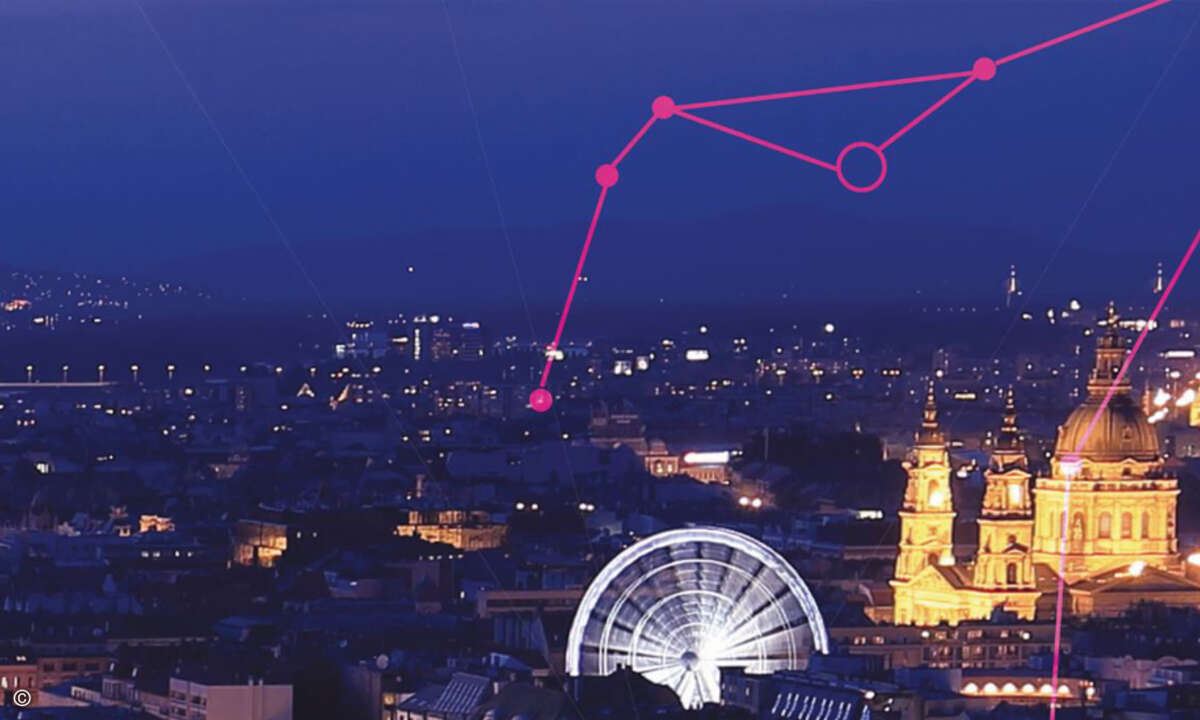Virtuelle Rechner
Virtuelle Rechner. Virtualisierung verbessert die Hardware-Auslastung und erleichtert die bedarfsgerechte Bereitstellung, die sich auf Betriebssysteme bezieht, von IT-Ressourcen. Die Verwaltung wird jedoch komplizierter.
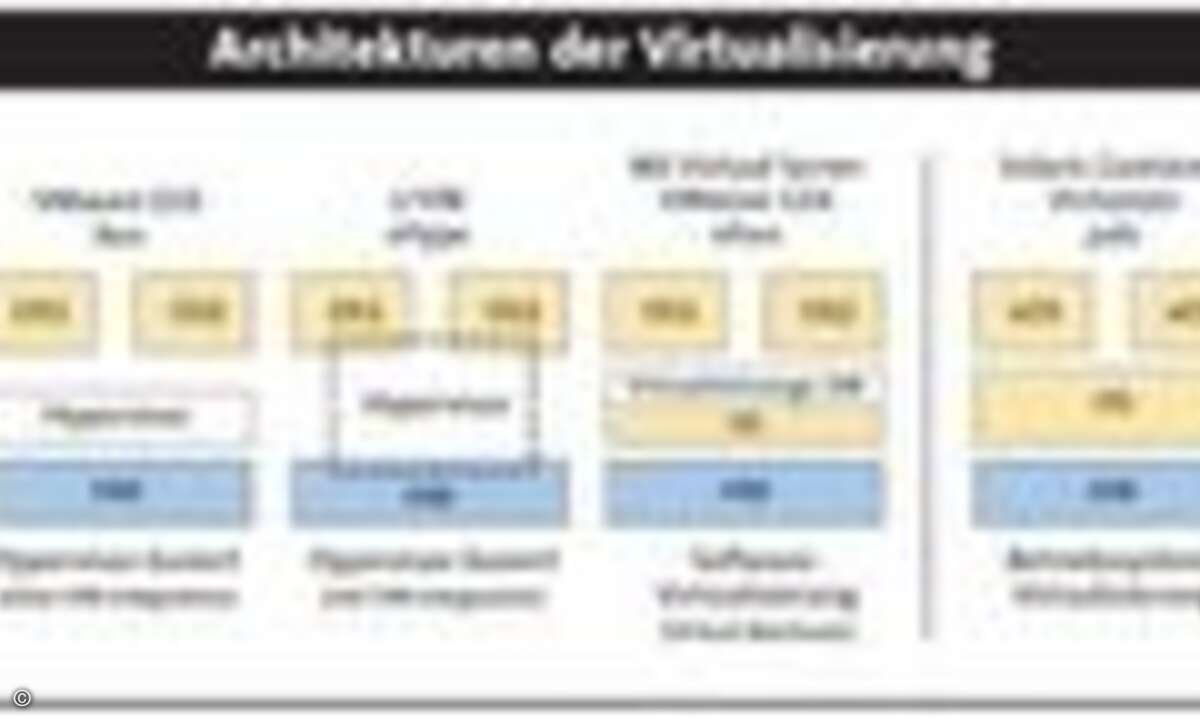
- Virtuelle Rechner
- Virtuelle Rechner (Fortsetzung)
Virtuelle Rechner
In der IT wird heute auf allen Ebenen virtualisiert: von Speicher- und Datennetzwerken auf Basis von Virtual Private Network (VPN) oder Virtual LAN (VLAN) über Anwendungen der Java Virtual Machine bis hin zur Virtualisierung von Büroprogrammen. Die Marktforschungsfirma Experton Group attestiert der Virtualisierung hohen Nutzen, aber auch beträchtlichen Aufwand. Deren Vorstand Andreas Zilch sieht als Treiber für das wachsende Interesse an Virtualisierungstechnologien die Notwendigkeit zur Konsolidierung der Systeme in den Rechenzentren. »Nicht zuletzt durch die Hinwendung zu Blade-Systemen in Verbindung mit Zunahmen bei Stromverbrauch und Hitzeentwicklung«, führt der Marktkenner aus, »suchen die Unternehmen nach Möglichkeiten, beides zu senken.«
Neu sind die Konzepte der Virtualisierung nicht. Die heute als Legacy bezeichneten Software-Systeme VMS, VTAM, VM und MVS tragen ein V in ihrem Namen und implementierten bereits vor Jahrzehnten Virtualisierungskonzepte. Der Großteil der Virtualisierung setzt heute freilich auf x86-Hardware auf. Daneben liefert auch Sun Implementierungen, und IBM hat diese Technik in den aktuellen Betriebssystemen der Server-Reihe i5 ebenfalls neu aufgelegt. Diese ermöglichen unter einem als Logical Partition (LPAR) bezeichneten Konstrukt die parallele Ausführung von bis zu zehn Gastbetriebssystemen auf einer physischen Hardware. Auch als Appliances, etwa von Levanta, sind Virtualisierungslösungen verfügbar. Intel (Projekt Vanderpool) und AMD (Projekt Pacifica) arbeiten an der Implementierung von Funktionen, um die Virtualisierung direkt durch die CPU zu unterstützen.
Grosses Revival
Wenngleich die Idee nicht neu ist, so ist es doch die Breite, in der heute virtualisiert wird. In der sogenannten Hardware-Virtualisierung wird ein nahezu vollständiger x86-Rechner nachgebildet. Darauf aufsetzend kann dann jegliches Betriebssystem, es wird dann als Gastsystem bezeichnet, samt Applikationen zum Einsatz kommen, das eben auf einem Rechner solcher Bauart lauffähig ist.
Hardware- nahe Virtualisierung
Zu den bekanntesten Vertretern dieser Gruppe gehören Produkte von VMware (Workstation, VMware Server und ESX Server) sowie Microsofts Virtual Server und Virtual PC. Die Unterschiede liegen in der Funktionsvielfalt, dem Leistungsvermögen und dem Unterbau. Die beiden Microsoft-Produkte verwenden Betriebssysteme aus der eigenen Reihe, gleiches gilt für die VMware Workstation, die ebenso auf Windows aufsetzt. Der VMware Server hingegen kann auch mit Linux als Grundlage operieren. Und beim ESX Server schließlich baut VMware auf einem eigenen Kernel auf.
Die komplette Nachbildung eines Rechners liefert vielfältige Möglichkeiten, ist aber auch komplex und ressourcenhungrig. Einschränkungen liegen darin, dass eben nur ein Standardrechner emuliert wird. Und dazu gehören meist nicht die ausgefallenen Besonderheiten, wie etwa Dongles, USB-Anschlüsse, Fax- oder Sound-Karten.
In der sogenannten Paravirtualisierung erfolgt durch einen Hypervisor, der direkt auf der Hardware aufsetzt, die Trennung der Prozesse und des Speichers. Die Gastbetriebssysteme wiederum setzten auf den Hypervisor auf, der insofern ein Stück Software ist, das die virtuellen Maschinen versorgt und kontrolliert. Damit entfallen die Notwendigkeit und auch die Last des Host-Betriebsystems, denn ein Hypervisor ist klein und kompakt. Die Technik der Paravirtualisierung kennt derzeit zwei Ausprägungen: Eine, bei der das Gastsystem unverändert auf dem Hypervisor zum Einsatz kommt, dies ist bei dem ESX Server von VMware der Fall, und jener, die ein angepasstes Betriebsystem benötigt, wie es derzeit bei der Open-Source-Software Xen, getrieben von der Firma Xen Source, angewandt wird. Die Gäste nutzen dann einen Teil eines angepassten Host-Betriebssystems und sind an dieses gebunden. Der Einsatz von Linux-Gästen unter Windows-Hosts und umgekehrt ist dabei nicht möglich. Neuerdings erfährt Xen nicht nur von den Linux-Protagonisten Novell und Red Hat Unterstützung, sondern auch von Microsoft. Der Betriebssystem-Riese will Windows künftig außerdem mit einem Hypervisor ausstatten und so auch die Verfügbarkeit von Treibern verbessern.