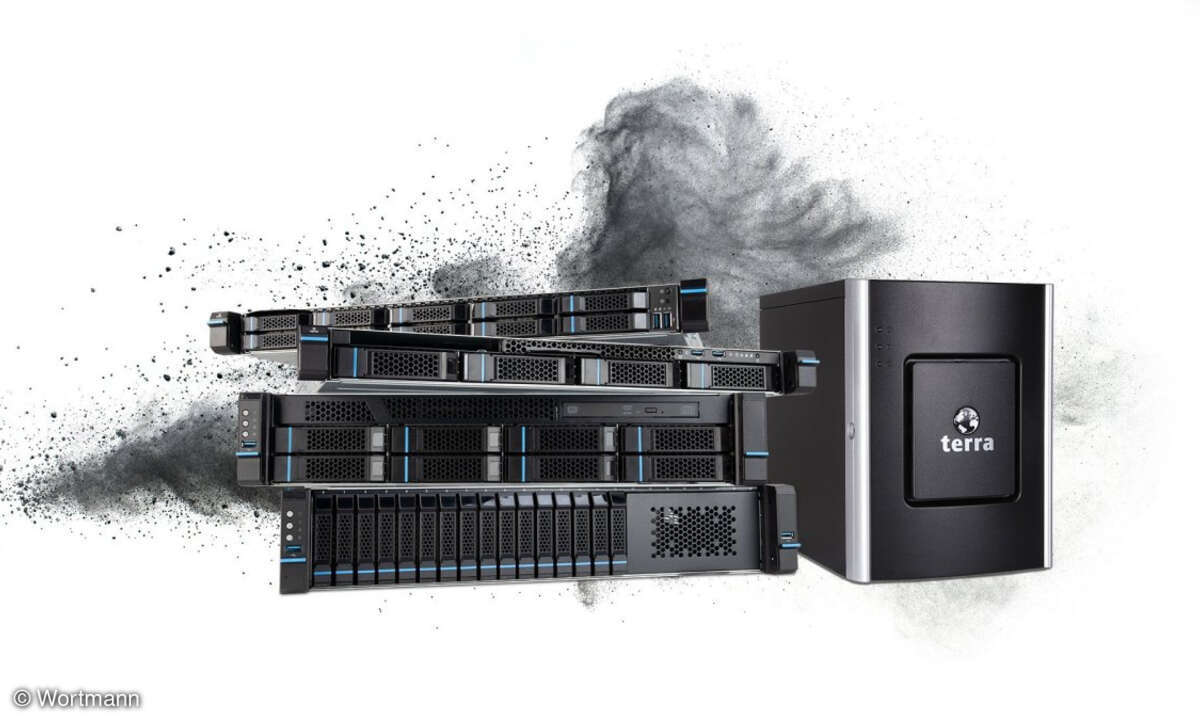Zwillinge statt Paare
Dual-Core-Entry-Level-Server – Anstatt höherer Taktraten beschleunigen doppelte CPU-Kerne die Performance neuer Server. Wer früher Dual-CPU-Systeme benötigte, kann die Arbeit künftig vom Ein-Prozessorsystem mit zwei Kernen erledigen lassen.
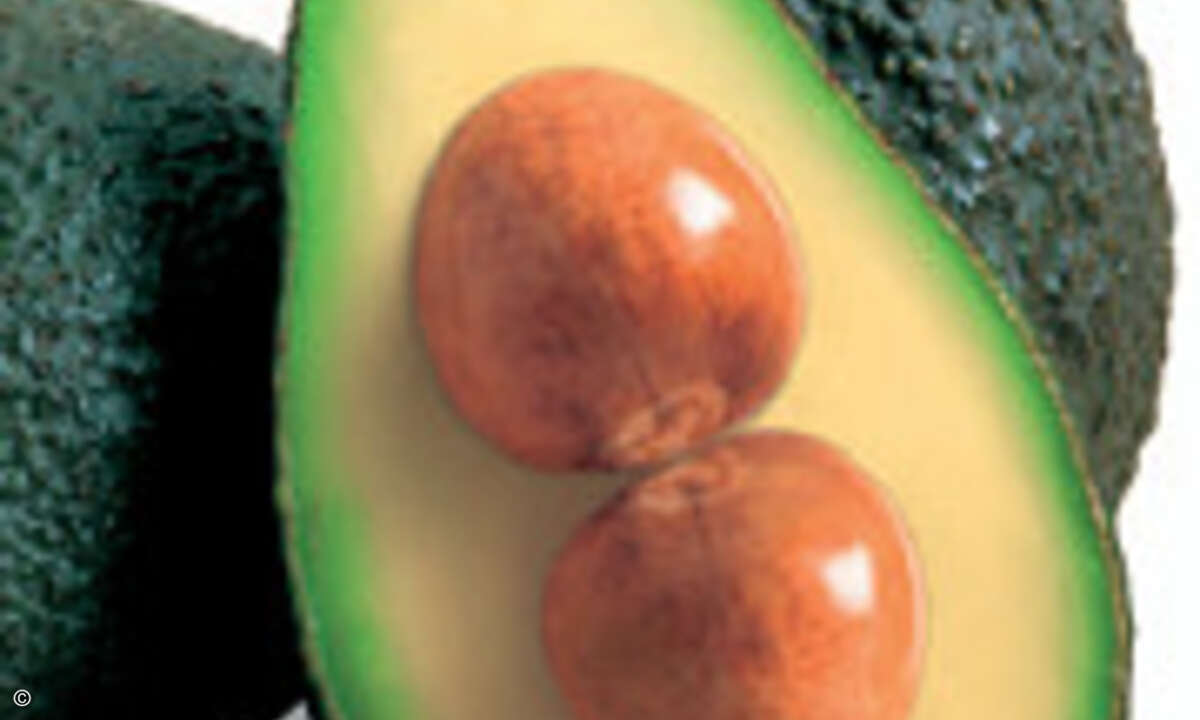





Dem Trend der Risc-Systeme folgend, setzen AMD und Intel in neuen CPU-Generationen Doppelkerne ein. Damit erreichen moderne Uni-Prozessormaschinen plötzlich Leistungen, für die bislang Zwei-Wege-Systeme nötig waren. Network Computing hat drei dieser noch jungen Rechner einem ersten Test unterzogen und deren Leistungsfähigkeit sowie Kompatibilität zu bestehenden Betriebssystemen und Applikationen geprüft. Dem stellten sich ein Poweredge 850 von Dell, ein X2100 von Sun sowie ein Altos 5350 von Acer.
Dells flinke Flunder
In ein flaches 1-HE-Rackgehäuse packt Dell seinen Poweredge 850. Angetrieben wird der Server wahlweise von einem regulärem Pentium-4-Prozessor oder dessen Nachfolger Pentium-D mit 64-Bit-EMT und zwei CPU-Kernen. Letzterer setzt die Leitungsfähigkeit des Single-CPU-Rechners auf das Niveau einer Doppelprozessormaschine. Das Chipset adressiert maximal 8 GByte Arbeitsspeicher in 4-Dimm-Sockeln über zwei DDR-2-Kanäle, die mit 533 oder 667 MHz arbeiten. Damit weist die günstige Serverfluder mehr Rechen- und I/O-Performance auf als die meisten bisher verfügbaren Dual-Xeon-Maschinen. Auf Wunsch erhält der Kunde eine SCSI- oder S-ATA-Ausstattung.
Maximal zwei Platten nimmt das Gehäuse auf, lässt dabei jedoch Hot-Swap-Einschübe vermissen. Den begrenzten Platz im flachen Rackgehäuse nutzt Dell äußerst geschickt aus. Die rechte Rechnerhälfte belegen das Netzteil sowie das dicht gedrängte Motherboard. Zwischen Gehäusefront mit Platten sowie DVD-Laufwerk sitzen zwei flache Tangentiallüfter, welche mit recht geringer Lautstärke den Prozessor unter einem massiven Kupferkühlkörper auf Temperatur halten. Auf der linken Seite bleibt so viel Platz übrig, dass der Poweredge 850 zwei Erweiterungskarten – eine PCI-X, eine PCI-e – mit regulärer Bauhöhe aufnehmen kann. An der Vorder- und Rückseite führt Dell sowohl zwei USB- als auch jeweils einen Monitor-Anschluss heraus. Das Board integriert zwei 1-GBit/s-Ethernet-Adapter.
Für den Test entsandte Dell einen 850er mit einer 3 GHz schnellen Pentium-D-CPU, 2 GByte Arbeitsspeicher und zwei 160-Gbyte-S-ATA-Platten.
Im Lieferumfang findet sich eine Management-CD, von der sich der Server starten lässt. Dells Management-Utility soll den Administrator bei der Systeminstallation unterstützen und nötige Treiber vorinstallieren. Wer solche Tools verschmäht, kann natürlich direkt mit der Installations-CD des jeweiligen Betriebssystems ans Werk gehen. Allerdings funktioniert das derzeit nur mit den gängigen Windows-2003-Betriebssystemen, sowohl in der 32- als auch der 64-Bit-Variante. Probleme ergeben sich jedoch mit Linux. Den meisten aktuellen Distributionen fehlt der S-ATA-Treiber für das neue Intel-Chipset E7230 und ein passender Grafiktreiber für die Xgi-Grafikkarte.
Über das Mangement-Utility lässt sich zumindest der Redhat-Enterprise-Server einrichten. Eine geskriptete Installation fügt die nötigen Treiber hinzu. Jedoch empfindet ein Linux-Kenner diese geführte Installation als lästig und langwierig. Die Partitionierung lässt dem Anwender nicht viel Spielraum, und vor der eigentlichen Installation will das
Dell-Utility erst einmal alle fünf CDs der Redhat-Enterprise-4-Distribution auf die Platte kopieren.
Für den Test setzte Network Computing in den Real-World Labs Poing hauptsächlich den Windows-2003-Server-Standard-x64-Edition ein. Hier fehlen nach der Erstinstallation des Systems – ohne Dell-Tool – zunächst ein paar Treiber, allen voran für die GBit/s-Ethernet-Interfaces. Diese lassen sich jedoch im Handumdrehen von der Dell-CD nachinstallieren. Dort findet sich ebenfalls ein kleines Systems-Management-Tool mit einer Browser-GUI. Dieses zeigt Details zur Hard- und Softwarekonfiguration der Maschine und macht den Administrator auf Probleme aufmerksam. Die automatische Installation von Windows über das Dell-Setup-Utility fügt alle nötigen Treiber in die Installationsprozedur ein.
Im Test erbringt der Pentium-D rund fünf bis zehn Prozent langsamere Benchmark-Ergebnisse als ein Dual-Core-Opteron 270. Dafür kann das duale DDR-2-Interface mit einer Durchsatzrate von 5 GByte/s gegenüber 4,6 Gbyte/s auf Opteron-Systemen punkten.
Fazit: Der Poweredge 850 liefert eine sehr hohe Performance für einen kompakten Server seiner Klasse, jedoch hängt die Gesamtausstattung des Systems ein wenig schief. CPU- und I/O-Leistung lassen den Server aktuelle Dual-Xeon-Modelle übertreffen, dafür mangelt es dem 1-HE-System an Komponenten für die Betriebssicherheit. Ein Hardware-Raid für die S-ATA-Laufwerke erfordert einen externen PCI-X- oder PCI-e-Controller, Hot-Swap-Aufnahmen für die Platten fehlen, und es gibt nur ein Netzteil. Als Edge-Server für Infrastrukturdienste ist der 850 zu stark. Für einen Mail- oder Applikationsserver reicht die Power, doch fehlt es da an Ausfallsicherheit.
Windows auf Sun-Hardware
Ähnlich stellt sich das Bild bei Suns Entry-Level-Maschine X2100 dar. Je nach Kundenwunsch stattet Sun die Maschine mit einem Single- oder Dual-Core-Opteron der 1xx-Familie aus. Für den Test lieferte Sun ein System mit 4 GByte Arbeitsspeicher sowie einer 175er-Doppelkern-CPU mit 2,2-GHz Taktrate. Anders als in anderen Opteron-Serverdesigns von Sun kommt beim »Aquarius«-Server kein AMD-, sondern ein NForce-4-Ultra-Chipsatz von NVidia zum Einsatz. Zudem setzt Sun keinen regulären Opteron 1xx mit einem 940-Pin-Sockel ein. AMD offeriert auch einen günstigeren Opteron 1xx mit Sockel 939. Dieser verfügt nur über einen statt drei Hyper-Transport Kanäle und arbeitet zudem mit günstigeren, unregistered DDR-400-Speichermodulen.
Der Nforce-4-Pro enthält bereits ein 1-GBit/s-Ethernet-Interface, zwei S-ATA-Kanäle mit Raid-Funktion und ausreichend USB-Schnittstellen. Als zweiten NIC bindet das Sun-System einen Broadcom-Chip über einen internen PCI-e-1x-Link an. Für eine Erweiterungskarte stellt der Rechner einen PCI-e-8x-Slot bereit, reine PCI-Geräte gibt es im X2100 außer dem integrierten AIT-Rage-128-Grafikchip nicht. Das Nvidia-Chipset übernimmt auch die Steuerung der insgesamt sechs Lüfter im X2100. Dabei reagiert die Temperatursteuerung sehr feinfühlig. Während einer Systeminstallation ändern die Ventilatoren andauernd ihre Drehzahl, je nachdem, wie die CPU gerade belastet wird. Läuft das System unter Vollast, erzeugen die Ventilatoren ein sehr lautes, unangenehm leierndes Laufgeräusch dank der permanenten Regelung.
Im Gegensatz zur Dell-Maschine funktioniert die Linux-Installation einer aktuellen Debian-Distribution auf dem Aquarius ohne jegliche Zwischenfälle. Linux bringt alle Treiber sowohl für beide NIC-Interfaces als auch die integrierten S-ATA-Schnittstellen und die ATI-Grafikkarte mit – ein besonderes Installationsprogramm entfällt. PS2-Schnittstellen für Tastatur und Maus fehlen, diese Geräte müssen USB oder einen passenden Umsetzer angebunden werden. Auch der Windows-2003-Server läuft in seiner 32- als auch 64-Bit-Variante auf dem X2100 ohne Schwierigkeiten, allerdings bringt das System selbst keine NIC-Treiber mit. Die lassen sich aber über die herstellereigenen Treiber von Nvidia und Broadcom nachinstallieren. Um die aktuellen Treiber zu bekommen, sollte der Administrator gleich zu den Webseiten von Nvidia und Broadcom aufbrechen. Auf Suns stellenweise chaotischer Website findet man zwar alles Mögliche zum Download, nur keine Windows-Treiber für den X2100. Zudem läuft natürlich Solaris 10 auf der Maschine – sonst wäre es wohl kein Sun-Server.
Auf grund des DDR-1-400-Speichers ist die Memory-Bandbreite des Aquarius leicht geringer als die des Poweredge 850, dafür schneidet die CPU spürbar besser ab.
Fazit: Auch dem X2100 fehlen wichtige Redundanzmodule wie duale Netzteile. Dafür setzt Sun zwei Hot-Swap-fähige S-ATA-Einschübe für die Laufwerke und den im Nforce-4 integrierten S-ATA-Raid-1-Controller ein. Im Gegensatz zum Dell-Rechner stellt sich die Sun-Hardware kompatibler dar, speziell bei der Installation von Linux. Gemeinsam mit dem ein wenig günstigeren Preis (bei vergleichbarer Ausstattung) und der höheren Performance gewinnt daher der X2100 den direkten Vergleich mit dem Hauptkonkurrenten Poweredge 850.
Skalierbares Design von Acer
Ein ganz anderes Bild vermittelt der Acer Altos 5350. Dieser Tower-Server arbeitet mit einem Dual-Opteron-Board und bietet Raum für bis zu acht interne Festplatten in Hot-Swap-Einschüben. Mit einem Rackmount-Kit lässt sich die Maschine auch als 5-HE-Server in einen 19-Zoll-Schrank bauen. Auf der Rückseite steht in der Grundausstattung nur ein Netzteil zur Verfügung. Doch kann der Anwender ein zweites kaufen und in einen dafür vorgesehenen Einschub nachrüsten, um eine redundante Stromversorgung zu erhalten.
Das Motherboard des Servers arbeitet mit den etablierten AMD-8131/8111-PCI-X und PCI-Bridges. Daher laufen alle aktuellen Linux- und Windows-Varianten sowohl in 32- als auch in 64-Bit-Versionen ohne externe Treiber auf dem Altos. Allerdings fehlen PCI-e-Steckplätze. Ein wenig mager scheint die NIC-Ausstattung. Der Rechner enthält nur eine Intel-1-GBit/s-Onboard-Karte – als Standard haben sich aber zwei Interfaces etabliert. Auf Wunsch rüstet Acer das System mit einer SCSI-Karte aus, die in einem besonderen Slot steckt. Der Adaptec-Controller arbeitet dabei wahlweise als normaler Dual-Channel-SCSI-Adapter oder als »Host-Raid-Controller« mit den Levels 1 und 0. Dieser Modus funktioniert als Gemisch zwischen Hard- und Software-Raid. Das Adaptec-Bios erzeugt das logische Raid-Device und kann auch die initiale Spiegelung erstellen, im laufenden Betrieb muss jedoch der Treiber die Raid-Daten erzeugen. Ohne Host-Raid funktioniert der Server mit den Windows eigenen Treibern, schaltet der Administrator das Feature jedoch ein, muss er einen Treiber von Adaptec installieren. Den liefert der Hersteller für 32/64-Bit-Windows-Systeme. Auch hier sollte der Administrator gleich zur Adaptec-Website surfen. Acer hält zwar passende Treiber auf dem eigenen FTP-Server vor, jedoch nicht für 64-Bit-Windows. Der in Linux integrierte Adaptec-Treiber untergräbt leider das Host-Raid. Hier erkennt das System beide SCSI-Busse und die dort angeschlossenen physischen Laufwerke, nicht jedoch das logisch zusammengefügte Raid-1-Volumen. Adaptec offeriert in der Zwischenzeit Linux-Treiber als Binary-Module. Hier muss der Administrator – je nach Distribution – während der Installation das System auf die herstellereigenen Treiber zwingen. Da es sich letzten Endes aber ohnehin um ein Software-Raid handelt, kann er sich eigentlich den Aufwand sparen und anstelle der »Host-Raid-Funktion« gleich das Software-Raid von Linux nutzen.
Für den Test schickte Acer eine 5350-Konfiguration mit einer CPU 270, 2 GByte Arbeitsspeicher, SCSI/Host-Raid-Karte und zwei 73-Gbyte-SCSI-Laufwerken. Im Handumdrehen lässt sich der Windows-2003-Server in der 64-Bit-Version ohne Fremdtreiber auf dem System einrichten, auch wenn beim ersten Mal dabei das Host-Raid abgeschaltet bleibt. Laut Adaptec lassen sich diese Funktion nachträglich aktivieren und ein Spiegel der bestehenden ersten Platte erstellen, ohne dass es zu Datenverlust kommt. Im Test funktioniert das auch. Der Administrator muss dabei aber auf jeden Fall zuerst den Adaptec eigenen Host-Raid-Treiber einrichten. Linux ohne Host-Raid arbeitet ebenfalls ohne Probleme und ohne weitere Treiber.
In Sachen Performance bleibt der Acer nur geringfügig hinter dem Sun-Server zurück, da er eine um 200 Mhz langsamer getaktete CPU verwendet. Der direkte Vergleich zum Pentium D endet jedoch mit einem knappen Vorteil für Acer. Je nach Test schneidet mal der Intel, mal der AMD-Prozessor besser ab. Unterm Strich arbeiten der Pentium-D bei Floating-Point-Tests und der AMD bei Integer-Tests schneller. Die Memory-Perfomance des Acer-Servers ist gleichwertig wie die des Sun-Servers, und die Dell-Maschine arbeitet geringfügig schneller.
Fazit: Am Acer-Altos-5350 gefällt vor allem seine Skalierbarkeit. In der Grundausstattung mit einer CPU erreicht er bereits die Leistung bisheriger Dual-CPU-Systeme. Dabei bleiben dem Anwender aber Ausbaumöglichkeiten. Mit einer zweiten CPU kann der Altos seine Performance noch Mal fast verdoppeln und weitere 8-GByte-Speicher aufnehmen. Die Option, ein zweites Netzteil und bis zu acht Hot-Swap-fähige Platten einzubauen, verstärkt die Ausfallsicherheit.
Dass dem Design ein oder mehrere PCI-e-Steckplätze abgehen, fällt aktuell noch nicht so stark ins Gewicht, da es erst wenige PCI-e-Peripherie für Server gibt – in den kommenden Jahren wird sich das ändern. Schwerer wiegt das Fehlen eines zweiten GBit/s-Interfaces. Hier muss sich der Anwender mit einer PCI-X-Karte behelfen.
Knappes Abschneiden
Im direkten, technischen Vergleich der drei Server gewinnt der Acer Altos 5350, da er mehr Sicherheit und mehr Skalierbarkeit als die Maschinen von Sun und Dell offeriert. Die Bewertung berücksichtigt dabei jedoch nur zu 5 Prozent den Formfaktor. Für Anwender, die auf kompakte Rack-Server angewiesen sind, kommt der Altos dann weniger in Frage. Der Sieger im direkten 1-HE-Vergleich heißt x2100 von Sun, auch wenn der Vorsprung gegenüber dem Poweredge 850 recht gering ausfällt.
ast@networkcomputing.de