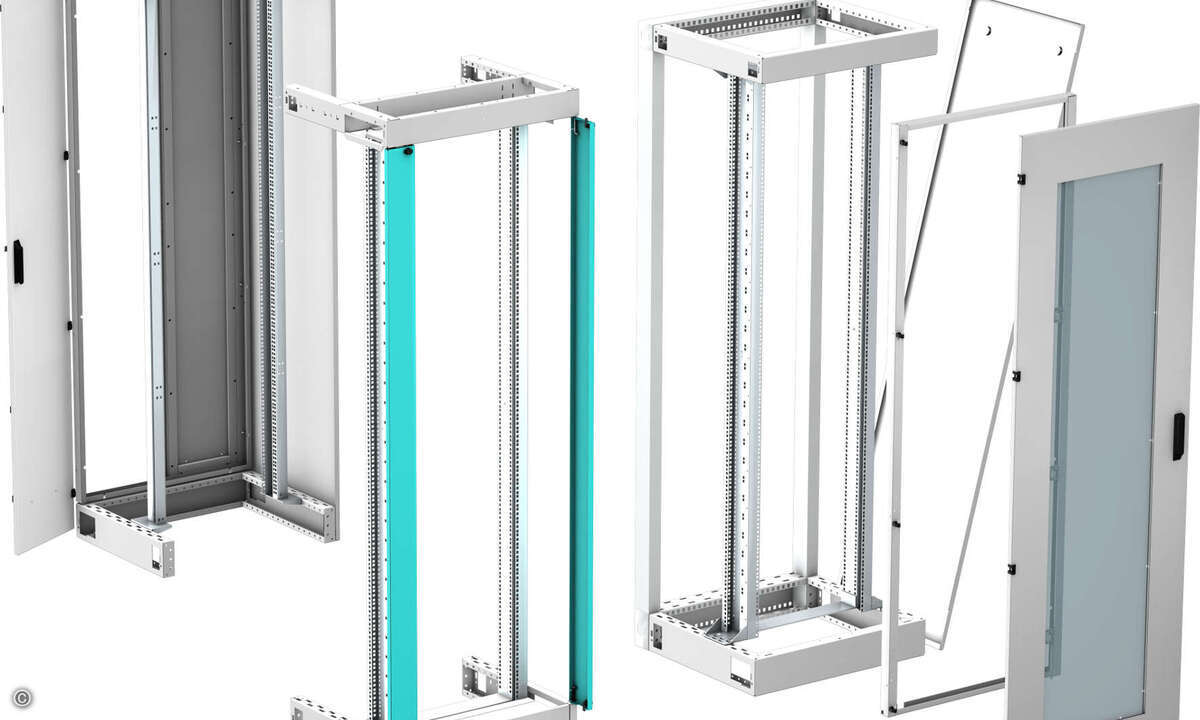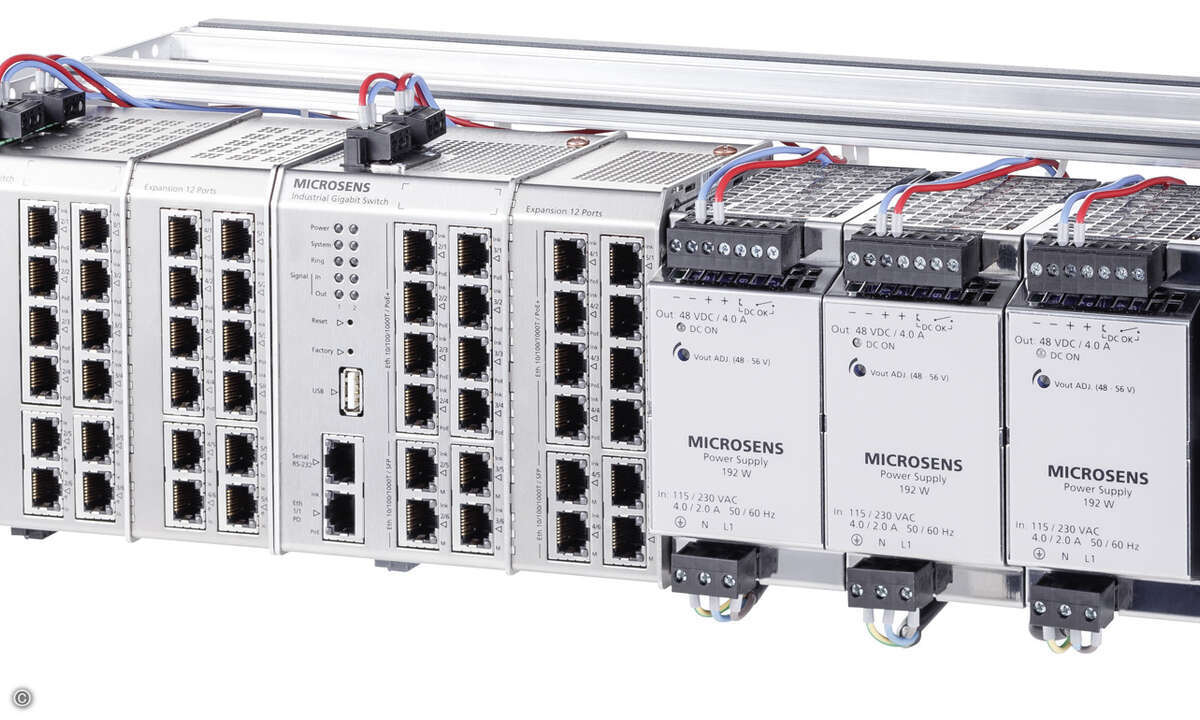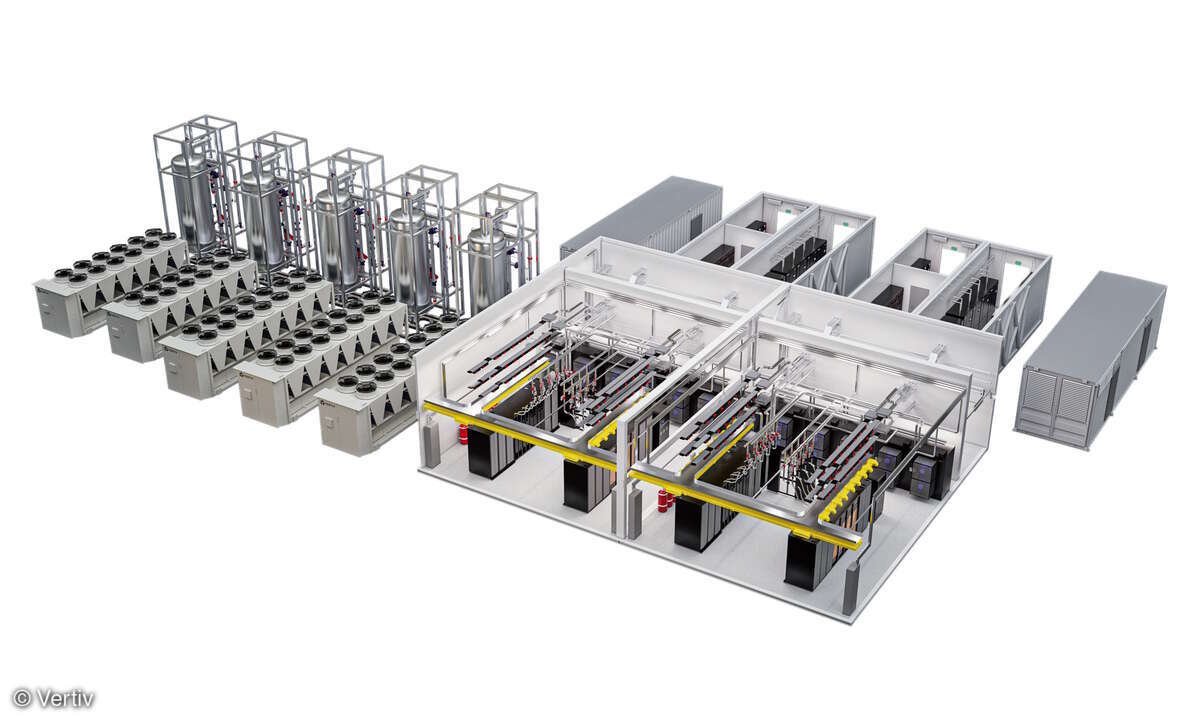Der vermeintliche Trend zum Single-Dasein
"Da nehm ich doch gleich Singlemode!" Diese Aussage von LWL-Netz-Betreibern ist zwar oft nachvollziehbar, birgt jedoch nach wie vor technischen und ökonomischen Diskussionsstoff. Nur wenn das Gesamtbudget tatsächlich keine Rolle spielt, ist ein nüchternes Abwägen überflüssig.Mit der Verabschiedung von IEEE802.3ba 40GBit-Ethernet im Sommer 2010 wurde eine Netzwerktechnik zum Standard, über die die Netzwerkszene bis heute kontrovers diskutiert. Den Stoff dazu liefert insbesondere die Einführung der auf acht oder 20 Multimode-Fasern basierenden Paralleloptik mit vier beziehungsweise zehn parallel geführten 10-GBit/s-Kanälen. Anhängern der klassischen Zweifasertopologie mag es als gangbarer Ausweg erscheinen, mit 40GBase-LR4 eine Netzwerkoption basierend auf zwei Singlemode-Fasern realisieren zu können, auch wenn man die damit darstellbare Link-Distanz von zehn Kilometern gar nicht benötigt. Darüber, ob der so skizzierte Weg zu 40GbE technisch machbar und generell als Migrationsstrategie zu empfehlen ist, sollten Interessenten mit großer Vorsicht nachdenken, wie die nachfolgende Betrachtung auf Systemkostenebene ergibt. Zwei Arten Lichtwellenleiter Als 1970 der erste Lichtwellenleiter erschien, war dessen optische Dämpfung von 20 dB/km noch weit von dem heute üblichen niedrigen Niveau entfernt. Besonders die optischen Resonanzen der OH-Moleküle im Glas ließen das Wellenlängenfenster um 850 nm günstig erscheinen, was ihm den Namen "erstes optisches Fenster" eintrug. Prozessverbesserungen erschlossen später weitere Wellenlängen, von denen das so genannte zweite optische Fenster um 1.310 nm größte Bedeutung erlangt hat. Diese Entwicklung ist auch heute noch nicht zum Stillstand gekommen. Als die Hersteller in den 1980er-Jahren erste kommerzielle Übertragungsstrecken realisierten, waren zwei Probleme dominant: Die Einkopplung einer genügend großen Lichtleistung und die Bandbreitenbegrenzung durch Dispersion. Ein LWL mit großem Licht führenden Kern transportiert Lichtleist
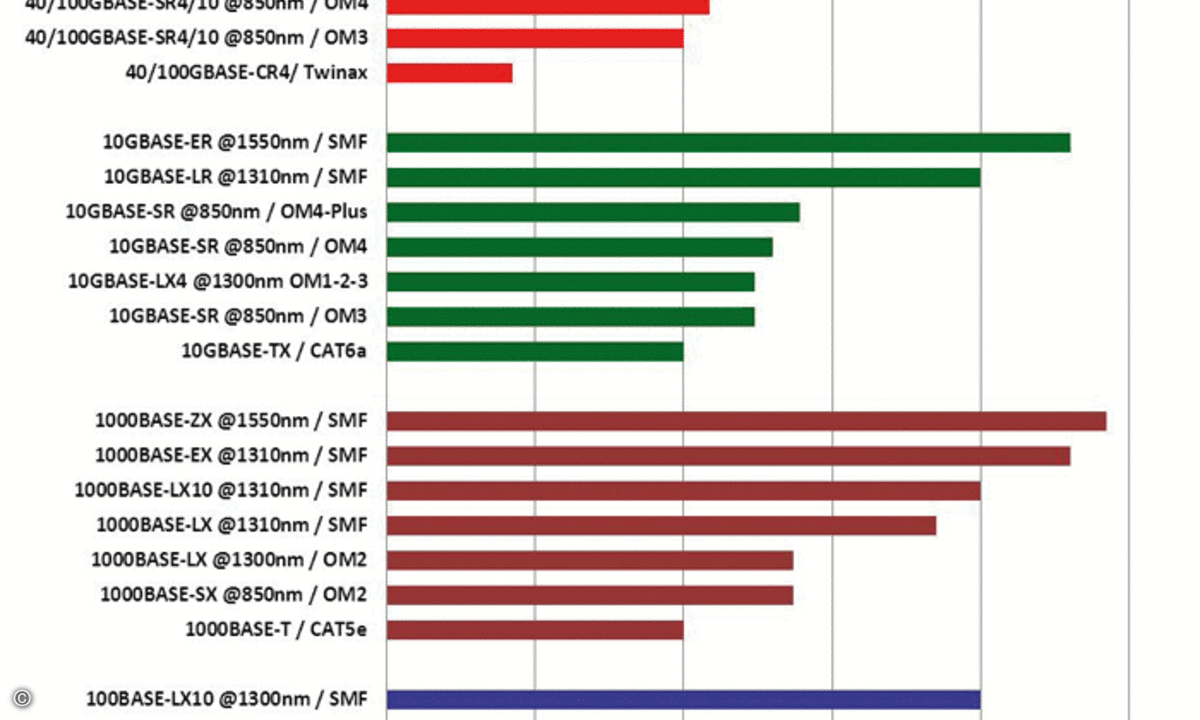


![mb602spo_full_metal_de[1]](https://www.connect-professional.de/bilder/809297/landscapex1200-c2/mb602spo_full_metal_de1.jpg)