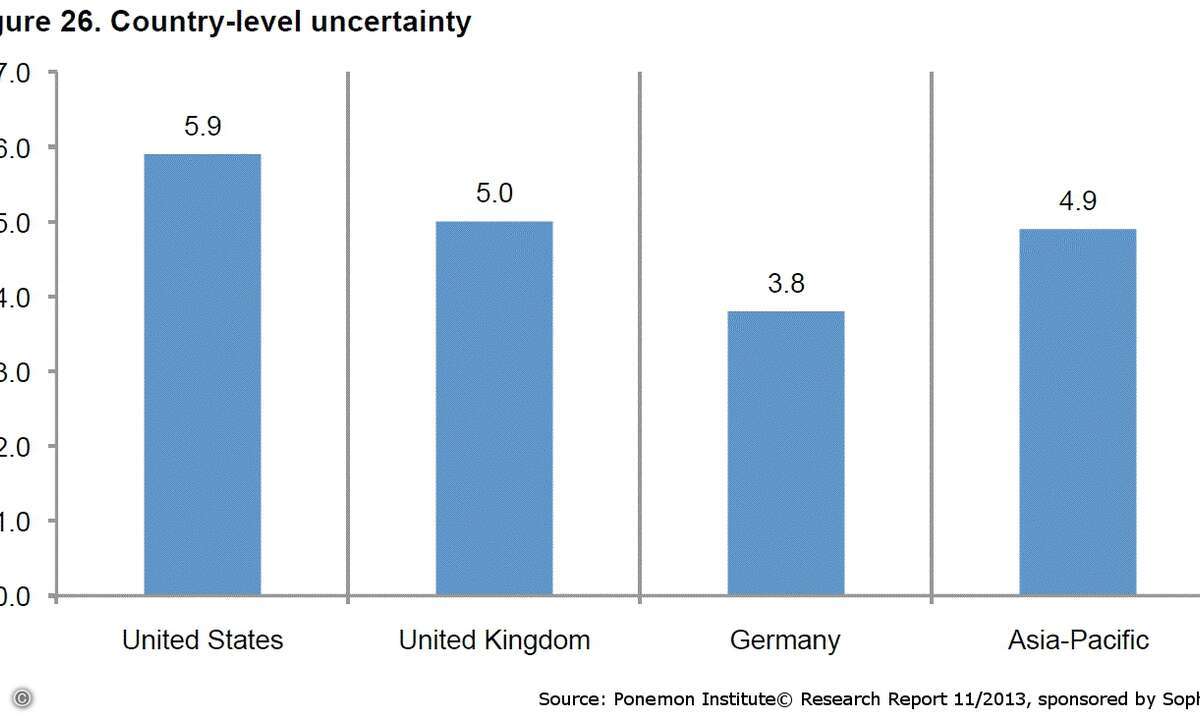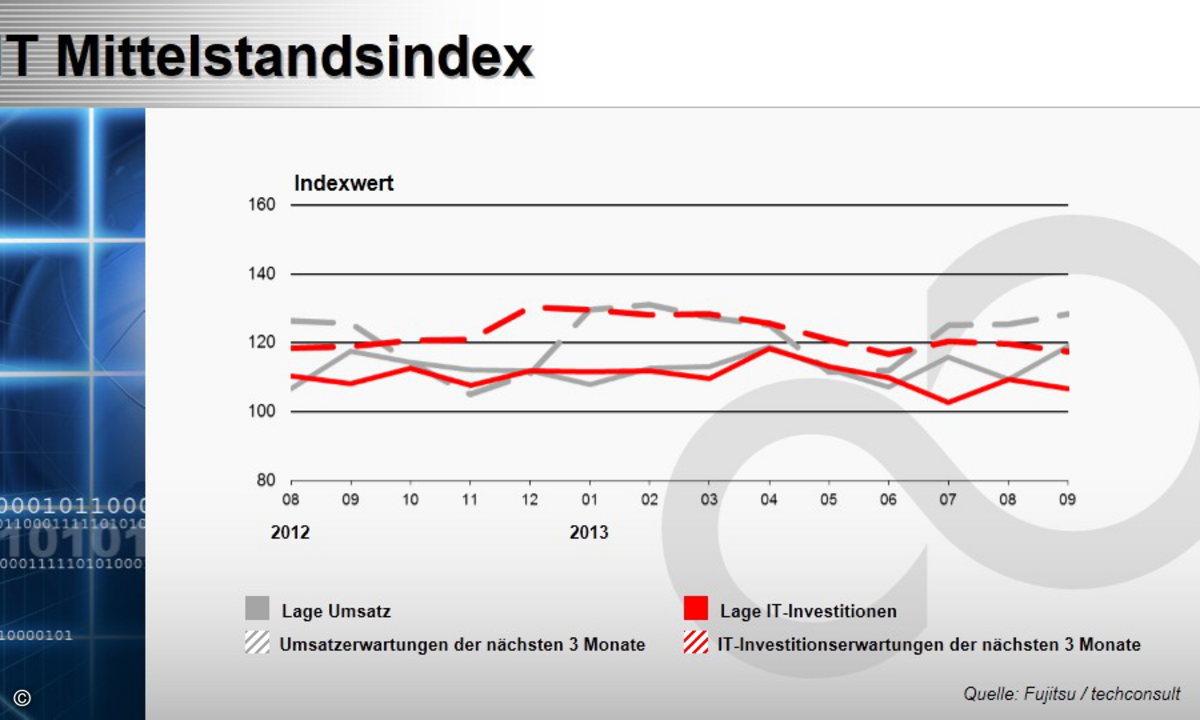»Auch Mittelständler benötigen SOA«
»Auch Mittelständler benötigen SOA«

Herr Kerstan, warum sollte gerade eine mittelständische Firma ihre Anwendungen anfassen und auf Serviceorientierung trimmen? Der IT-Etat ist dort noch knapper als in der Großindustrie und wenn Aufträge erfasst und Rechnungen geschrieben werden können, ist das doch schon mal nicht schlecht und man kann sich auf die eigentlichen Geschäftsprozesse konzentrieren?
Das ist zu kurz gedacht. Die eigentlichen Geschäftsprozesse, wie Sie das ausdrücken, sind nämlich in aller Regel auch bei vielen Mittelständlern nicht mehr von den IT-Anwendungen zu separieren.
Trotzdem: zunächst fallen für die Mittelständler erst mal Kosten an.
…die sich aber schnell amortisieren können.
Wie zum Beispiel?
Gut, nehmen wir ein Beispiel. Der Textilfilialist Wöhrl in Nürnberg ist ein typischer Mittelständler: 2900 Mitarbeiter, 38 Filialen, der Umsatz liegt bei 340 Millionen Euro. Die Margen für Handelsunternehmen in der Bekleidungsindustrie sind relativ statisch. Einsparpotenzial liegt vor allem in der Prozessoptimierung.
Bei Handelsunternehmen wird man da wohl zuerst an die Lieferprozesse herangehen.
Ganz genau. Wöhrl hat die gesamte Lieferkette neu gestaltet.
Und die alten Programme weggeworfen?
Überhaupt nicht. Beispielsweise wurde das eigenentwickelte, in Cobol geschriebene Warenwirtschaftssystem in die neue Architektur integriert. Durch diese Einfügung in eine serviceorientierte Architektur kann das Warenwirtschaftssystem mit neuen Anwendungen eng verknüpft werden. Diese neuen Anwendungen sind im Übrigen nicht etwa durch die serviceorientierte Architektur bedingt, sondern durch geschäftliche Notwendigkeiten. Auch Mittelständler haben neue Anforderungen, sie leben nicht in einer statischen Prozesswelt, wie Sie das in Ihrer Anfangsfrage suggeriert haben.
Was kam bei Wöhrl an neuen Anforderungen hinzu?
Es wurde der komplexe Abgleich zwischen Bestell- und Lieferscheinen zwischen Wöhrl und 40 Einkäufern sowie 500 Lieferanten automatisiert. Die Aufzeichnung und Analyse des Prozesses mit dem WebSphere Business Modeler sorgt dabei für Transparenz und zeigt Optimierungsmöglichkeiten auf. In diesem Zusammenhang ergab sich dann auch die Anforderung, eine Freiformerkennung von Bestell- und Lieferscheinen zu programmieren. Aufgrund des serviceorientierten Rahmens spielt diese neue Anwendung mit dem eben erwähnten Warenwirtschaftssystem zusammen. Die Neuausrichtung der Architektur hat weitere positive Effekte. So ergibt sich aus der jetzigen Lösung quasi von selbst eine Lieferantendokumentation, auf deren Basis sich eine Wertetabelle der Lieferanten aufstellen lässt.
Kommen wir noch einmal auf die Technik zurück. Serviceorientierte Architekturen arbeiten mit einem Service-Bus, an den die einzelnen Module angedockt werden. Das klingt nach Legowelt, aber so einfach wie Legoteile lassen sich Softwaremodule meiner Erfahrung nach denn doch nicht zusammenstecken.
Die Schnittstellen mögen etwas komplexer sein als bei Legobaustei-nen, aber im Grundsatz ist es tatsächlich das Legoprinzip. Hier arbeiten wir stark mit unseren Geschäftspartnern zusammen, die SOA-spezifische Programmteile erstellen. Unter dem Signet »Ready for IBM SOA« können die Partner ihre Lösungen von IBM prüfen und anerkennen lassen. Wenn ein Modul dieses Signet trägt, heißt das für den Anwender unter anderem, dass es über den Service-Bus problemlos mit den anderen zertifizierten Katalogmodulen zusammenspielt.
Und wenn doch mal eine Nacharbeit oder Anpassung notwendig ist, beispielsweise weil ein besonderer Anwendungskontext vorliegt?
Dann ist sichergestellt, dass entsprechend geschulte Leute zur Verfügung stehen, die das Ding zum Laufen kriegen. Denn für den Einsatz SOA-geeigneter Module ist neben der Technik vor allem das Mitarbeiterwissen in den verschiedenen Bereichen entscheidend.