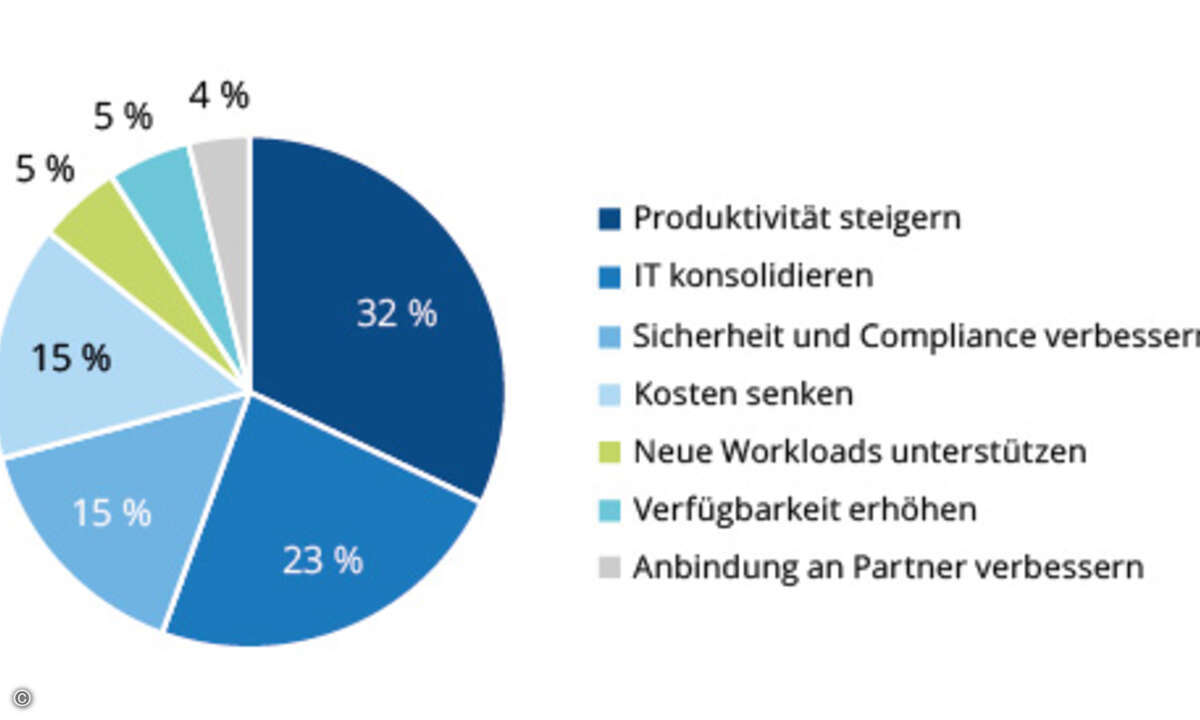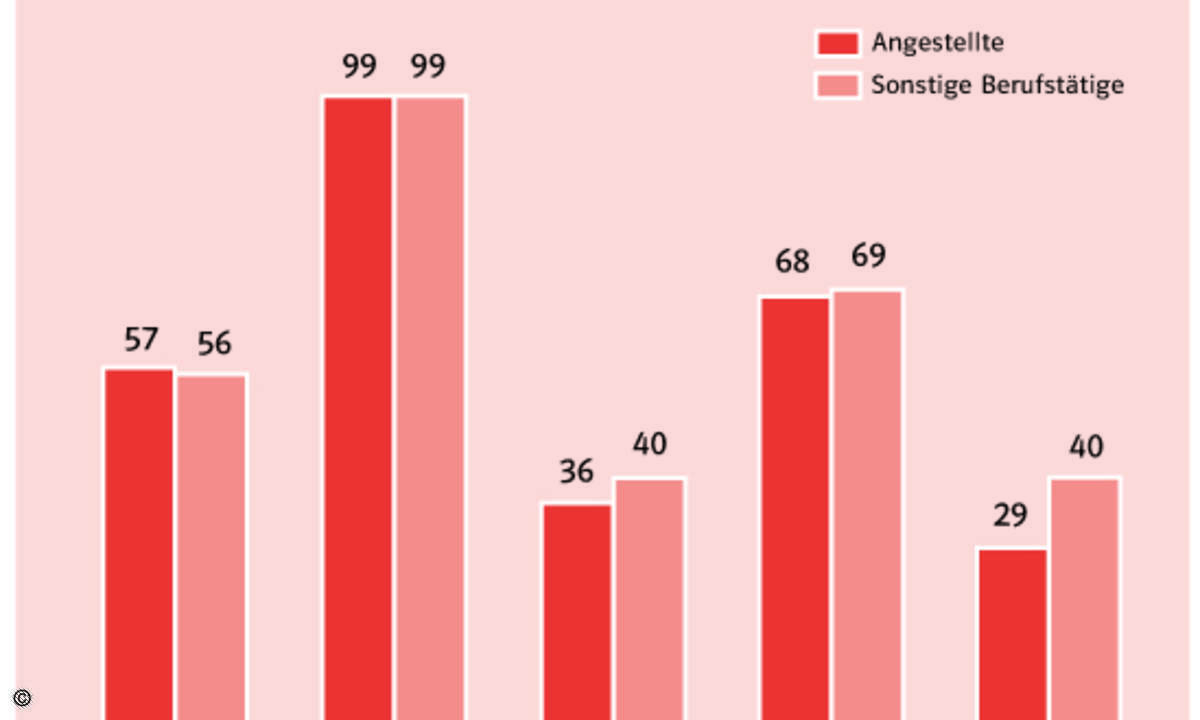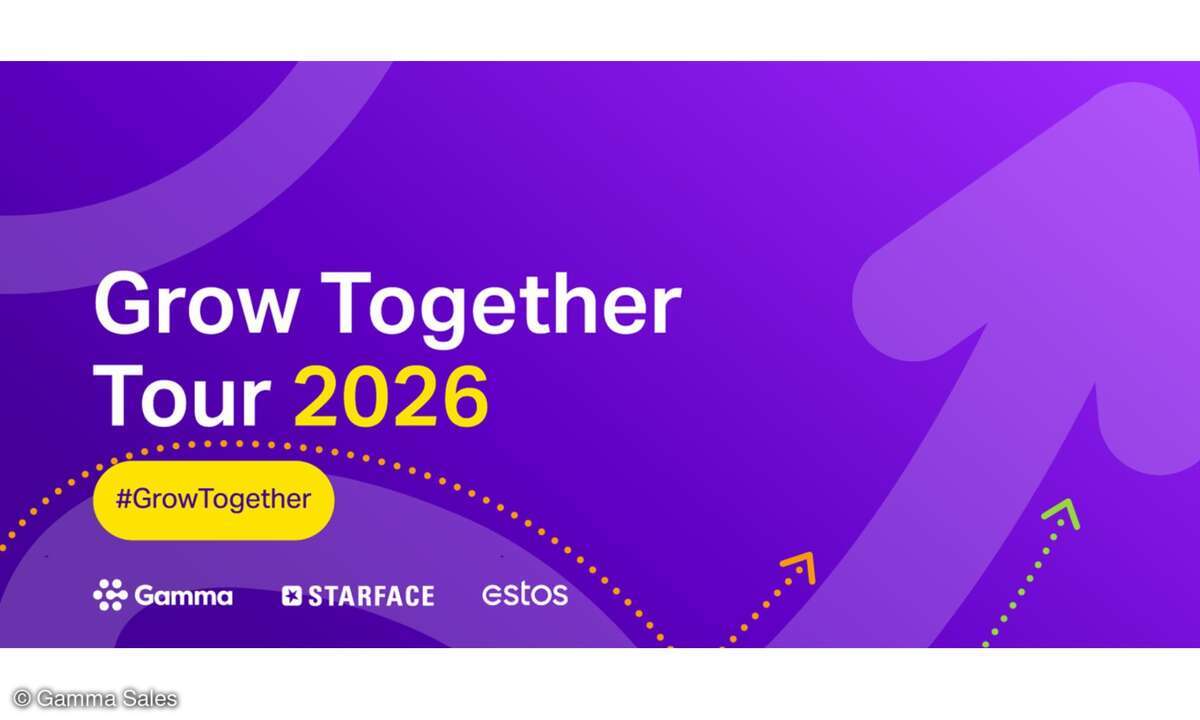Auf dem Weg zum modernen Dienstleister
Auf dem Weg zum modernen Dienstleister. Bürger und Wirtschaft verlangen von Behörden immer mehr Service, gleichzeitig sinken aber die Budgets. Dieser Spagat lässt sich nur mit innovativen Geschäftsprozessen und einer flexiblen IT-Architektur bewerkstelligen.

Auf dem Weg zum modernen Dienstleister
Die Zeiten der tristen Amtsstuben und langen, nervenaufreibenden Wartezeiten scheinen sich dem Ende entgegen zu neigen. Der öffentliche Sektor der Zukunft ist agil, kundenorientiert und stellt sich dem Wettbewerb. Bürger und Unternehmen fordern von »ihrer« Behörde einen besseren Service, wie sie ihn von privaten Unternehmen seit langem gewöhnt sind.
Um diese steigenden Anforderungen allerdings in voller Breite erfüllen zu können, sind Investitionen nötig: Denn die Organisationen müssen neu aufgestellt, Prozesse verbessert und Vorschriften und Regularien entstaubt werden. Gleichzeitig sind Ausgaben in EDV-Systeme nötig, damit sich die Prozesse auch in der gewünschten Form umsetzen und künftig flexibel anpassen lassen, etwa bei gesetzliche Änderungen. Doch die vorhandene IT ist zum Teil extrem veraltet ? vor allem fehlt es an integrierten übergreifenden Anwendungen, die eine Zusammenarbeit sowohl ressortübergreifend als auch auf kommunaler, landes- und internationaler Ebene erlauben. Resourcen-Optimierung
Angesichts knapper Kassen ist der öffentliche Sektor mehr denn je gefordert, den Nutzen und den RoI von Projekten nachzuweisen. Bürger fordern zu Recht diesen Nachweis: Sie wollen wissen, was mit ihren Steuergeldern passiert. Das belegt eine im April 2005 veröffentlichte Studie der Economist Intelligence Unit zum Thema »Business 2010«, in deren Rahmen 776 Verantwortliche aus dem öffentlichen Dienst befragt wurden. Für zwei Drittel der Befragten ist der Ausbau eines guten Serviceangebots in den nächsten fünf Jahren die wichtigste Aufgabe.
Einen ebenso hohen Stellenwert hat für die Verantwortlichen die Transparenz über Abläufe sowie deren Verbesserung, insbesondere der Zusammenarbeit über Ressort- und Ländergrenzen hinweg. Gleichzeitig steht für das Gros der Befragten der Nachweis des Nutzens von Investitionen gegenüber den Bürgern ganz oben auf der Prioritätenliste.
»In der Vergangenheit wurde die Leistung öffentlicher Einrichtungen allein auf Basis quantifizierbarer, monetärer Ergebnisse gemessen, zum Beispiel anhand von Kosteneinsparungen «, erklärt Jerry Mechling, Director des E-Government Executive Education (3E)-Projekts an der John F. Kennedy School of Government. Der wirtschaftliche Nutzen spiegelt aber nur einen Aspekt der Effizienz von Verwaltungen wider, soziale und politische Werte von öffentlichen Programmen bleiben unberücksichtigt. Letztere reichen von der simplen Zeitersparnis der Bürger bei Behördengängen bis hin zu geringerer Abhängigkeit von staatlicher Unterstützung oder besseren Kinderhilfeprogrammen.
Die Ermittlung des RoI stellt die Verantwortlichen im Public Sector jedoch vor große Herausforderungen. Denn anders als bei privaten Unternehmen geht es hier in den seltensten Fällen um Gewinnmaximierung. Auch Kriterien wie Kundenzufriedenheit und -bindung sind hier schwer zu bewerten, da sich im Gegensatz zur Wirtschaft »der Kunde« oder die »Kundensegmente« nicht so einfach definieren lassen: Kunde ist praktisch jeder, der ein Anliegen hat. Für Bürger oder Unternehmen bedeutet das umgekehrt, dass sie für den Bezug der Leistungen keine Auswahl haben. Er ist einem Verwaltungsstandort zugeordnet und erhält dort seine Dienstleistungen ? ob zu seiner Zufriedenheit oder nicht.
Die Verantwortlichen im öffentlichen Bereich haben die Notwendigkeit erkannt, den Kriterienkatalog für die Ermittlung eines RoI zu erweitern. So haben sich laut einer Economist- Studie rund 70 Prozent der Befragten auf die Fahnen geschrieben, bei dieser Aufgabe neben den wirtschaftlichen Aspekten ebenso soziale und politische, also »weiche«, Faktoren zu messen.
SAP, zum Beispiel, hat eine Public RoI-Initiative ins Leben gerufen, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Parameter für eine Amortisationsrechnung in öffentlichen Verwaltungen zu ermitteln, Untersuchungsschwerpunkte festzulegen und Methoden für ein universell anerkanntes Analysemodell zu entwickeln. Andere Software- Anbieter adressieren heutzutage ebenfalls immer stärker den öffentlichen Sektor.
Das Land Hessen ist an der Public RoI-Initiative beteiligt: »Dieses Thema ist für Hessen sehr aktuell und interessant, denn wir möchten unseren Bürgern den Nutzen der Dienstleistungen verdeutlichen, die sie von unseren Landesbehörden erhalten«, betont Harald Lemke, Staatssekretär im hessischen Innenministerium. »Eine öffentliche Verwaltung muss sowohl harte als auch weiche Ziele erreichen, daher können Investitionen nicht allein unter finanziellen Gesichtspunkten bewertet werden«, so Lemke.
Schritt für Schritt
Die nötigen Veränderungen lassen sich jedoch nur in wohl durchdachten Schritten realisieren. Es gilt, mit möglichst geringem Risiko Innovation zu fördern. Bei der Umsetzung übergreifender Konzepte hat es sich allerdings als hilfreich erwiesen, einen »Sponsor aus der Führungsetage« zu finden, der mit der entsprechenden sozialen Durchsetzungskraft ausgestattet ist und auch den Rückhalt im politischen Umfeld hat. Gleichzeitig sollte ein Ablauf für das Change- Management definiert werden, der alle Beteiligten rechtzeitig auf den Wandel hin zu einer Serviceorientierten Organisation begleitet.
Eine weitere Hürde sind die zum Teil komplexen Ausschreibungsverfahren. Sie adressieren in der Regel nur einen Ausschnitt des Ganzen. Nicht selten wird dann eine Lösung für den Einzelfall gebaut, die bei der Betrachtung des Gesamtkontextes anders ausgefallen wäre.
Zukünftig sollte daher verstärkt ressortübergreifend geplant und agiert werden. Erste Anzeichen sind zu erkennen, die Zusammenarbeit auch über Landesgrenzen hinweg auszubauen. Eine serviceorientierte Architektur ist dabei von Nutzen, weil hier bestehende Systeme integriert und somit bereits getätigte Investitionen langfristig geschützt werden können. Andererseits erlaubt eine solche Architektur die sukzessive Erneuerung der IT-Landschaft und mehr Flexibilität. Auf Basis dieser Architektur lässt sich ein optimaler Kundenservice kostengünstig umsetzen.