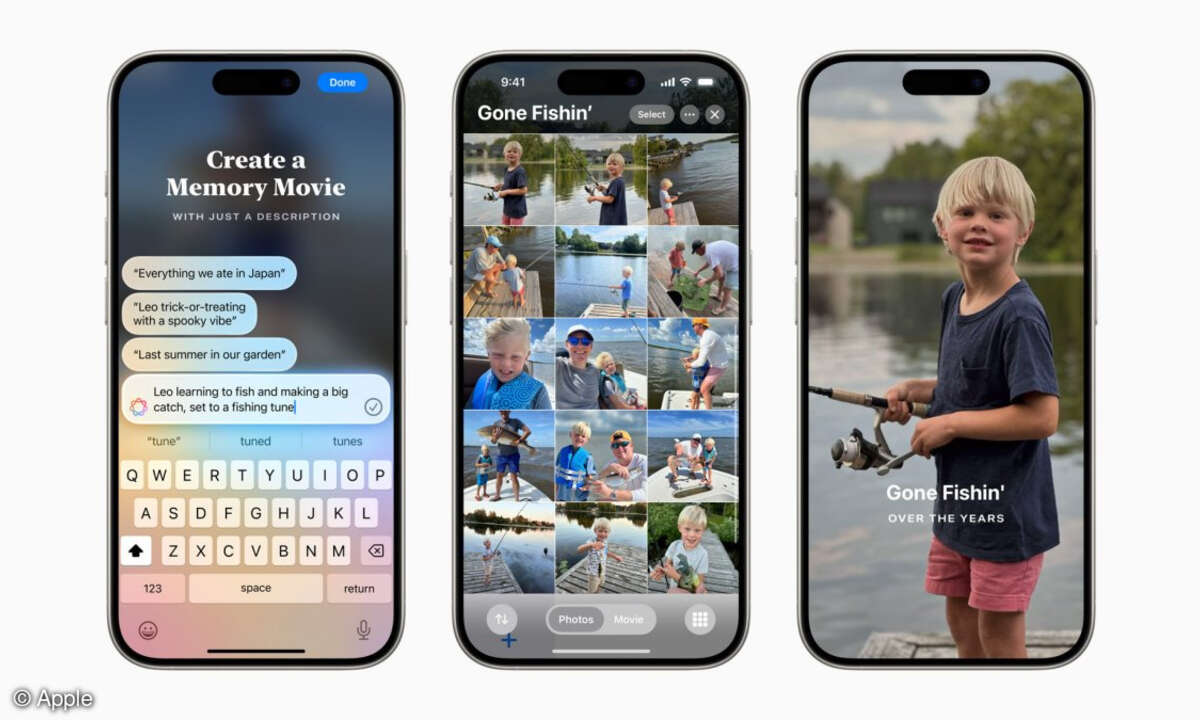Elektronische Tarnkappe gegen Videoüberwachung
Egal ob in U-Bahnhöfen, auf zentralen Plätzen, auf Hauptverkehrsstraßen oder auf dem Gelände von Firmen: Überall sind mittlerweile Videoüberwachungsanlagen aktiv. Ein Forscher von Hewlett-Packard hat nun ein System vorgestellt, das die Gesichter von Menschen auf solchen Aufnahmen unkenntlich macht.


Die Videoüberwachung von öffentlichen Räumen stößt nicht nur auf Zustimmung. Datenschützer monieren, dass der Staat damit zu stark in die Privatsphäre von Bürgern eingreift. Jack Brassil von den Forschungslabors von Hewlett-Packard hat nun mit »Cloak« eine Technik entwickelt, die menschliche Gesichter auf solchen Überwachungsvideos unkenntlich macht.
Bei näherem Hinschauen sieht das Ganze jedoch eher nach »Den Teufel durch Beelzebub austreiben« aus. Denn damit Brassils System weiß, welches Gesicht verzerrt werden soll, müssen sich die betreffenden Personen zuvor registrieren lassen.
Außerdem ist es notwendig, dass sie ihre gegenwärtige Position permanent dem Überwachungssystem mitteilen. Das erfolgt mithilfe von GPS-Systemen, etwa einem Smartphone mit integriertem GPS-Chip.
Cloak soll eine Art digitale Tarnkappe bilden, die den Träger vor Kameras im öffentlichen Raum schützt, so Brassil in einem Beitrag des amerikanischen Wissenschafts-Internet-Portals New Scientist. Sobald das System den Standort eines Nutzers ermittelt hat, teilt es allen Kameras in der näheren Umgebung mit, dass sie die entsprechende Person nicht filmen dürfen.
Bilder lassen sich nicht mehr rekonstruieren
Anhand der exakten Positionsdaten erkennen die Kameras die betroffenen Personen und verzerren das Gesicht auf den Bilder automatisch. Werden die Videoaufnahmen weitergereicht, kann die unkenntlich gemachte Person darauf nicht mehr identifiziert werden.
Problematisch ist, dass sich die Nutzer des Systems zuvor registrieren lassen müssen. Hinzu kommt, dass zwar keine Videoaufnahmen vom User erstellt werden. Dafür kann jederzeit dessen Aufenthaltsort bestimmt werden.
Britische Datenschützer kritisieren einen anderen Aspekt: Ian Brown vom Oxford Internet Institute etwa vertritt die Auffassung, dass Brassils Ansatz prinzipiell falsch ist. »Menschen sollten nicht zu einer Registrierung genötigt werden, um ihre Privatsphäre schützen zu können«, so Brown.
Brassils System würde sogar noch weiter gehen, als Bürger »nur« zu filmen. Immerhin müsse dem System laufend dessen aktuelle Position mitgeteilt werden.
Der Forscher von Hewlett-Packard räumt ein, dass seine Entwicklung nicht allen Forderungen gerecht werden könne. Überwachungssysteme sollten von Beginn an mit Datenschutzeinrichtungen konstruiert werden, so seine Forderung.
»Das Problem ist jedoch, dass sich Technologien schneller entwickeln als unser Verständnis für deren Auswirkungen auf die Privatsphäre«, weist Brassil auf einen Punkt hin, mit dem sich die Menschheit seit Jahrtausenden herumschlägt: der Diskrepanz zwischen dem, was technisch machbar ist, um dem, was unter ethischen und sozialen Aspekten wünschenswert ist.
Brassil hat einen Fachaufsatz zu »Cloak« auf der Web-Seite der HP-Labs veröffentlicht. Hier der Link zu »Technical Challenges in Location-Aware Video Surveillance Privacy«.