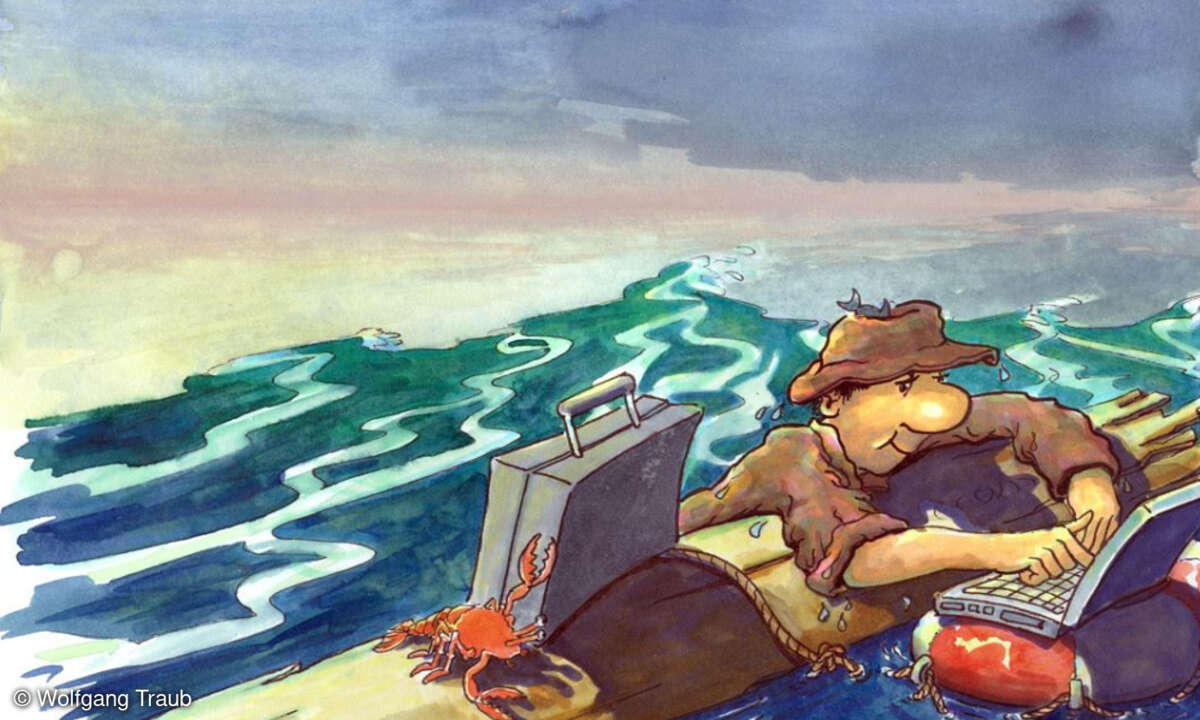Es werde bunt
Die Preise für Farblaserdrucker fallen. Ganz simple Modelle können für den Betrieb im LAN jedoch nicht herhalten, denn ein paar Grundfunktionen müssen die Geräte für den Businesseinsatz beherrschen.

Trotz der 16,7 Millionen verschiedener Farben auf den Bildschirmen geben sich viele Business-Anwender mit fahlen Graustufen auf ihren Ausdrucken zufrieden. Bei den Privatanwendern haben sich Farbdrucker schon vor Jahren durchgesetzt, doch im Bürobereich herrscht weiter Zurückhaltung. Das liegt zu weiten Teilen an der unverschämten Preispolitik der Hersteller selbst. Während die Farb-Tintenstrahldrucker zu Preisen knapp am Herstellungspreis über die Ladentheke gehen, zocken Canon, Epson, HP, Lexmark und Konsorten ihre Kunden im großen Stil bei den Patronen ab. Das mag den Heimanwender mit seinem geringen Druckvolumen wenig stören, doch im Firmenbereich sind Seitenpreise jenseits der 70 Cent ein Ausschlusskriterium. So findet man in mittelgroßen und großen Unternehmen bunte Druckwerke nur in den wenigen Abteilungen, in welchen kreative Köpfe Designs, Layouts oder Grafiken erstellen.
Doch auch der reguläre Büroanwender könnte vom Farbdruck profitieren. Marketing-Handouts sehen nun mal mit farbigen Säulen besser aus, ebenso Angebote oder reguläre Anschreiben mit dezenten farblichen Hervorhebungen hier und da. Vor dem Kauf eines Farblasers muss man sich jedoch genau überlegen, wie der Drucker eingesetzt werden soll. Dazu gehört eine Schätzung des monatlichen Druckvolumens, die Art der Farbdrucke – flächige Businessgrafiken, Fotos, oder simple Zeichnungen und farbige Texte – sowie die Netzwerkanbindung.
Natürlich kann ein Farblaser auch Schwarzweißseiten erstellen, wird dabei aber niemals so effizient arbeiten wie ein reiner Schwarzweißdrucker. Daher muss man den Farbdrucker parallel zum Schwarzweißdrucker installieren – natürlich an einer zentralen Stelle im Büro und integriert in das vorhandene Netzwerk.
Eine leider auch bei Laserdruckern gültige Regel lautet: Je günstiger der Drucker, desto teurer die Verbrauchsmaterialien. Hinzu kommt, dass kompakt dimensionierte Geräte mit vergleichsweise kleinen Cartridges arbeiten und damit häufige Wartungen erfordern. Günstige Farblaser nutzen in der Regel das Multipass-Verfahren. Dabei überträgt der Drucker nacheinander die vier Grundfarben auf das Papier. Folglich schafft er nur ein Viertel der Druckgeschwindigkeit im Vergleich zum Schwarzweißmodus. Ein 16-Seiten-Drucker schafft in Farbe dann nun noch vier Seiten. Natürlich gibt es auch Geräte, welche im Single-Pass-Verfahren alle vier Farben in nur einem Durchlauf zu Papier bringen. Diese Geräte liegen aber in höheren Preisklassen.
Neben der Mechanik tragen auch Speicher- und Prozessorausstattung zum Preis eines Farblasers bei. Je mehr der Drucker selbst kann, desto größer müssen seine Rechenleistung und der Hauptspeicher ausfallen. Leistungsfähige Druckersprachen wie PCL 6 oder Postscript Level 3 belasten den oder die angebundenen Rechner relativ wenig, da der Drucker selbst die Bildaufbearbeitung für die Druckausgabe übernimmt. An dieser Stelle sparen die Druckerhersteller bei den günstigen Modellen. Printer mit einem GDI-Interface überlassen die Umwandlung von Datei zu druckfähigem Bild dem Druckertreiber und damit dem Client-PC. GDI-Drucker kommen mit recht wenig Prozessorpower und Speicher aus, dafür muss der angebundene Host umso mehr erledigen. Simple Einzelplatzsysteme mit hochgezüchteten CPUs haben damit eigentlich kein Problem, anders verhält sich das jedoch, wenn der Drucker im Netzwerk zum Einsatz kommt und viele Anwender darauf zugreifen. Die Aufbearbeitung der Bilddaten bleibt dann am Druckserver hängen. Wer in mittelgroßen oder kleinen Bereichen aber nur einen Server einsetzt, wird diesen kaum mit der Verarbeitung von Druckerdaten überlasten wollen. Für den Netzwerkbetrieb eignen sich daher nur Farblaser, die mindestens über PCL6 oder besser gleich Postscript Level 3 beherrschen. Das erspart den Anwendern zudem komplexe Druckertreiber, da PCL und PS eigentlich zu den Standardausstattungen aller Betriebssysteme gehören, von Windows über Mac OS 9 und 10 bis hin zu Linux, BSD oder Solaris.
Welche Sprache sich zur Ausgabe besser eignet, hängt vom Inhalt des Druckjobs ab. Seiten, die überwiegend aus Text und wenigen einfachen Grafiken bestehen, verarbeitet PCL deutlich schneller als Postscript. Das wiederum kann komplexe Grafiken und Bilder zügiger und präziser verarbeiten. Da das bekannte Portable-Document-Format »PDF« ganz auf Postscript basiert, lassen sich PDF-Dateien etwa doppelt so schnell über PS zu Papier geben als über PCL.
Bei der Netzwerkanbindung stehen dem Administrator viele Möglichkeiten frei. Teurere Farblaser integrieren eine Netzwerkschnittstelle, optional oder ab Werk. Ein integriertes Interface passt sich den Funktionen des Druckers am besten an. Dafür kann es in heterogenen Umgebungen mit Druckerkarten verschiedener Hersteller zu Managementproblemen kommen – das betrifft dann wiederum nur Unternehmen mit einer großen Zahl an Netzwerkdruckern. Externe Printserver von Drittanbietern arbeiten mit Druckern jedes Herstellers, schränken dabei jedoch die Sonderfunktionen des jeweiligen Modells möglicherweise ein.
Wesentlich interessanter hingegen sieht es beim LAN-Protokoll aus. Hier erlauben moderne auf IP-basierende Druckerprotokolle wie IPP, dass die Anwender ohne Umweg über einen Server direkt auf den Laser zugreifen. Das belastet dafür die Workstations der Anwender und erschwert dem Administrator die Zugangskontrolle. Besser eignen sich vergleichsweise primitive Druckprotokolle wie LPR oder Druck via NetBIOS. Hier kann der Verwalter den direkten Zugang zum Drucker selbst auf einen zentralen PC-Druckserver limitieren. Das zwingt die Anwender, ihre Druckjobs über den PC-Printserver abzuwickeln. Dieser kann dann ebenfalls die zentrale Treiberverwaltung übernehmen und die Zugriffsrechte zum Drucker kontrollieren. Der zentrale Druckerserver nimmt zudem die Aufträge der angebundenen Arbeitsstationen zügig entgegen und lagert sie zwischen, egal ob der Drucker gerade viel zu tun hat, oder gar auf Grund von Wartungsaufgaben gar nicht zur Verfügung steht. Welche Protokolle für Druckausgaben dann im LAN genutzt werden dürfen, hängt vom Printserver-PC und nicht vom Drucker selbst ab. Ein Drucker, der zwar IP, aber kein Apple-Talk spricht, lässt sich beispielsweise mit den Apple-Druckdiensten eines Windows- oder Linux-Servers dann doch für Mac OS 9.x-Clients einsetzen.
Für kleine oder mittelgroße Netzwerke taugen die ganz billigen Farblaser der einfachsten Kategorie nicht. Für den Betrieb im LAN sollte dann mindestens ein Druckwerk mit PCL oder Postscript und einer integrierten LAN-Karte zur Verfügung stehen. Die Auswahl des Modells sollte weniger vom einfachen Anschaffungspreis des Gerätes als von der monatlichen Druckleistung abhängen. Wer für sein Unternehmen eine Kapazität von 5000 farbigen Druckseiten pro Monat errechnet, muss auch ein Gerät anschaffen, für das der Hersteller diese Monatsleistung garantiert. [ ast ]