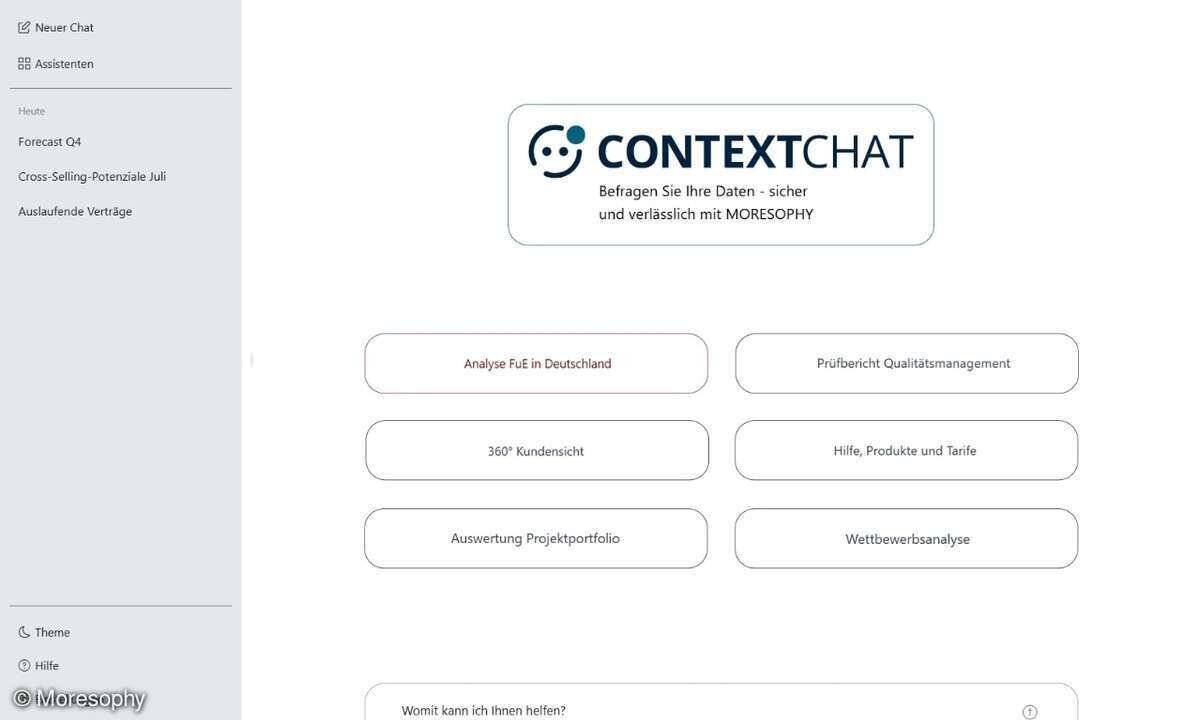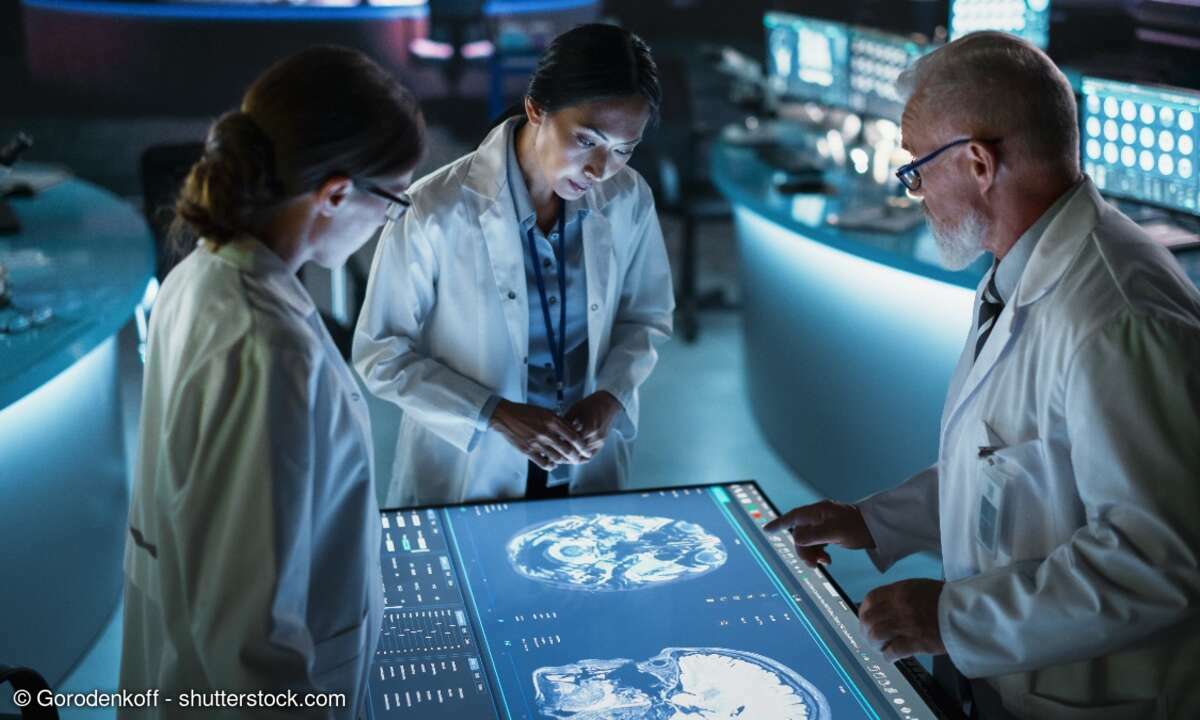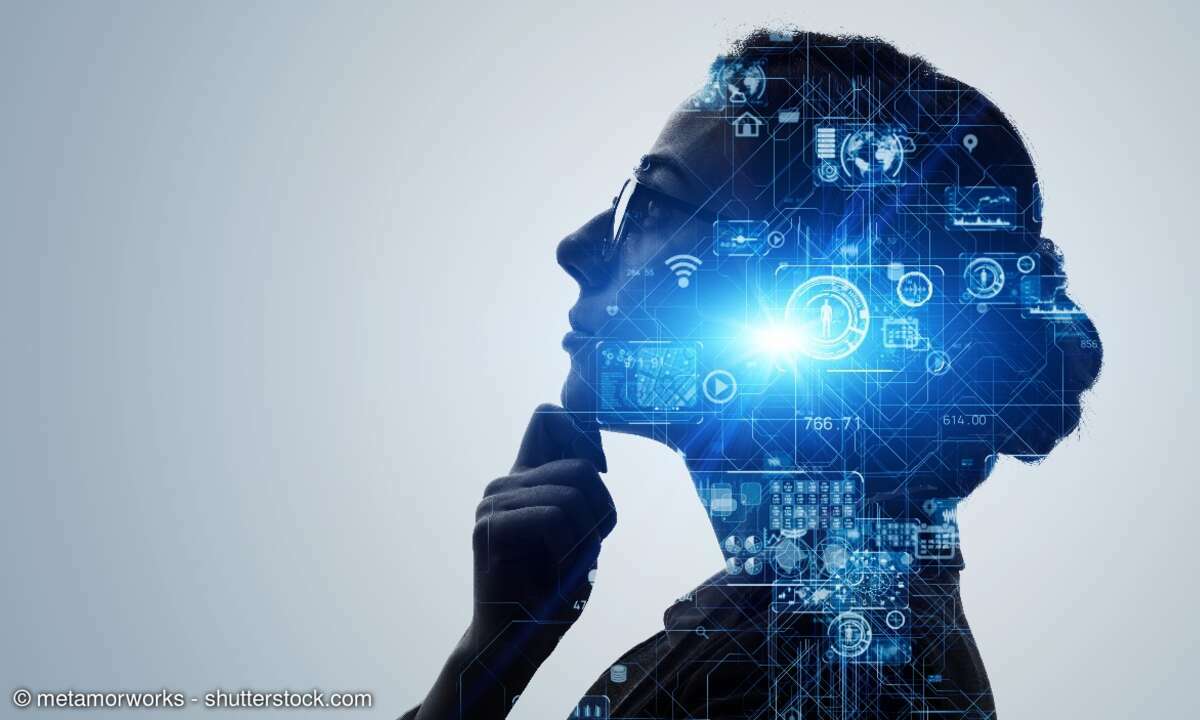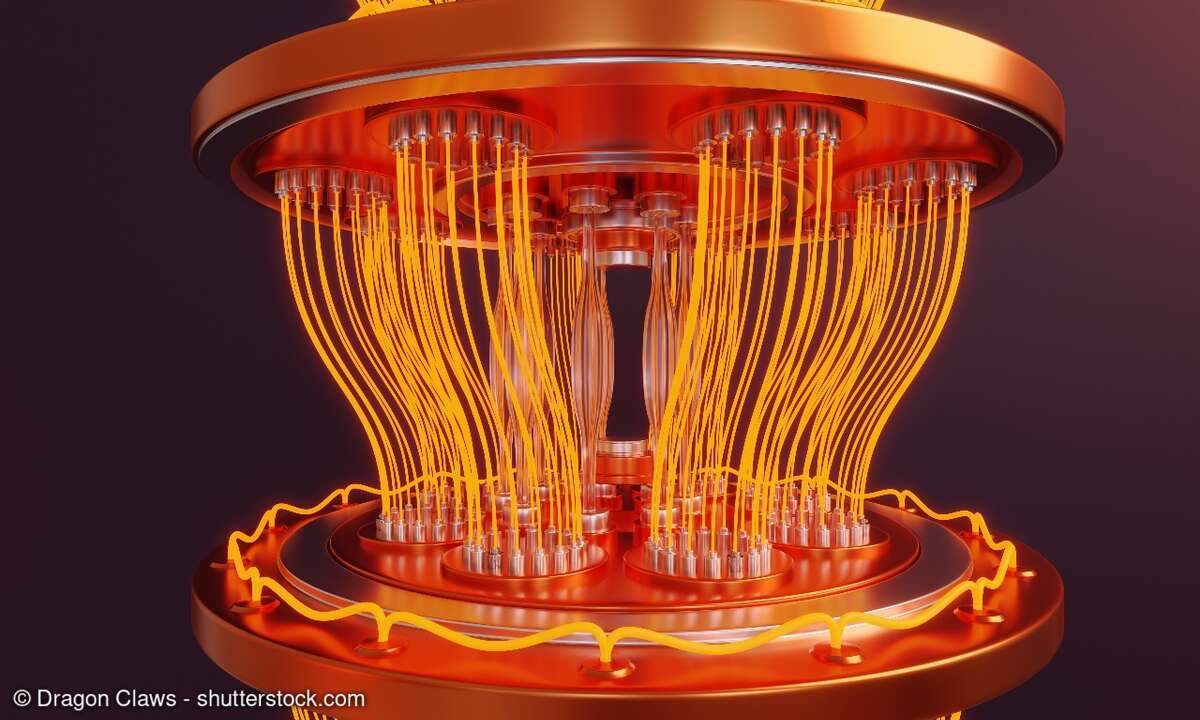Streitpunkt IP-Adresse
- Google Analytics geht Datenschützern gegen den Strich
- Streitpunkt IP-Adresse
- Indizwirkung
Unproblematisch und rechtlich einwandfrei ist zunächst einmal die Speicherung und Auswertung von Daten wie der Verweildauer eines Nutzers auf einer Internetseite und dessen Aktivitäten auf dieser Seite, wenn dazu keine personenbezogenen Daten erhoben werden, also keine Daten, die die Person, die hinter dem eigentlich anonymen Nutzer steht, identifiziert oder bestimmbar macht. Fraglich ist aber, ob neben diesen allgemeinen technischen Daten zusätzlich auch die Internet-Protocol- Adresse-(IP-)Adresse des jeweiligen Nutzers gespeichert werden darf. Die IP-Adresse dient der eindeutigen Adressierung von Rechnern und anderen Geräten in einem IP-Netzwerk und entspricht funktional somit der Telefonnummer in einem Telefonnetz.
Doch handelt es sich bei IP-Adressen überhaupt um personenbezogene Daten? Das Amtsgericht Berlin-Mitte und das Landesgericht Berlin bejahten diese Frage im vergangenen Jahr. Sie waren der Auffassung, dass durch eine IP-Adresse eine natürliche Person – gegebenenfalls unter Zuhilfenahme Dritter – bestimmbar ist. Das Amtsgericht Berlin-Mitte fällte dazu im März 2007 ein Urteil, dass vom LG Berlin ein halbes Jahr später im Wesentlichen bestätigt wurde. Nach wie vor bleibt die Einordnung der IP-Adressen als personenbezogene Daten jedoch juristisch umstritten und ist von Gerichten noch nicht endgültig geklärt. Die momentane Tendenz in der Rechtsprechung geht jedoch dahin, IP-Adressen tatsächlich als personenbezogene Daten aufzufassen.
Für jeden Betreiber einer Website, der Analyse-Software wie Google Analytics verwendet, ist freilich die Frage essenziell, welche Daten er von den Nutzern erheben darf und welche nicht. Grundsätzlich dürfen personenbezogene Daten immer dann verwendet werden, wenn der Betroffene einwilligt. Eine Einwilligung im juristischen Sinne liegt jedoch nur dann vor, wenn der Betroffene der Verwendung seiner Daten ausdrücklich vor der Erhebung und Verwendung seiner Daten zustimmt.
Es ist somit logisch: Wenn der Nutzer einer Website, zum Beispiel beim Aufruf der Seite, dazu aufgefordert wird, der Verwendung seiner Daten zu Analysezwecken zuzustimmen, dürfen zu diesem Zeitpunkt im Hintergrund noch keine personenbezogenen Daten gesammelt oder gespeichert werden. Außerdem muss die Einwilligung ausdrücklich erfolgen. Allein ein Hinweis auf der Homepage oder sogar nur in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), der Nutzer zeige mit der weiteren Nutzung der Website, dass er der Erhebung und Verwendung seiner Daten zustimmt, genügt somit nicht.