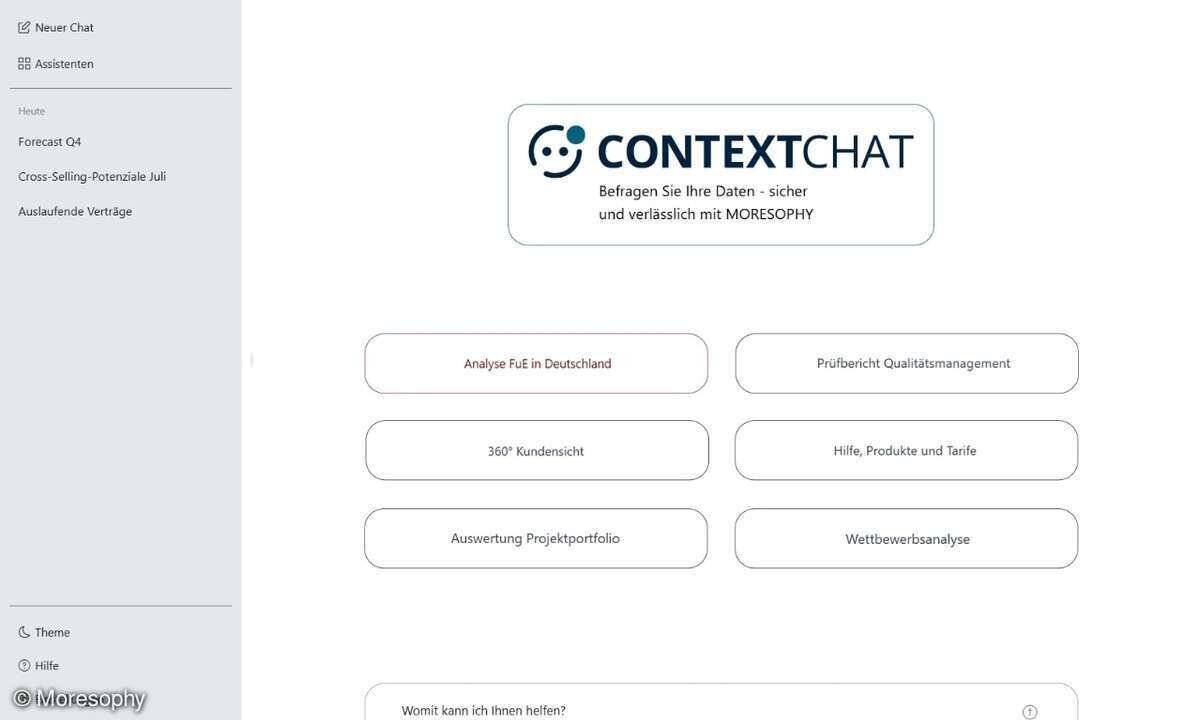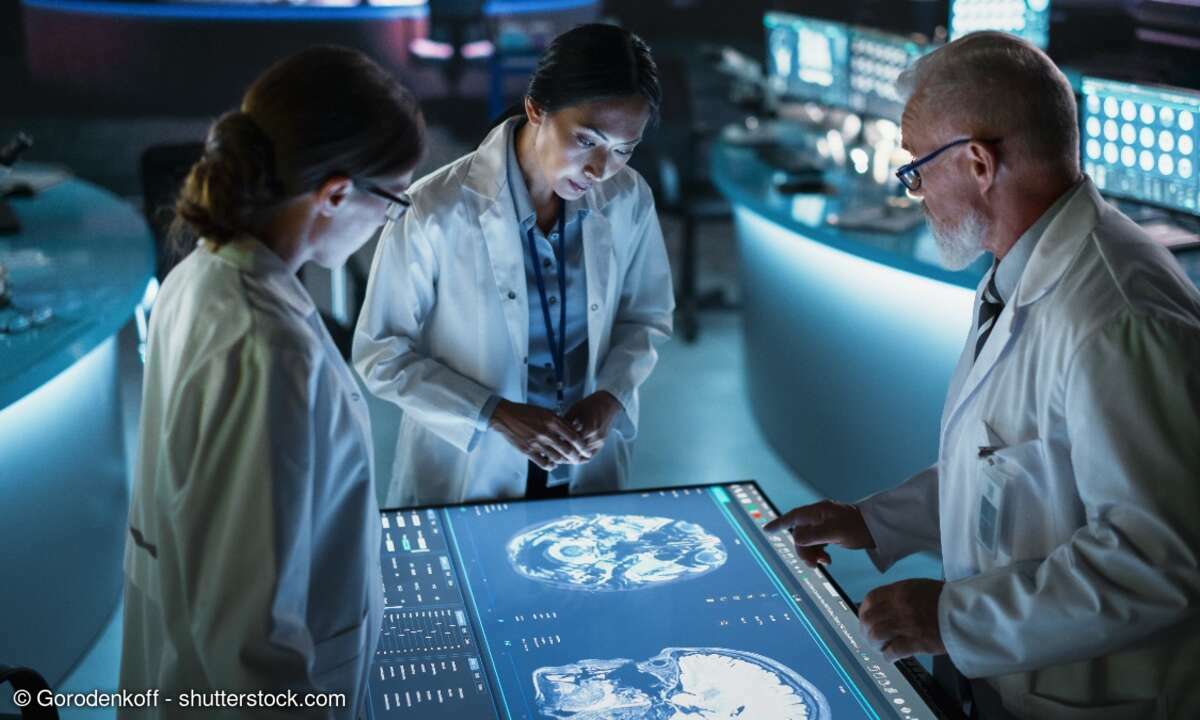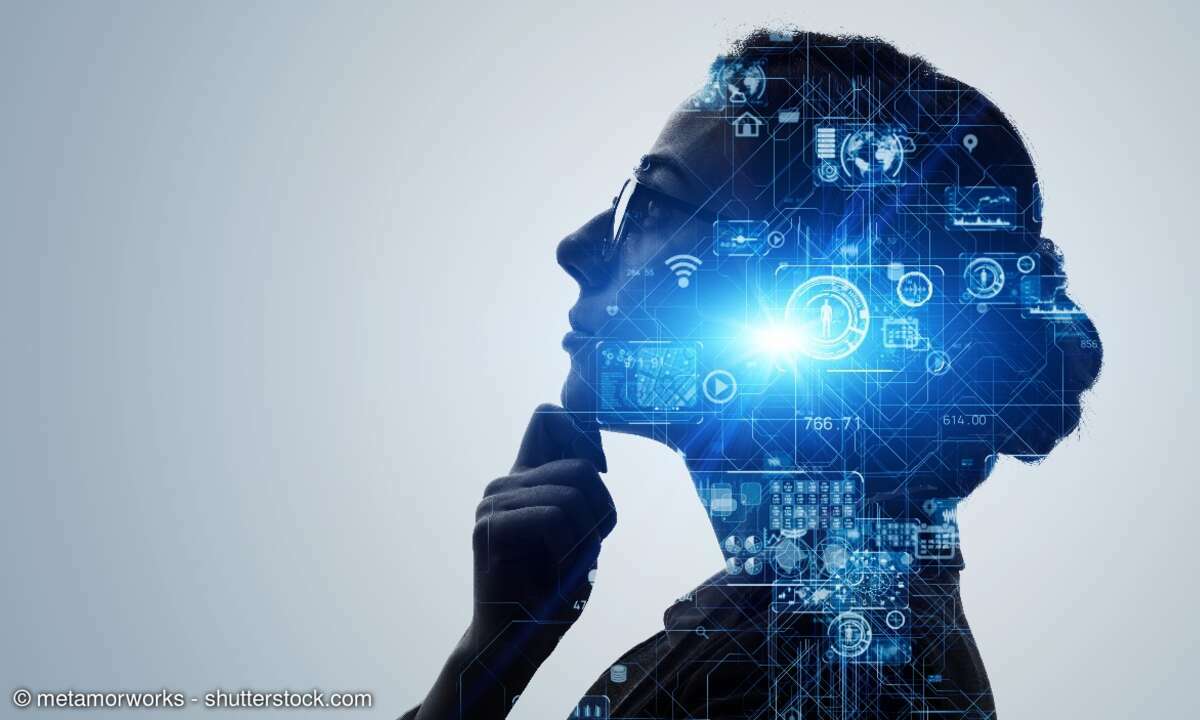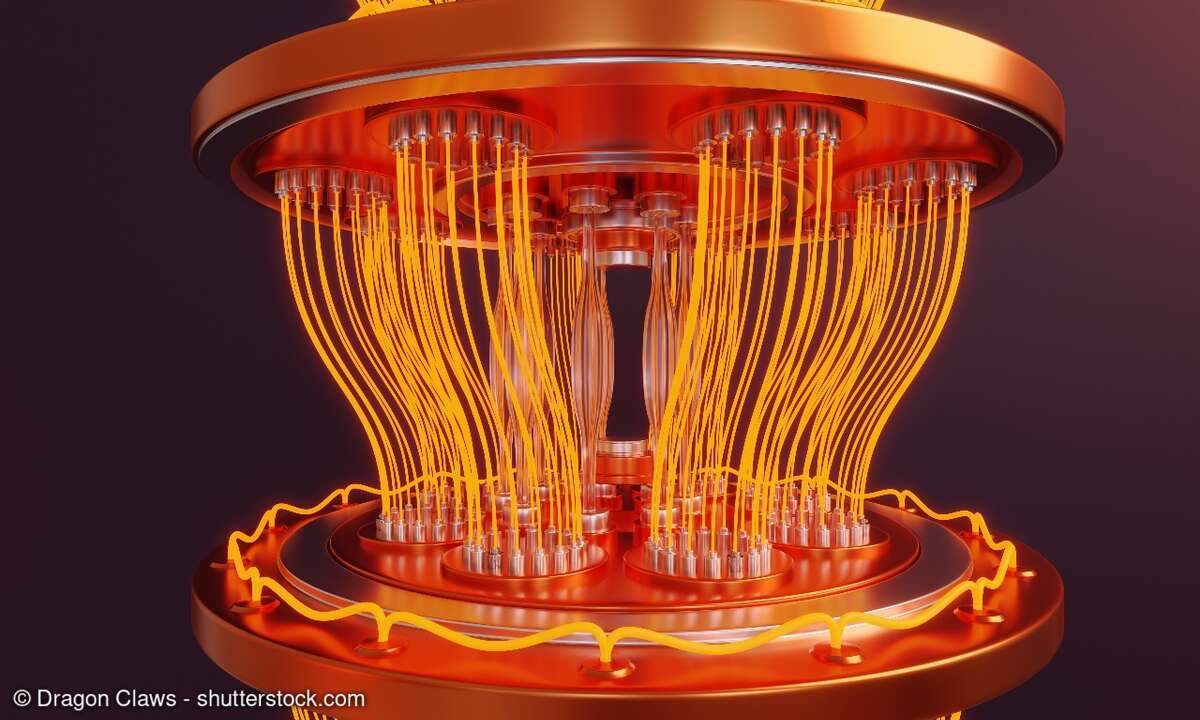Indizwirkung
§ 15 TMG sieht jedoch Ausnahmen vor, in denen die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten auch ohne ausdrückliche Einwilligung erlaubt ist. Etwa für Zwecke der Werbung, der Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung der Telemedien darf ein Diensteanbieter laut § 15 III TMG ausnahmsweise Nutzungsprofile erstellen, wenn er dabei Pseudonyme verwendet und sofern der Nutzer dem Verfahren nicht widerspricht. Dabei hat der Diensteanbieter jedoch den Nutzer auf sein Widerrufsrecht im Rahmen der Unterrichtung nach § 13 I TMG hinzuweisen. Außerdem dürfen diese Nutzungsprofile nicht mit den Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt werden. Der Diensteanbieter darf nach § 15 IV TMG außerdem Nutzungsdaten, also gerade auch personenbezogene Daten, über das Ende des Nutzungsvorgangs hinaus verwenden, soweit sie für Zwecke der Abrechnung mit dem Nutzer erforderlich sind.
Noch ist nicht abzusehen, wie sich weitere Gerichte zu dieser Thematik äußern. Einer endgültigen Klärung bedarf insbesondere die Frage, ob IP-Adressen personenbezogene Daten sind. Nach derzeitigem Stand muss davon ausgegangen werden, dass dem so ist. Folglich dürfen diese Daten tatsächlich nur innerhalb der engen Grenzen der Datenschutzgesetze, insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes und des hier vorgestellten § 15 Telemediengesetz erhoben und verarbeitet werden.
Darüber wird unter Juristen diskutiert, ob es für die Erhebung und Speicherung von IP-Adressen und weiteren personenbezogenen Daten möglicherweise zusätzliche, vom Gesetzgeber noch nicht bedachte Rechtfertigungsgründe gibt. Die könnten die Speicherung solcher Daten für besondere Zwecke, etwa für die Abwehr von Spam oder von Hackerangriffen auf die Internetseite, gestatten.
Für die beiden Berliner Gerichte stellen IP-Adressen personenbezogene Daten dar, die in aller Regel nur mit Einwilligung der Betroffenen erhoben werden dürfen. Das hat zur Folge, dass Analyse-Software wie Google Analytics und vergleichbare Tools nicht zur Analyse des Nutzungsverhaltens verwendet werden darf, wenn dabei auch die IPAdresse erfasst wird. Um weitestgehend rechtssicher zu handeln, sollten die Betreiber einer Internetseite darauf achten, dass die von ihnen verwendete Analyse- Software ihren Zweck erfüllt, ohne die IP-Adresse zu verwenden.
Die beiden Urteile der Berliner Gerichte haben allerdings keine allgemeine Gültigkeit, sondern sind nur zwischen den an den jeweiligen Verfahren beteiligten Parteien rechtswirksam. Von den Urteilen geht jedoch insofern eine Indizwirkung aus, als weitere Gerichte in künftigen Verfahren ähnlich urteilen könnten. Es stellt somit ein rechtliches Risiko dar, personenbezogene Daten wie IP-Adressen weiterhin im Rahmen von Nutzungs-Analyse- Software auszuwerten.
Den Betreibern von Internetseiten ist zu empfehlen, auf aktuelle Urteile zu achten, um die technische Gestaltung ihres Auftritts stets auf dem aktuellen rechtlichen Stand halten zu können.
______________________________
INFO
Der Autor
Max Lion Keller arbeitet als Rechtsanwalt in der Münchner Kanzlei Keller-Stoltenhoff, Keller, Münch, Petzold. Der Jurist hat sich auf IT-Recht spezialisiert.