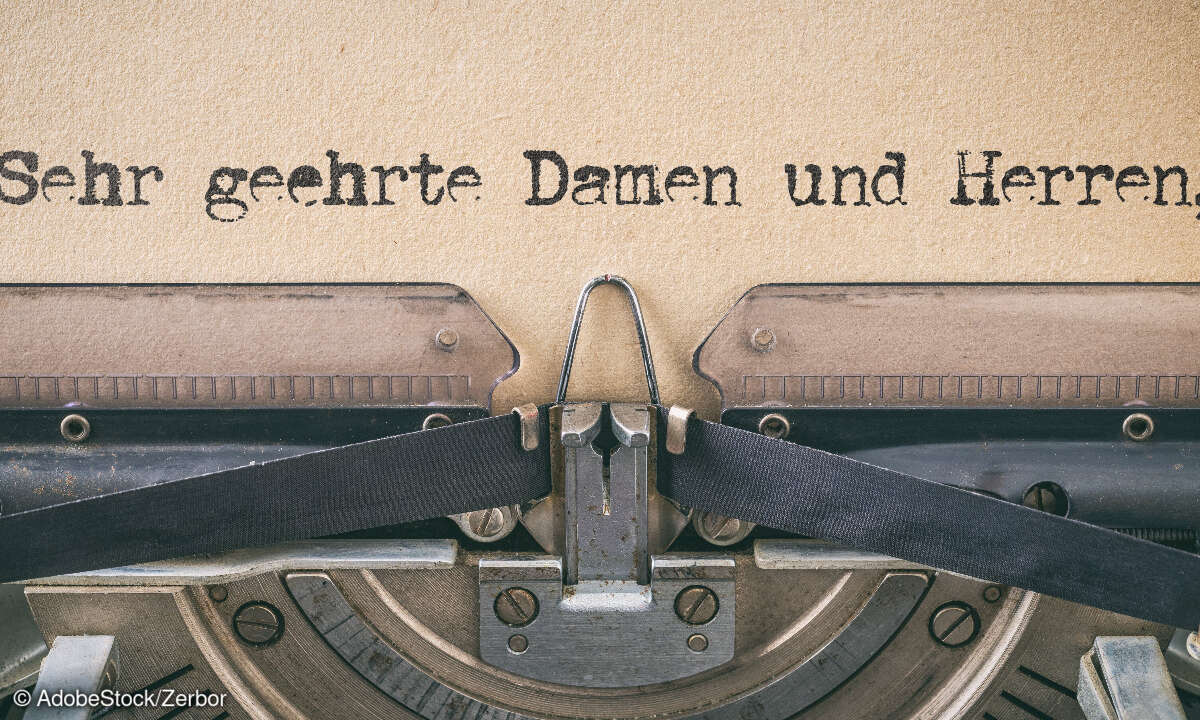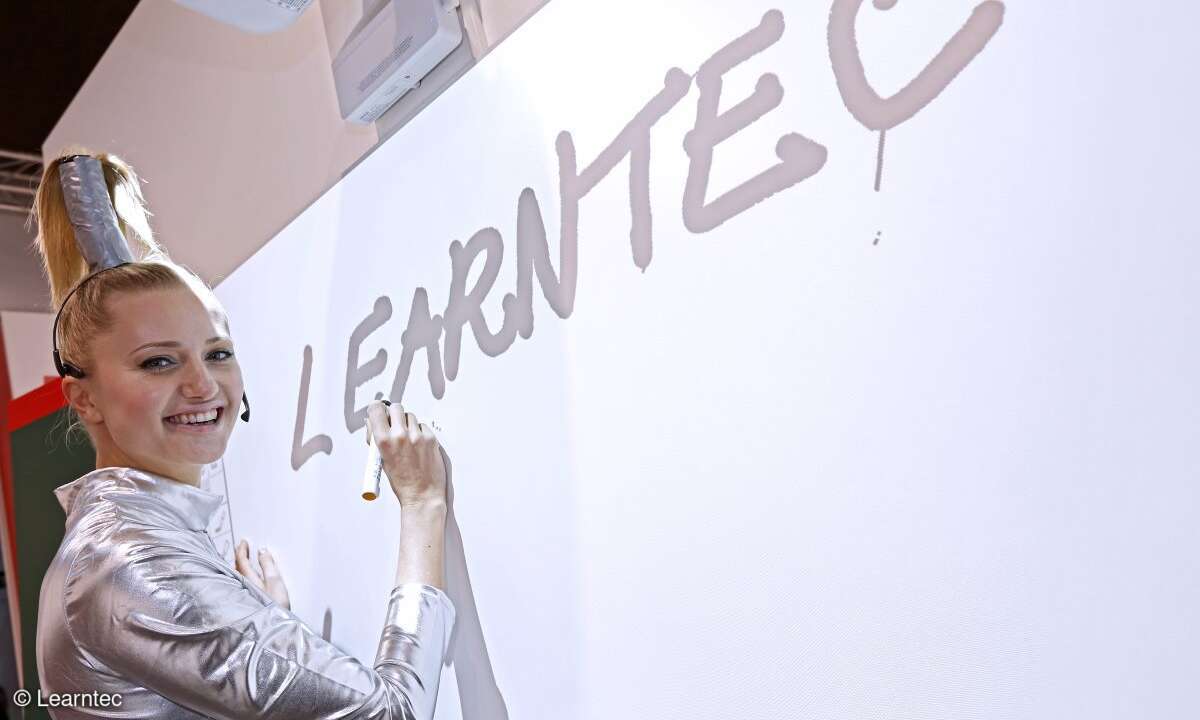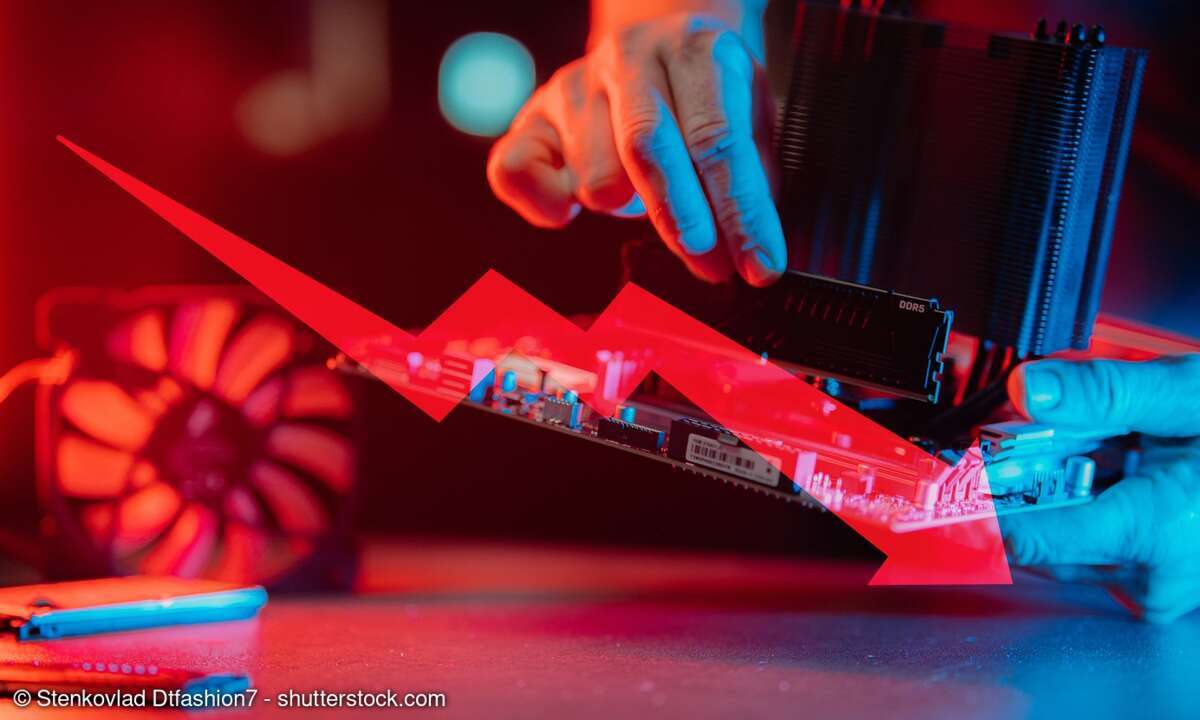Karlsruhe erlaubt Online-Durchsuchungen
Das Bundesverfassungsgericht hat den Einsatz von Spionagesoftware durch Sicherheitsbehörden nicht abgelehnt, aber an strenge Auflagen geknüpft. Eine flächendeckende Online-Durchsuchung ist somit kaum möglich. Datenschützer sprechen von einem Meilenstein der Rechtssprechung.
Mit seinem heutigen Urteil zur so genannten Online-Durchsuchung von Computern in Privathaushalten hat das Bundesverfassungsgericht der Politik und staatlichen Behörden enge Grenzen gesetzt. Karlsruhe hatte über entsprechende Vorschriften des Verfassungsschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen zu urteilen, gegen die mehrere Personen geklagt hatten. Kernaussage der Verfassungsschützer: Der Einsatz von Spionagesoftware ist grundsätzlich möglich, aber nur dann, wenn »tatsächliche Anhaltspunkte einer konkreten Gefahr für ein überragend wichtiges Rechtsgut bestehen« und diese durch eine richterliche Anordnung getroffen wird (Aktenzeichen: 1 BvR 370/07).
Insbesondere sieht Karlsruhe beim Einsatz eines so genannten »Bundestrojaners« gleich mehrere verfassungsrechtliche Bestimmungen verletzt. An erster Stelle eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, im Besonderen das Grundrecht auf Gewährung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Außerdem greife »das heimliche Aufklären des Internets« in das Telekommunikationsgeheimnis ein. Vorkehrungen zum Schutze des Eingriffs in den »absolut geschützten Kernbereich privater Lebensgestaltung« sehen die Verfassungsrichter als nicht gegeben an. Angesichts der schwere des Eingriffs durch Nachrichtendienste und Landesverfassungsschützer würden die Vorschriften aus NRW das Gebot der Verhältnismäßigkeit nicht wahren.
Ersten Stellungsnahmen zufolge begrüßen Datenschutzbeauftragte das Urteil. Der Sächsische Datenschützer Andreas Schurig spricht von einem »Meilenstein der Rechtssprechung« und einem »Sieg der verfassungsmäßigen Ordnung«. Sein Kollege aus Bayern, Karl Michael Betzl, dürfte, wenn er könnte, das Urteil ebenfalls positiv kommentieren. Betzl jedoch hat sein Amt ruhen lassen, weil sein Name auf den einschlägigen Listen potenzieller Steuerhinterzieher aufgetaucht ist, die Millionensummen in Liechtensteiner Stiftungen transferiert hatten.
Die politische Diskussion um Online-Durchsuchungen wird nach dem heutigen Urteil nicht verstummen. Stumm bleiben auch nicht die Hersteller von Antiviren-Software, die aus technischer Sicht in der Vergangenheit immer wieder die Grenzen des Einsatzes von staatlich legitimierter Spionagesoftware beschrieben haben. Denn zwischen »schlechten« und »guten« Trojanern können die Systeme der IT-Security-Unternehmen nur dann entscheiden, wenn ihnen Nachrichtendienste entsprechende Codes ihrer Spionagesoftware mitteilen würden. »Es ist unwahrscheinlich, dass die Behörden uns freiwillig mit Mustern ihrer Werkzeuge beliefern«, sagt Magnus Kalkuhl, Security-Experte von Kaspersky Lab. »Auf unsere Arbeit als Antiviren-Unternehmen wird die anhaltende Diskussion um den Bundestrojaner keinen Einfluss haben«.