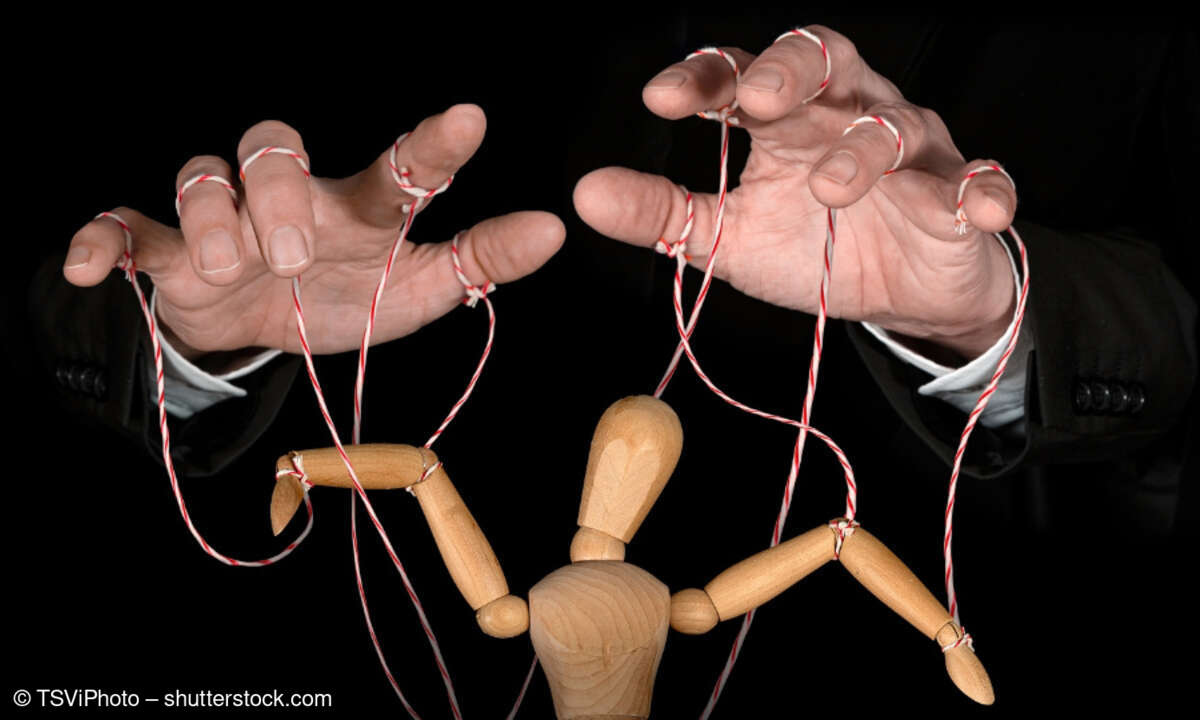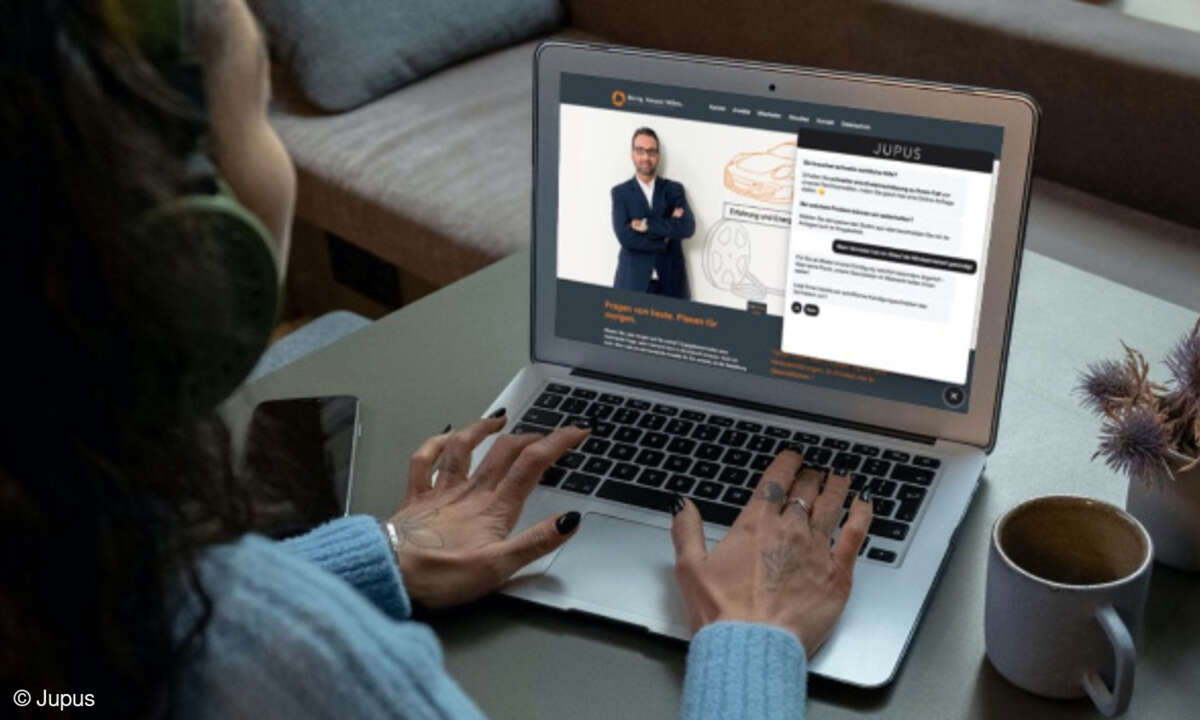Risikofaktor Opensource? Rechtliche und praktische Grundlagen der Benutzung von freier Software
Risikofaktor Opensource? Rechtliche und praktische Grundlagen der Benutzung von freier Software. Das Geschäft mit Opensource-Software boomt. Dennoch bestehen viele Bedenken und Vorbehalte gegen den Einsatz oder Vertrieb der freien Software. Diese Beitragsreihe beschäftigt sich mit den rechtlichen und praktischen Grundlagen der Nutzung von Opensource-Software. Mit diesem Grundlagenwissen sind Sie in der Lage, den eigenen Nutzen des Einsatzes von freier Software abzuschätzen, ohne sich dabei unnötigen Haftungsrisiken auszusetzen.
Risikofaktor Opensource? Rechtliche und praktische Grundlagen der Benutzung von freier Software
Autor: Dr. Jyn Schultze-Melling
Das am weitesten verbreitete Vorurteil gegenüber Opensource-Software ist der Verdacht, dass es sich hierbei um Public Domain Software und damit gewissermaßen ein rechtloses Gut handele. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall ? eine Software herrenlos zu machen, entspricht mitnichten der zugrunde liegenden Idee. Opensource-Programmierer verzichten nicht auf die Geltendmachung ihrer Urheberrechte, sondern gestalten diese nur in einer ganz speziellen Weise aus, indem sie denjenigen, die sich bestimmten Regeln unterwerfen, erlauben, die Software samt Quellcode zu verwenden, weiterzuentwickeln und zu verbreiten.
Opensource-Software ist also demnach entsprechend einem Ausdruck eines der Erfinder dieser Idee »free as in free speech, not as in free beer«. Opensource-Software darf also durchaus verkauft werden.
Nur bezahlt der Käufer den Kaufpreis nicht für die Software an sich, sondern für ihre jeweilige Zusammenstellung und die damit verbundene Arbeit, wie zum Beispiel im Falle der gängigen Linux-Distributionen.
Das Grundmodell ? die GNU General Public License
Die GPL war eine der ersten Opensource Lizenzen. Ihr Entwickler, der Amerikaner Richard Stallman, entwickelte sie zum Schutz der Idee freier Software und erlaubte allen, die sich an ihre Bedingungen hielten, die von ihm programmierte Software zu nutzen. Darüber hinaus darf jeder die Software kopieren und diese Kopien verbreiten, wenn die Copyright-Vermerke und der Lizenztext beigelegt werden. Schließlich darf die Software auch modifiziert werden, wenn dabei sichergestellt wird, dass alle Änderungen ersichtlich sind und die neue Software wieder unter die GPL lizenziert wird.
Grundvoraussetzung für all diese Rechte ist jedoch, dass der Quellcode der Software und im Falle von Modifizierungen auch der veränderte Quellcode frei zugänglich gemacht werden. Die gewährten Freiheiten verfallen demnach auch, wenn jemand den Quellcode für sich behält oder sich sonst nicht an die Bedingungen der GPL hält.
GLPG, BSD, Mozilla, Darwin und Co. ? die richtige Lizenz für jeden Anlass
Neben der GPL gibt es mittlerweile diverse andere Opensource-Lizenzen. Dazu gehören die GNU Lesser General Public License, die ausdrücklich gestattet, unter dieser Lizenz stehende Bibliotheken in proprietäre Software einzubinden. Andere Opensource-Lizenzen wie die BSD-Lizenz verfolgen denselben Ansatz wie die GPL, sind aber bei weitem nicht so streng und erlauben so zum Beispiel auch die Verbreitung der Software ausschließlich als Objektcode. Die Mozilla-Lizenz, die im Rahmen der Freigabe des Quellcodes des Netscape Communicator Browsers entstand, gewährt bei freier Verfügbarkeit über die Software auch eine Lizenzierung der teilweise verwendeten Quellen unter eine andere Lizenz. Selbst der Computerhersteller Apple hat den Kern seines Betriebssystems MacOS X unter dem Namen Darwin zum Teil unter eine eigene Opensource-Lizenz gestellt.
Die Vielfalt an Opensource-Lizenzen zeigt deutlich, dass für praktisch jeden Anwendungsfall eine passende Lizenz existiert. Welche Rechte und Pflichten im Detail bestehen, wird im nächsten Teil dieser Serie erläutert.
______________________________________________
Die neue Serie »Opensource«
Teil 1 ? Funktionsprinzip von Opensource-Software-Lizenzen
> Das Grundprinzip: Copyleft statt Copyright
> Das Grundmodell ? die GNU General Public License
> GLPG, Mozilla, Darwin und Co. ? die richtige Lizenz für jeden Anlass
Teil 2 ? Rechte und Pflichten beim Umgang mit Opensource-Software
> Welche Pflichten bestehen bei der Nutzung von OSS?
> Welche Pflichten treffen den Vertrieb von OSS?
> Welche Rechte hat jeder einzelne Programmierer freier Software?
Teil 3 ? Haftungsgefahren von Opensource-Software
> Wo lauern die rechtlichen Risiken beim Umgang mit OSS?
> Wer haftet wem für fehlerhafte OSS?
> Lässt sich die Haftung beim Vertrieb von OSS wirksam begrenzen?
Teil 4 ? Gewerblicher Rechtsschutz für Opensource-Software
> Durchsetzung von Ansprüchen gegen Lizenzverletzer
> Reagieren bei Abmahnungen
> Schutz eigener Entwicklungen im Zusammenhang mit OSS
____________________________________________
Dr. Jyn Schultze-Melling ist Rechtsanwalt und Spezialist für IT-Recht bei der Anwaltskanzlei Nörr Stiefenhofer Lutz