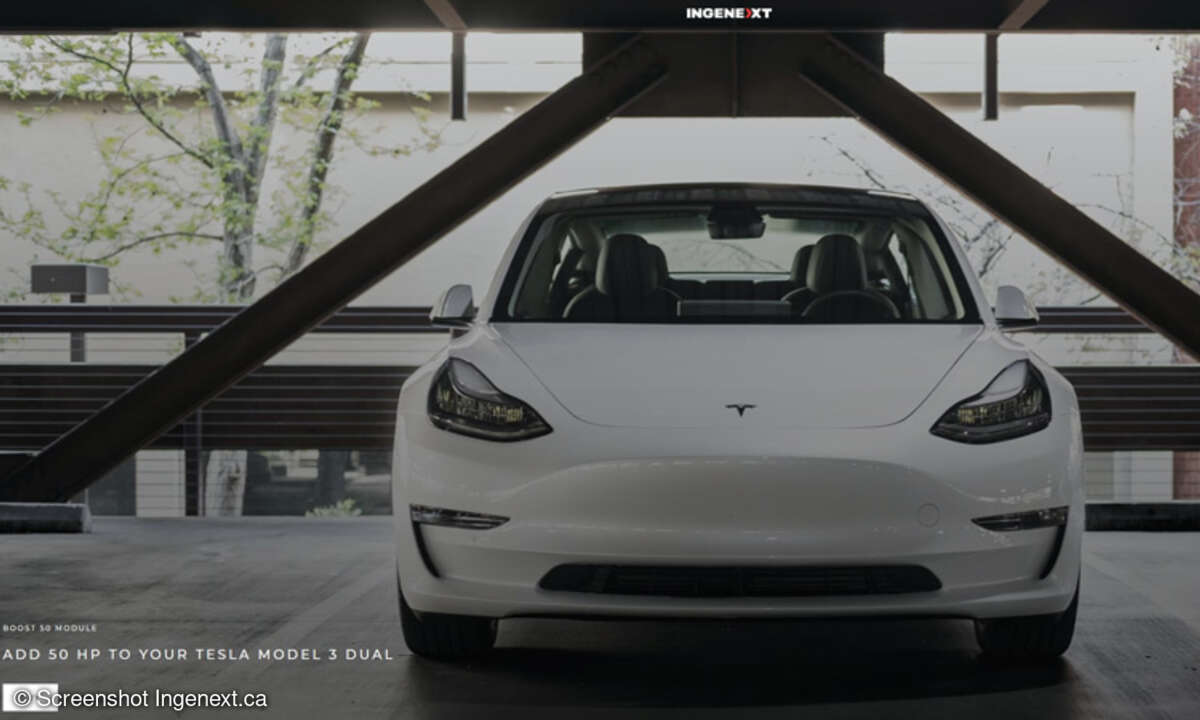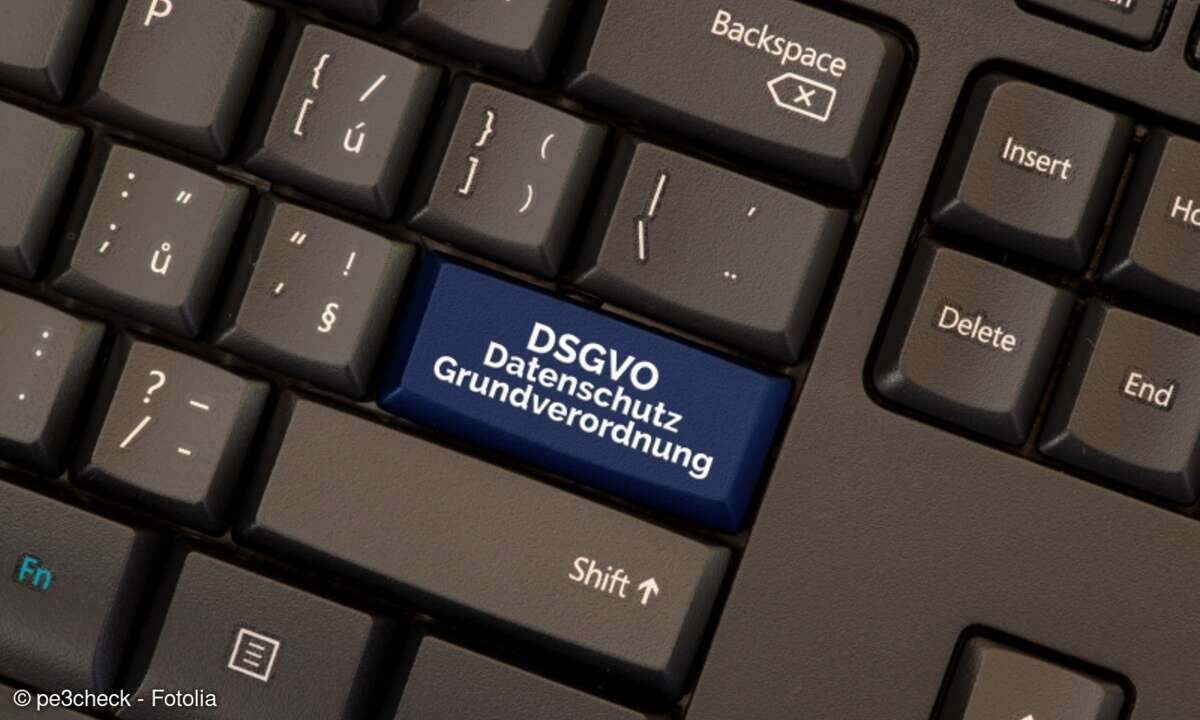Weiterverkauf kann nicht untersagt werden
- Verunsicherung bei Gebraucht-Software
- Verschwendung von Mitteln
- Weiterverkauf kann nicht untersagt werden
Das Landgericht Hamburg hat demgegenüber entschieden, Software dürfe second hand auch dann gehandelt werden, wenn sie mittels Masterdatenträgern und Volumenlizenzen geliefert wurde. Es hält die Norm des § 69c Nr. 3 UrhG in seiner konkreten Ausprägung in Teilen für überholt, von seinen Prinzipien her aber für anwendbar. Weil der Gesetzgeber seinerzeit die heutigen Entwicklungen nicht vorhergesehen hat, könne auch im Online-Zeitalter und beim Vertrieb mittels Masterdatenträger auf das Prinzip zurückgegriffen werden, dass der Weiterverkauf der Software nach erstmaliger Vergütung des Softwareherstellers urheberrechtlich nicht untersagt werden kann. Das Landgericht Hamburg wendet insofern für den Handel den § 69c Nr. 3 Satz 2 UrhG analog an. Die entsprechenden Befugnisse zur Nutzung der Software erhalte der Anwender sodann aufgrund von § 69d Abs. 1 UrhG. Interessant ist, dass das LG Hamburg betont hat, dass der Schutz von Rabatten kein Anliegen des Urheberrechts sei. Bisher weitgehend unbeleuchtet geblieben ist die Frage, inwieweit Übertragungsverbote – gerade marktmächtiger Unternehmen – überhaupt wirksam sind, ob Hersteller nicht zumindest verpflichtet wären, Anfragen zur Übertragung positiv zu bescheiden, beziehungsweise ob eine Zustimmung zur Übertragung der Lizenz nach § 34 UrhG überhaupt erforderlich ist. In der Praxis herrscht vor diesem ungeklärten Hintergrund eine Unsicherheit, die sich frühestens legen wird, wenn der Bundesgerichtshof sich mit den Fragen beschäftigt hat oder wenn der Gesetzgeber tätig geworden ist. Derweil ist Folgendes zu beachten: – Grundsätzlich könnten Unternehmen schon beim Kauf entsprechender Software versuchen, das Recht zum Weiterverkauf explizit eingeräumt zu bekommen oder zumindest auf ein Recht zur Auslieferung von einzelnen Datenträgern pro Lizenz zu drängen. In der Praxis werden sie hiermit bei den Marktgrößen kaum durchdringen. Wenn der Markt funktionierte, sähe dies vielleicht anders aus. Die Erfahrung zeigt auch, dass kleinere Hersteller eher gewillt sind, dem Weiterverkauf von Software zuzustimmen. Sie fürchten nämlich um den Verlust von potenziellen, künftigen Kunden, wenn sie nicht zustimmen. Die marktmächtigen Hersteller aber prognostizieren den Verlust von Neukunden gerade bei der Zustimmung zum Lizenztransfer. – Der Second-hand-Erwerb von Software, bei der der Anwender auf permanente Updates angewiesen ist, welche nur auf Basis eines laufenden Pflegevertrags zu erhalten sind, ist in besonderem Maße zu hinterfragen. Denn fest steht, dass der Hersteller zumindest einer Übertragung der Pflegevereinbarung zustimmen müsste. Ob er hierzu juristisch gezwungen werden kann, ist von den Gerichten bisher noch nicht einmal ansatzweise diskutiert worden. – Beim Lizenzaudit durch Hersteller hat der Zweiterwerber nachzuweisen, wie sich seine Rechte vom Hersteller ableiten lassen. Dazu muss er zumindest darlegen können, dass der Ersterwerber die Rechte wirksam erworben hat. Hierfür trifft den Zweiterwerber und nicht den Hersteller die volle Beweislast. Der Hersteller wird aber kaum bestreiten können, die Lizenzen seien zumindest vom Ersterwerber wirksam erworben worden, sofern dieses so ist. Daher sollten zumindest dieser sowie die zugehörigen Lizenzdetails (Lizenznummer et cetera) auch dem Zweiterwerber bekannt sein. – Ein Notartestat, wie es teilweise im Markt angeboten wird, kann dieses Wissen ebenso wenig ausgleichen, wie es die rechtlichen Unsicherheiten beseitigen kann. Der Zweiterwerber sollte daher darauf drängen, dass der Hersteller in den Lizenztransfer eingebunden und unter anderem über die Transferdetails informiert wird.
Malte Grützmacher ist Fachanwalt für Informationstechnologierecht und Partner bei CMS Hasche Sigle in Hamburg.