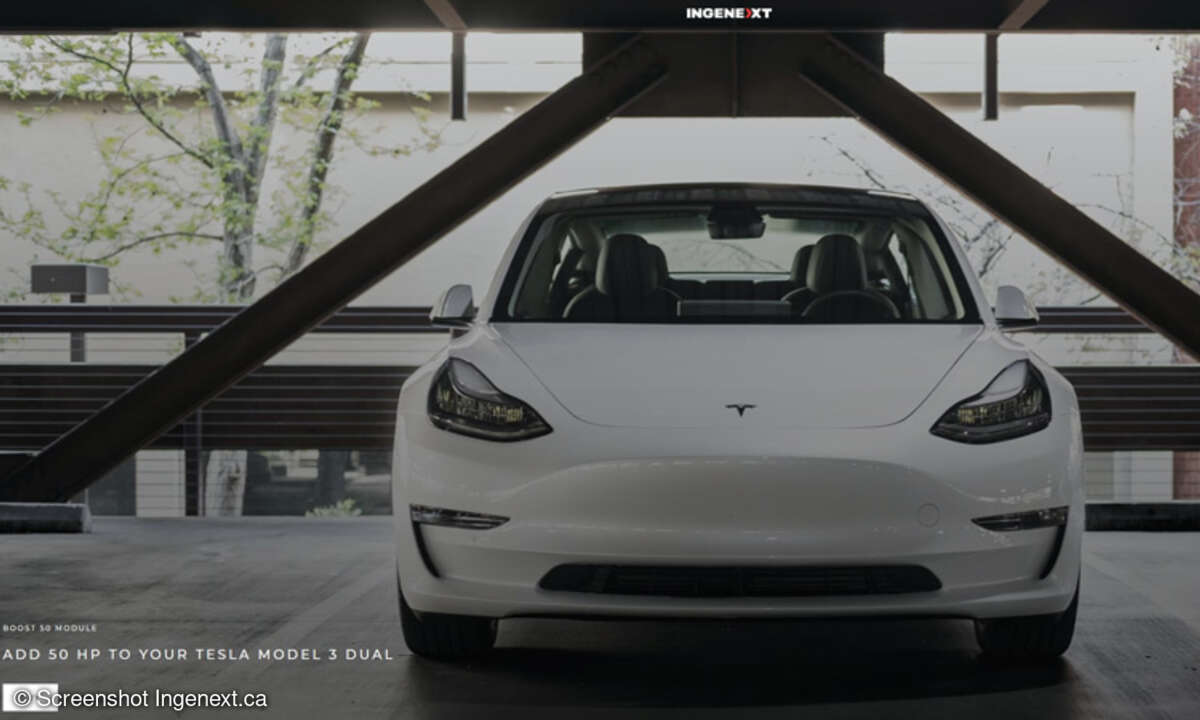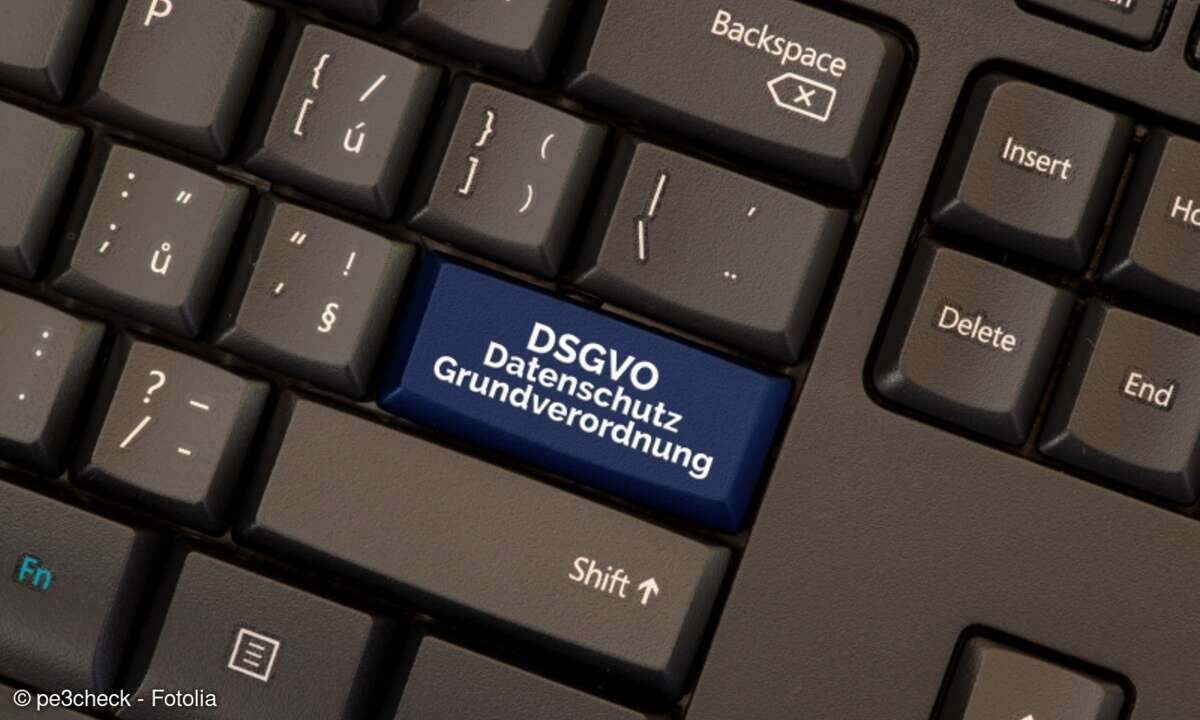Verschwendung von Mitteln
- Verunsicherung bei Gebraucht-Software
- Verschwendung von Mitteln
- Weiterverkauf kann nicht untersagt werden
Als Jurist wird man zumindest von Kollegen schnell abgekanzelt, wenn man Software mit Autos vergleicht. Aber welcher Softwarehersteller fände es schon gut, wenn er seinen hoch rabattierten Fuhrpark (etwa für seine Vertriebsmitarbeiter) nicht weiter verkaufen könnte? Warum allerdings sollte Software insofern gegenüber Autos privilegiert werden? Die Frage, inwieweit Software handelbar ist, bestimmt, in welchem Umfang Ressourcen genutzt beziehungsweise wieder liquidiert werden können. Aus der Sicht einzelner Anwenderunternehmen führen Handelsrestriktionen für Gebrauchtsoftware zu einer Verschwendung von Mitteln. Technisch ließe es sich im Übrigen auch bei Kraftfahrzeugen, die heute mit Software in Boardcomputern, Navigationssystemen, Motormanagementsystemen und sonstiger Elektronik überfrachtet sind, sicher einrichten, dass diese zentral nach der Auslieferung eingespielt würde. Folgte man der Argumentation von Softwaregrößen wie Microsoft und Oracle, wären derartige Autos nicht mehr ohne Zustimmung der Hersteller weiterverkäuflich. Allerdings ist ein derartiges Szenario nicht zu befürchten. Denn der Automobilmarkt funktioniert als solcher. Er kennt keine marktmächtigen Unternehmen, die es sich leisten könnten, ihren Kunden den Weiterverkauf zu verweigern. In einem unvollkommenen Markt hingegen, auf dem nur ein eingeschränkter Wettbewerb herrscht, besteht die Gefahr, dass es, zumal wenn damit eine Preisdifferenzierung geschützt wird, zu einer Ausnutzung von Monopolpreisen durch den Softwarehersteller kommt. Fairerweise muss man aber auch attestieren, dass ein Kfz beim Weiterverkauf – anders als Software – auch einen echten Materialwert hat und dass Softwarehersteller ein Interesse daran haben, nachvollziehen zu können, ob eine ja bloß immaterielle Lizenz eigentlich wirklich besteht oder nur behauptet wird. Ganz so einfach sind die Dinge also nicht. Das gilt auch fürs Juristische. Die Rechtslage wird in Deutschland seit geraumer Zeit äußerst kontrovers diskutiert. Das Landgericht und das Oberlandesgericht München haben auf Antrag von Oracle entschieden, dass Software nicht losgelöst vom Originaldatenträger weiterverkauft werden darf – jedenfalls nicht ohne die Zustimmung des Anbieters. Das soll auch dann gelten, wenn der Anbieter durch den ersten Kauf bereits entlohnt worden ist. Das Oberlandesgericht München stellte klar, dass der Verkauf »gebrauchter« Software nicht mit dem Handel mit gebrauchten Autos verglichen werden könne. Nach Ansicht der Münchner Gerichte ist das nach dem Urhebergesetz bestehende Verbreitungsrecht des Anbieters nur verbraucht, wenn er die Software auf CD oder DVD verkauft hat und diese so auch weiter verkauft wird. Nur ist diese Vertriebsform und der sie begleitende urheberrechtliche Grundsatz, welcher für Bücher und Musik-CDs passt, heute angesichts einer zunehmenden Virtualisierung weitgehend antiquiert. Im Internet-Zeitalter scheinen die Münchner Gerichte noch nicht angekommen zu sein.