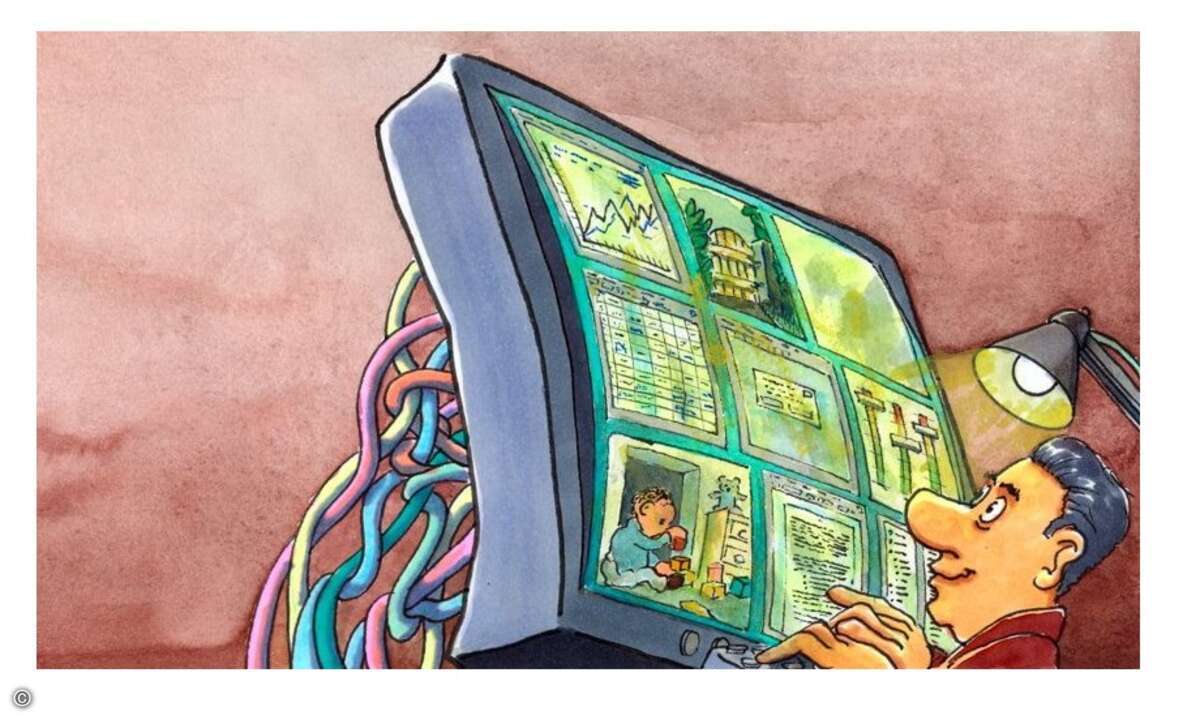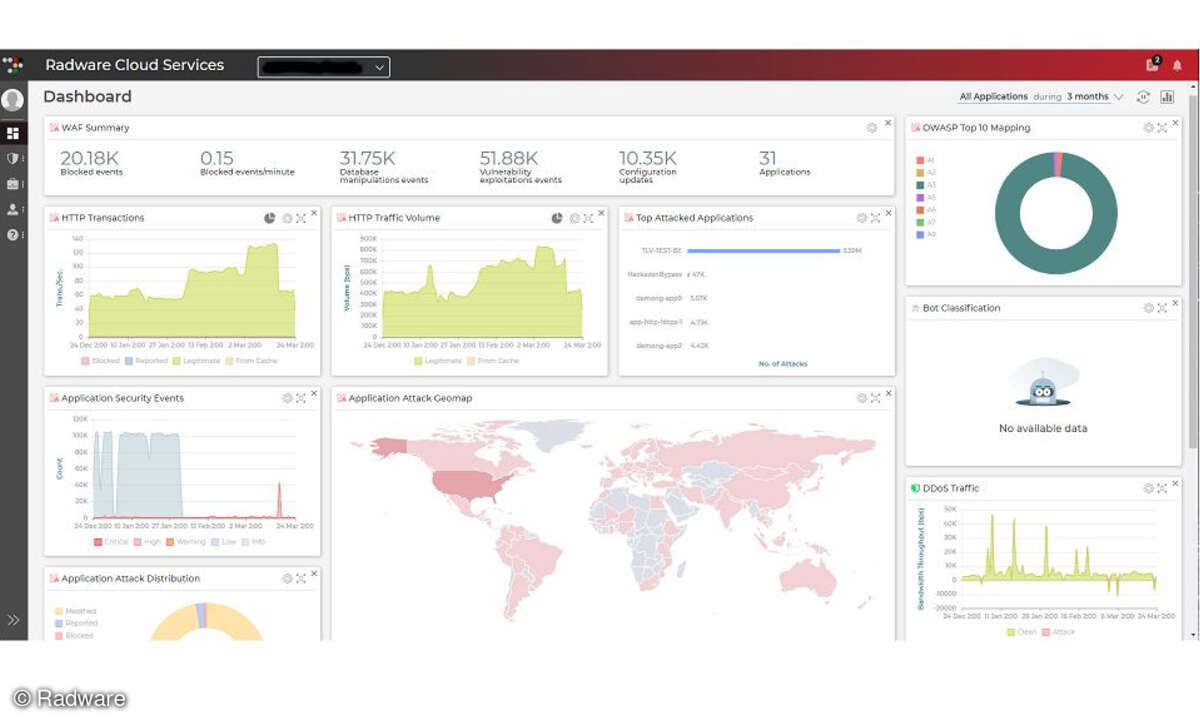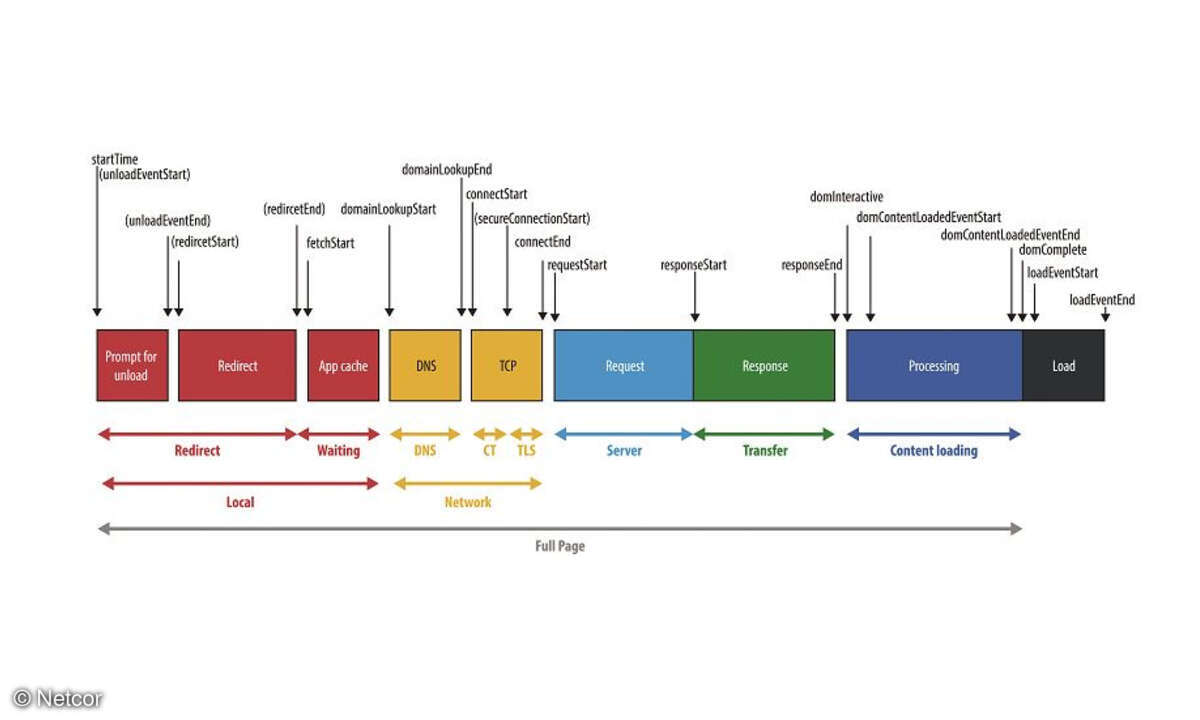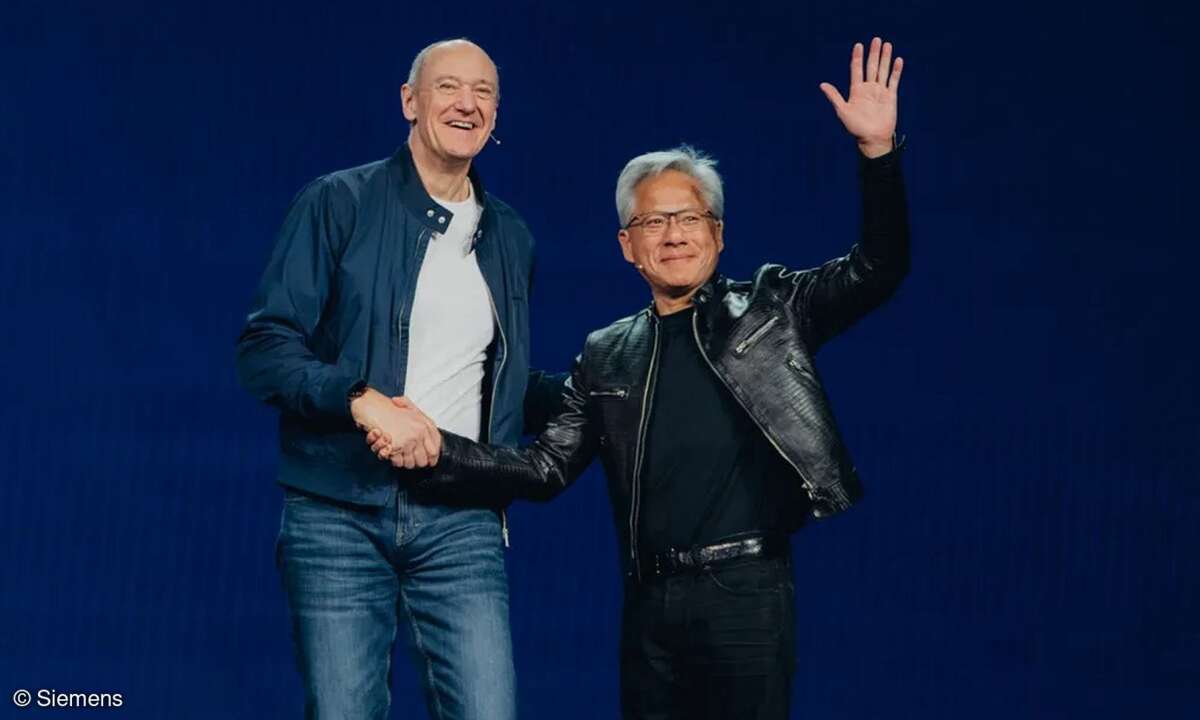Anwendungen: Virtualisieren oder in die Cloud verschieben?
Auch wenn die großen Cloud-Anbieter gerne das Image von perfekten Plattformen für alle Arten von Anwendungen suggerieren möchten: Noch steckt Cloud-Computing in den Kinderschuhen. Trotzdem erwägen viele CIOs die Stufe der Virtualisierung zu überspringen und gleich auf interne und externe Cloud-Plattformen umzusteigen.
Cloud-Computing ist in aller Munde. Die Werbe- und PR-Trommeln von IBM, Microsoft, HP, Sun,
Salesforce, Amazon und Google laufen auf Hochtouren und versprechen den IT- und Business-Chefs
genau das, was diese sich schon immer erträumt haben: Alle Probleme werden ausgelagert, nur die
Nutzungsvorteile verbleiben in den eigenen Räumen. Oder anders gesagt: Nur noch ernten – ohne säen
zu müssen.
Doch die Realität sieht gegenwärtig noch ganz anders aus: "Die Plattformen für Cloud-Computing
stecken bislang in den Kinderschuhen und benötigen noch mindestens sechs bis sieben Jahre, bis sie
ausgereift sind", meint beispielsweise Gartners Vice President Mark Driver.
Weitere Infos zum Thema:
Dass die Cloud-Nutzung noch in der Anfangsphase steckt, erkennt man auch an den zurückhaltenden
Äußerungen und Vorsichtsmaßnahmen der Großunternehmen. "Wir experimentieren noch damit; es ist eine
steile Lernkurve", meint Tim Stanley, CIO bei der Hotel & Casino Kette Harrah?s, die immer mehr
Kundendaten und Anwendungen auf die Force-Plattform von Salesforce verlagert. Auch der
Salesforce-Vorzeigekunde, die Citibank in New York, will sich noch nicht ganz in die Abhängigkeit
der Salesforce-Wolke begeben. Zum einen sind bislang nur zeitunkritische Backoffice-Anwendungen
ausgelagert, zum anderen erfolgt das Hosting in einer Form, die eine kurzfristige Rückkehr zur
In-House-Lösung ermöglicht, sollte es einmal mit der Zuverlässigkeit der IT-Wolke zu sehr
hapern.
Zwar wollen die Mega-Cloud-Provider, wie Microsoft, Salesforce, Amazon und Google das Gegenteil
suggerieren, doch selbst sie können den Markt nicht vollends abdecken – und schon gar nicht alle
Sicherheitsbedenken ausräumen.
"Das Potenzial der Cloud-Nutzung, sowie die vielen damit verbundenen Probleme sind ganz breit
gefächert – selbst die großen Anbieter können das unmöglich alles alleine adressieren", sagt Sergej
Beloussov, CEO von Parallels, einem weltweiten Anbieter von Infrastruktursoftware für
Cloud-Service-Provider (CSP). Seiner Einschätzung nach bietet sich der Einstieg in ein
Cloud-Angebot vor allem bei den bisherigen Internet-Service-Providern (ISVs) an, die damit
wesentlich mehr Umsatz pro Kunde generieren und gleichzeitig ihre Infrastruktur besser ausnutzen
können. Laut Beloussov können es auch die kleineren ISVs durchaus mit ihren großen und allseits
bekannten Konkurrenten aufnehmen. "Wichtig ist vor allem, dass die ISVs bei einer Ausweitung ihres
Angebots sich auf erprobte Standardsoftware stützen und auf keinen Fall versuchen, das Rad neu zu
erfinden", so sein Rat. Damit meint er beispielsweise die Entwicklung einer Abrechnungssoftware für
eine On-Demand-Anwendung. Davon gibt es bereits eine Vielzahl erprobter Lösungen im Markt,
inklusive der Parallels-Software Plesk Billing 6.0.
Gartners Driver sieht außer den ISVs noch eine andere wichtige Anbietergruppe am Cloud-Horizont
aufziehen: "Für die IT-Chefs sind gegenwärtig alle Tools von Bedeutung, die eine schnelle
Anwendungs-Entwicklung erlauben und mit denen sie den Fachbereichen in kürzester Zeit Ergebnisse
liefern können. Von Vorteil sind deshalb alle Anbieter die ein spezielles Branchen-Know-how
mitbringen", so Driver. Diese neue Cloud-Anbietergruppe kommt zumeist aus dem Channel und versucht
jetzt mit gehosteten Lösungen den Umsatzrückgang bei den Lizenzerlösen aufzufangen.
Doch nicht nur Unternehmen mit vertikalem Spezialwissen drängen in das Cloud-Angebot. Auch
systemorientierte Querschnittsanbieter haben sehr gute Chancen. Hierzu gehören unter anderen die
beiden Storage-Provider Parascale und Nirvanix; der Startup Kaavo, der an einer herstellerneutralen
"Middleware on Demand" bastelt; außerdem die von ehemaligen Web-Methods-Managern gegründete Appirio
sowie der System-Management-Spezialist Elastra. Letzterer ist genau auf dem Gebiet aktiv, das viele
IT-Chefs derzeit besonders beschäftigt: "Soll ich statt einer weiteren Virtualisierung nicht lieber
gleich alle Anwendungen in eine eigene, so genannte private, Cloud verschieben?"
In der Tat gehen viele Experten davon aus, dass die gegenwärtige Virtualisierungswelle in den
Rechenzentren nur eine Übergangsphase darstellt. "In fünf bis zehn Jahren wird ein großer Teil der
Unternehmen die gesamte IT-Infrastruktur in die Cloud verschoben haben", meint beispielsweise Chris
Barbin, CEO bei Appirio, der zuvor Senior Vice President für Global Customer Service bei
Web-Methods war. Sein 100-Mitarbeiter starker Startup hat sich auf die Umstellung von
In-House-Lösungen auf Cloud-Services spezialisiert. "Mit unserer Unterstützung können unsere Kunden
die immer komplexer werdenden Probleme bei der Virtualisierung überspringen und sich wesentlich
stärker auf die Nutzung und die Entwicklung von Anwendungen konzentrieren", lautet sein
Versprechen.
In der Mitte zwischen einer In-House-Virtualisierung und einem vollständigen Auslagern sind die
privaten Clouds. Diese stellt die IT-Abteilung bereit; sie verhalten sich genauso wie eine externe
(öffentliche) Cloud, ohne dass jedoch die Daten und Programme die eigene Infrastruktur verlassen
müssen. Das heißt, es bleibt alles geschützt hinter der Firewall. Maximum-ASP ist ein Anbieter
solcher Technologien. Deren IT-Infrastruktur setzt zunächst auf Microsofts Hyper-V auf und
integriert Citrix-Applikationen, SAN-Storage, Backups sowie Clustering für hochverfügbare
Anwendungen. Damit kann eine leistungsstarke interne Cloud angelegt werden, die wie ein einziger
virtueller Mega-Server gemanagt wird.
Bei den vielen Problemen, die dem Cloud-Computing noch anhaften, stehen die Bereiche Sicherheit
und Zuverlässigkeit an oberster Stelle. Dies betrifft nicht nur die übliche Anfälligkeit der
IT-Systeme gegenüber Datenverlust und Datendiebstahl, sondern vor allem Vorkehrungen zum
Desaster-Recovery. Es reicht nicht aus, zu meinen, dass eine ausgelagerte IT bei der Zerstörung des
eigenen Rechenzentrums verschont bleibt, sondern es muss darüber hinaus vertraglich geregelt sein,
dass auch der Cloud-Provider Daten und Anwendungen in einem räumlich weit entfernten Rechenzentrum
spiegelt. Bei der Zuverlässigkeit der Cloud-Lösungen ist vor allem die Netzübertragung ein Problem.
Der Cloud-Provider kann kein Service-Level-Agreement (SLA) eingehen, da er keinen Einfluss auf den
ISV des Kunden hat. Nur Großkunden mit einem entsprechenden SLA mit einem Netz-Provider können hier
sicher sein, dass die Verfügbarkeit ausreichend abgesichert ist. Für die kleinen und mittleren
Unternehmen gibt es vorläufig keine befriedigende Lösung für dieses Problem. Zur Lösung wird
derzeit an zwei Fronten gearbeitet: Erstens, neue Protokolle sollen die Übertragung beschleunigen,
sodass Netzschwächen weniger Auswirkungen auf die Performance haben. Zweitens: Verschiedene
Provider unterstützen die Anstrengungen der großen US-Telekommunikationsunternehmen, die
Internet-Neutralität abzuschaffen. Dann könnte ein CSP einen Prime-Service ordern, bei dem der
TK-Provider dem CSP einen Service-Level für das Durchreichen der Daten garantiert. Diese Garantie
kann der CSP dann an seine Kunden weiter reichen.
Harald Weiss/dp