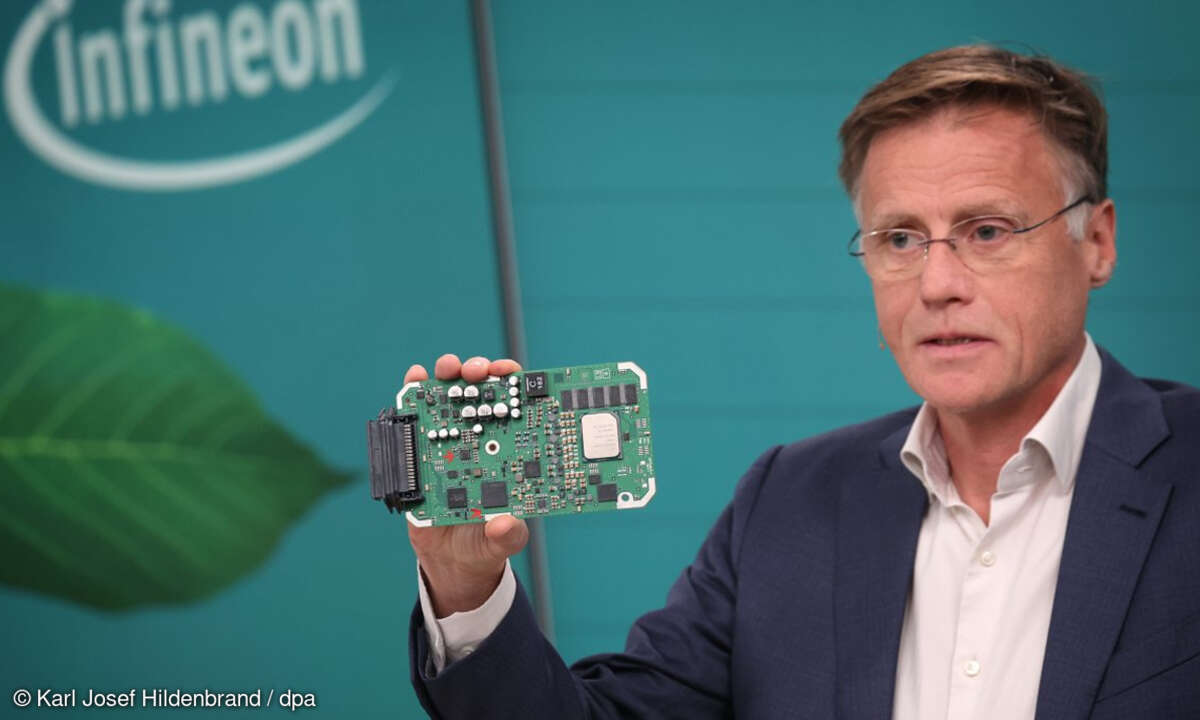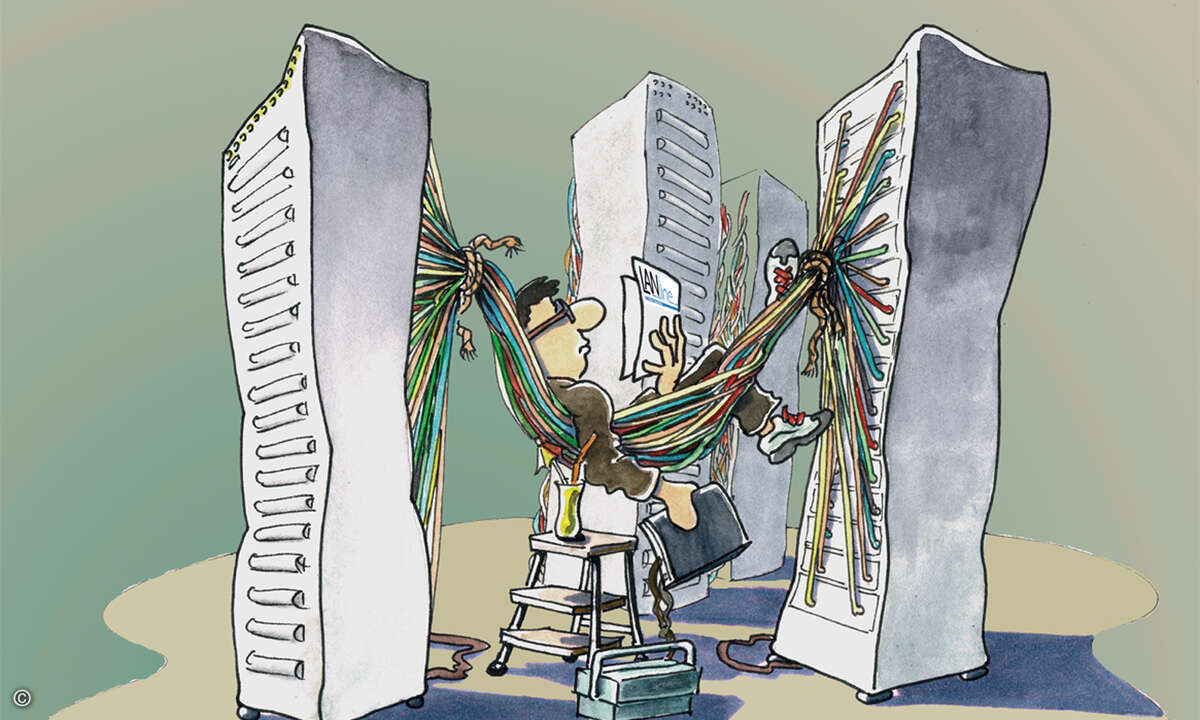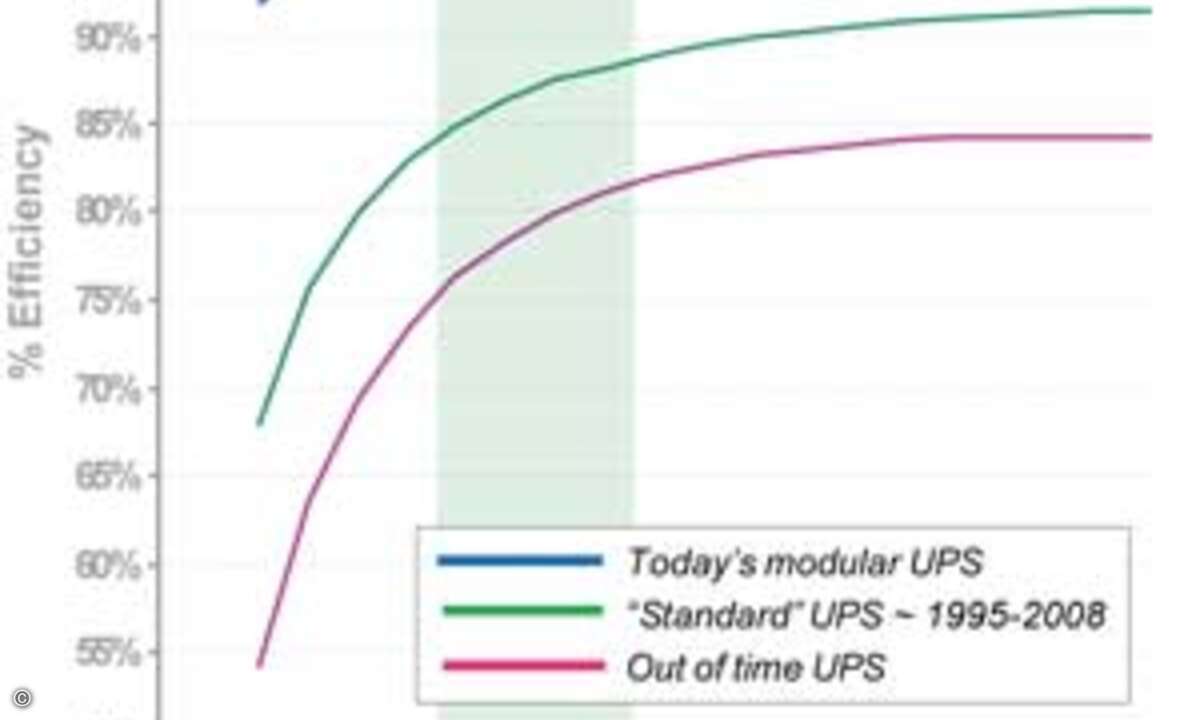Auf klarer Datenbasis nachhaltig wirtschaften
Green IT war vor der Wirtschaftskrise das bestimmende Thema der Hightech-Branche. Jetzt ist erst einmal wieder Sparen angesagt. Doch man muss dabei nicht alle guten Umweltvorsätze vergessen - zumal sich die Green-IT-Debatte stets um das Energiesparen als Schnittmenge zwischen Ökologie und Ökonomie dreht: Eine gezielte Analyse kann helfen, den CO2-"Footprint" (Gesamtausstoß) eines Unternehmens zu senken - und dabei gleichzeitig auch noch Geld zu sparen.
Mit dem Begriff "Green IT" wurde lange Zeit vor allem neue Hardware in Verbindung gebracht, zum
Beispiel sparsamere Prozessoren und effizientere Kühlung. Auch die Frage, wie viel ein Monitor oder
ein Netzteil im Standby-Betrieb verbrauchen darf, wurde diskutiert. Vor dem Hintergrund der
Finanzkrise verlagerte sich das Augenmerk der Unternehmen auf Maßnahmen, die kurzfristig Energie
und damit Kosten sparen. Auch Kleinigkeiten sparen zweifelsohne Energie; allerdings birgt ein
Sammelsurium von Einzelmaßnahmen die Gefahr nur geringer Optimierungseffekte, während an anderer
Stelle vielleicht viel größere Potenziale schlummern.
Klarheit bringt nur eine systematische Herangehensweise, die mit einer umfassenden
Bestandsaufnahme beginnt. Im besten Fall lassen sich dann Maßnahmen einleiten, die gleich doppelt
gewinnbringend sind, indem sie sowohl die langfristige Nachhaltigkeitsstrategie unterstützen als
auch eine Kostensenkung ermöglichen. Wichtig ist es dabei, das Unternehmen als Ganzes und nicht
losgelöst nur die IT zu betrachten. Denn auch wenn die IT selbst hinsichtlich der Energieeffizienz
optimiert werden kann, so lassen sich mir ihrer Hilfe möglicherweise in anderen
Unternehmensbereichen viel größere Effizienzgewinne erzielen.
Doch bevor man also den zweiten Schritt vor dem ersten macht, sollte man sich über die
Vorgehensweise im Klaren sein. Experten schlagen dabei folgende Schritte vor:
Kick-off: Definition der Unternehmensbereiche und Parameter, die untersucht
werden sollen und können,
Bestandsaufnahme: Ermitteln des CO2-Gesamtausstoßes durch Assessment der
verschiedenen Unternehmensbereiche,
Definieren eines CO2-Reduktionsziels und konkreter Maßnahmen,
Umsetzung der definierten Optimierungsmaßnahmen und
fortlaufendes Monitoring.
Die besondere Stärke eines langfristig anlegten, systematischen Konzepts liegt darin, dass es
damit zum Beispiel möglich ist, nach der Analyse des Ist-Zustandes verschiedene Geschäftsszenarien
durchzuspielen und so Energie- und Kosteneinsparpotenziale bereits im Vorfeld genauer zu ermitteln.
Beispielsweise lassen sich dann folgende Fragen beantworten: Was wäre, wenn das Unternehmen seine
Rechenzentren konsolidieren und durch Virtualisierung besser auslasten würde? Kann es dadurch
Server abschalten oder gar RZ-Standorte schließen? Welche Auswirkungen hätte die Einführung von
flexiblen Arbeitsweisen, wenn also Mitarbeiter gelegentlich von zu Hause oder unterwegs arbeiten
könnten? Wie wirkt es sich aus, wenn Mitarbeiter seltener zu Meetings fahren oder fliegen müssten
und stattdessen Audio- und Videokonferenzen nutzten?
Projekt-Kick-off
Als erstes sollte man ein Team bilden, das eine eingehende Bestandsaufnahme des CO2-Ausstoßes
als Projekt vorantreibt. Gut ist es, wenn sich Mitglieder der Unternehmensleitung federführend an
dem Projekt beteiligen. Denn die Rückendeckung durch die Unternehmensleitung ist sehr wichtig, weil
nur ein ganzheitlicher Ansatz, der auch Abteilungsgrenzen überschreitet, die Einsparpotenziale
aufdecken kann.
Beim Projekt-Kick-off sollte man als erstes Etappenziel beschließen, nur auf Basis genauer
Zahlen die künftigen Klimaziele festzulegen und zu überprüfen. Nur so können Unternehmen
gewährleisten, dass sie nicht völlig am Ziel vorbeischießen und zum Beispiel einen Bereich
optimieren, der im Gesamtgefüge des Unternehmens nur eine untergeordnete Bedeutung hat. Wer die
Zertifizierung nach einer Umweltnorm für das Unternehmen anstrebt, etwa nach ISO 14.001, sollte
dies auch gleich vom Start weg im Auge behalten, denn viele für die ISO-Zertifizierung benötigten
Eckdaten lassen sich dann gleich mit erheben.
Ziel der Bestandsaufnahme ist es herauszufinden, welchen CO2-Ausstoß das Unternehmen insgesamt
erzeugt – durch die eigentliche Geschäftstätigkeit, die Gebäude-Infrastruktur, die IT, die
Mitarbeiter etc. Dabei ist es sinnvoll, sich an einem etablierten Modell wie dem Greenhouse Gas
Protocol (GHG) zu orientieren. Nach dem GHG betrachtet man drei Schwerpunkte ("Scopes"). Den ersten
Schwerpunkt bilden die direkten Emissionen durch Energieverbrauch. Hier geht es um den eigenen
Verbrauch von fossilen Energieträgern; bei Dienstleistungsunternehmen fällt in diese Rubrik vor
allem der Gas- und Ölverbrauch für Heizung und Klimatisierung der Büroräume. Aber auch ein eigenes
Blockheizkraftwerk würde hier berücksichtigt.
Der zweite Schwerpunkt deckt indirekte Emissionen durch Elektrizität ab. Dieser Posten wird in
aller Regel der größte sein. In diese Rubrik fällt hauptsächlich der Strom, der für Bürogebäude und
Rechenzentren oder auch Produktionsanlagen verbraucht wird. Der dritte Schwerpunkt versammelt
andere indirekte Emissionen. In diese Gruppe fallen Emissionen, die außerhalb des eigenen
Unternehmens (zum Beispiel bei Dienstleistern) anfallen; dies betrifft beispielsweise Reisen mit
Flugzeug oder Bahn, Miet- oder Leasingfahrzeuge oder auch die Pendelfahrten von Mitarbeitern zum
Arbeitsort.
Wie viele Mitarbeiter die Assessment-Phase erfordert, hängt stark von der Größe und Struktur
eines Unternehmens ab – und natürlich auch davon, wie leicht die benötigten Daten zu beschaffen
sind. Ein Anhaltspunkt: Bei BT Germany waren vier Experten über einen Zeitraum von vier Wochen mit
der Datenerhebung beschäftigt. Aufwändig ist der Vorgang immer dann, wenn Daten nicht systematisch
aufbereitet vorliegen, weil etwa Stromzähler oder Kilometerstände unregelmäßig abgelesen werden.
Deshalb sollte man auch gleich bei der Datenerhebung dafür sorgen, dass die Werte ab sofort
systematisch protokolliert werden, um das Monitoring und die Erfolgskontrolle zu ermöglichen.
Die Auswertung der Daten kann leicht mit einer Überraschung enden – wenn zum Beispiel die
größten Energieverbraucher nicht dort entdeckt werden, wo man sie vermutet hat. Hier kann sich also
zeigen, dass die Debatte um den Standby-Verbrauch der Monitore nebensächlich ist im Vergleich zum
Energieverbrauch der veralteten Klimaanlage. Zwar ist auch ein kleiner Sparbeitrag stets
willkommen, aber es gilt, zunächst die wichtigen Bereiche zu identifizieren, in denen eine
Optimierung sinnvoll und realistisch möglich ist.
Die Zahl der mobilen Mitarbeiter steigt ständig. Mehrere tausend dienstliche Flüge pro Jahr sind
für ein Unternehmen mit tausend Mitarbeitern nicht unüblich. Viele dieser Reisen führen aber oft
nicht zu Messen oder zur Kundenbetreuung, sondern sind für interne Besprechungen angesetzt. Durch
Audio- und Videokonferenzen lässt sich dieser Reiseaufwand reduzieren. So hat BT es in Deutschland
geschafft, innerhalb eines Jahres die Zahl der Flüge um mehr als 20 Prozent zu senken. Weiteres
Einsparpotenzial ergibt sich, wenn Unternehmen auf Unified-Communications-Lösungen setzen und die
Kommunikation zwischen Mitarbeitern sowie mit dem Kunden weiter optimieren.
Auch fernab der IT, bei Dienstfahrzeugen, lässt sich einiges an CO2 einsparen. Durch die
Umstellung der Firmenflotte auf sparsamere Modelle sind deutliche Einsparungen möglich, die leicht
im Bereich von 20 bis 30 Prozent liegen können – was sich auch unmittelbar in den Treibstoffkosten
niederschlägt. Da Firmenwagen meist nur wenige Jahre gefahren werden, ist eine Umstellung relativ
kurzfristig möglich.
Weiteres Potenzial ergibt sich bei Firmen mit eigenem Außendienst, etwa technischem Support, der
Installationen bei Kunden durchführt. Je kurzfristiger man hier die Termine vereinbart, umso höher
ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Außendienst unnötig lange Wege zurücklegt. Hier kann eine
IT-gestützte Lösung zur Optimierung der Einsatz- und Routenplanung helfen und Zeit, Wegstrecke
sowie Treibstoff sparen. Je nach Art der Aufgaben sind 15 bis 30 Prozent Ersparnis realistisch.
Mithilfe einer Business-Simulation lassen sich insbesondere auch logistische Prozesse und Abläufe
simulieren und optimieren.
Ein großer Posten bei den CO2-Emissionen ist der Stromverbrauch für Büros und Rechenzentren von
Unternehmen. Gerade bei älteren Rechenzentren können schon kleine, kurzfristige Maßnahmen große
Wirkung entfalten, so die Erhöhung der Raumtemperatur um ein paar Grad oder der Einsatz von
Frischluftkühlung. Durch die systematische Prüfung des Inventars im Rahmen des Assessments lassen
sich auch Geräte identifizieren, die nicht mehr benötigt werden oder wenig ausgelastet sind, sodass
sie sich für Virtualisierung anbieten.
Auch wenn der Energieverbrauch im RZ kurzfristig nur um zehn Prozent sinkt: Bei IT-lastigen
Unternehmen macht deren Anteil am gesamten Stromverbrauch leicht 50 Prozent und mehr aus, sodass
sich schon bei einem mittelgroßen Unternehmen ein Kostensenkungspotenzial von mehreren 100.000 Euro
ergeben kann.
Nach den ersten Schritten sollte das Unternehmen auch gleich festlegen, wie der
Projektfortschritt zu überprüfen und zu messen ist. Vor allem in den Bereichen, in denen Daten
schwer zu ermitteln waren, sollte man regelmäßige Erhebungen etablieren. Zur besseren Überwachung
der Energieverbraucher sollte ein Unternehmen auch über den Einsatz von Smart Metering
nachdenken.
Ausblick
Wichtig ist in der Praxis, dass Unternehmen die Bestandsaufnahme nicht schon an mögliche
Verbesserungsschritte koppeln. Man sollte zuerst analysieren und dann über mögliche Verbesserungen
vor allem in den Bereichen nachdenken, die das größte Potenzial und die beste Wahrscheinlichkeit
einer erfolgreichen Umsetzung bieten. Am Ende steht immer eine Überprüfung, ob auch alle Ziele
erreicht werden konnten. Nachdem das eigene Unternehmen eine Nachhaltigkeitsstrategie etabliert
hat, wäre ein möglicher nächster Schritt, auch Lieferanten aufzufordern, energieeffiziente Produkte
und Services anzubieten.